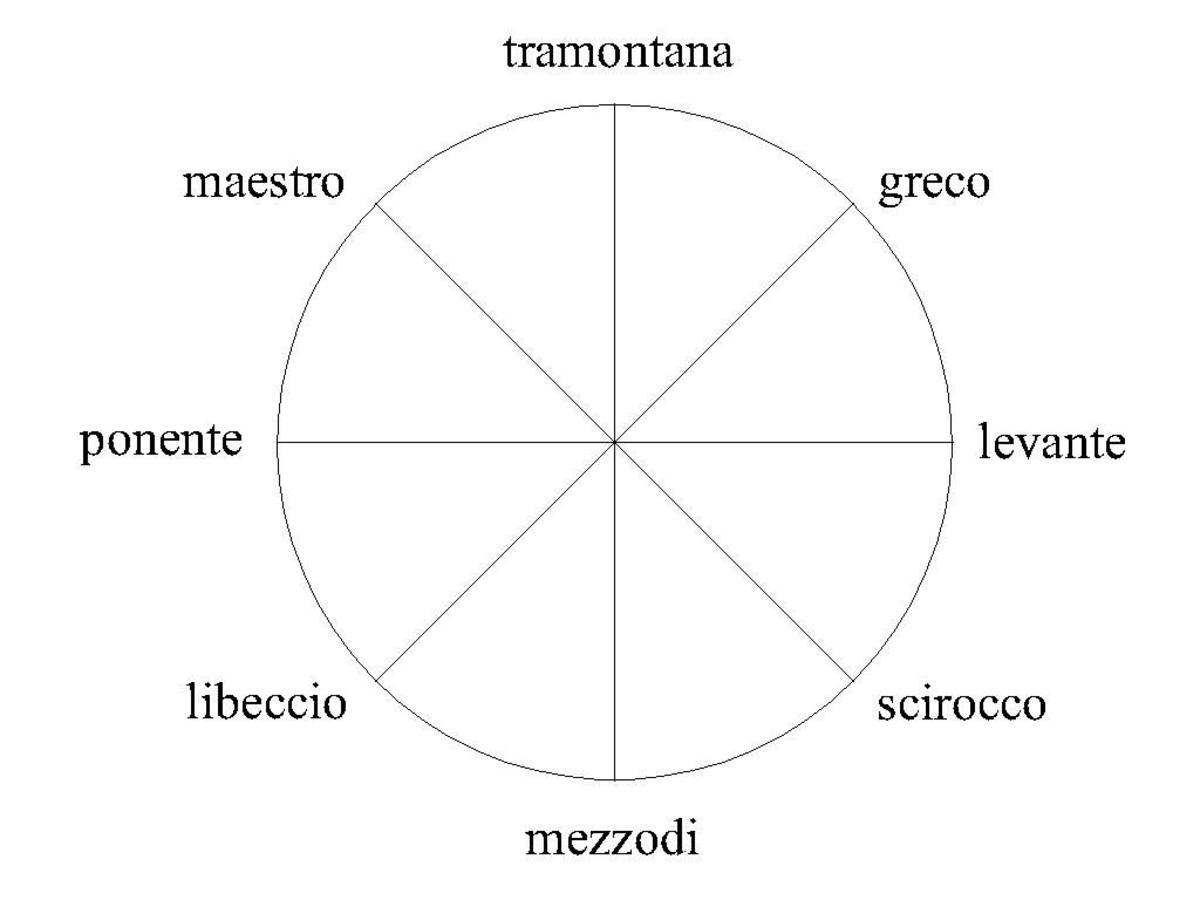Chapter structure
- 2.1 Die Frühe Neuzeit in Italien
- 2.2 Bauverwaltung
- 2.3 Bauplanung und Entwurf: Grundsätzliches
- 2.4 Architekten: Vorbild, ‚Antike‘ und institutionelles Umfeld
- 2.5 Planung und Wissen um Umweltbedingungen
- 2.6 Planungs- und Entwurfstechniken
- 2.7 Logistik
- 2.8 Materialwissen
- 2.9 Bautechniken
- 2.10 Bauleute und Bauprozess
- 2.11 Arten des Wissens und ihre Tradierung
- 2.12 Wissensentwicklung und Innovation
- Fußnoten
Das Bauwesen
2.1 Die Frühe Neuzeit in Italien
2.1.1 Naturräumliche Bedingungen
2.1.2 Staatliche Organisation
Auch wenn die Zahl der konkurrierenden Staaten in
2.1.3 Gesellschaftliche Struktur
Die gesellschaftliche Struktur in den italienischen Staaten der Frühen Neuzeit war durch eine Reihe von Konstanten bestimmt. Zum einen waren dies die feudalen Besitzstrukturen, die sich v. a. im ländlichen
Die Macht des Adels blieb in vielen Bereichen die ganze Frühe Neuzeit hindurch ungebrochen, ständische bzw. durch die Herkunft erworbene Privilegien bestimmten nach wie vor weite Bereiche der Gesellschaft. Das ging einher mit einem Zunftwesen, das im Mittelalter die Stadtrepubliken dominiert hatte und das sich in der Frühen Neuzeit weiter ausdifferenzierte. Wenn auch das neu entstehende Akademiewesen und ein neues Selbstverständnis der bildenden Künstler, das sich seit dem 15. Jahrhundert immer stärker ausgeprägt hatte, eine Schwächung des Zunftwesens und eine gewisse soziale Durchlässigkeit mit sich brachten, so waren doch auch diese Institutionen bestrebt, Privilegien aufzubauen und zu verteidigen.
Ebenso entscheidend war die ungebrochene Vorherrschaft der katholischen Kirche. Eine besondere Dynamik ging dabei von den im Zuge der Gegenreformation neu gegründeten Orden wie den Theatinern, den Oratorianern und vor allem den Jesuiten aus, die mit ihren in den Zentren der Städte errichteten Konventen und den kapillar auf das gesamte katholische
Gleichzeitig gab es eine Reihe von Veränderungen, die sich freilich in den Staaten
Die Veränderungen im Bildungssektor und deren Bedeutung für die Gesellschaft sind bereits mehrfach benannt worden. Die Berufsorganisationen differenzierten sich aus, Akademien im Bereich von Kunst und Wissenschaft wurden gegründet, die Universitäten wurden aus- und zahllose Jesuitenkollegien aufgebaut. All diese Lehrinstitutionen, die nunmehr weite Teile der Bevölkerung erreichten, bildeten sich unter anderem deshalb, weil Wissen durch Verschriftlichung lehrbar geworden war. Ohne den Buchdruck und die graphischen Vervielfältigungstechniken wie Holzschnitt oder Kupferstich, die im 15. Jahrhundert von
Gleichzeitig wurde das mündlich und praktisch tradierte Wissen abgewertet, auch wenn es keineswegs an Bedeutung für das Bauwesen und die Genese seiner konkreten Resultate eingebüßt hatte. So geriet dieses Wissen in der Frühen Neuzeit vielfach in ein Spannungsfeld: Handwerkstechniken, wie etwa Holzkonstruktion, wurden einerseits Thema von Buchpublikationen, andererseits ließen sich die manuellen Implikationen dieses Wissens und das so entscheidende Element der ,Erfahrung‘ in Büchern nicht festhalten.
2.1.4 Standardbauaufgaben und besondere Architekturleistungen
Im Bereich des Kirchenbaus wirkte das Konzil von
Der Bau der Großkuppeln in
Eine besondere Architekturleistung der Frühen Neuzeit in
2.2 Bauverwaltung
2.2.1 Kuppel von S. Maria del Fiore
Die Verwaltungsstruktur der Opera bildete sich erst in den Jahren nach 1331 heraus.11 Geleitet wurde sie von vier Operai, die vier, ab 1338 sechs Monate amtierten und jeweils in Zweiergruppen gegeneinander versetzt gewählt wurden, so dass sich eine flüssigere personelle Verzahnung ergab. Die Wahl sowie das vorherige scruptinium der möglichen Kandidaten oblag den Konsuln der Arte della Lana. Die Operai genossen volle Autorität über die Belange des Baues; in besonders wichtigen Fragen (etwa der Beschlussfassung über Projekte) entschieden sie mit den Zunftkonsuln gemeinsam. Ihnen standen als einziger hauptamtlicher Mitarbeiter ein Notar sowie für die Buchhaltung ein camerarius zur Seite, dem angesichts der zunehmenden Komplexität seiner Aufgaben eine wachsende Anzahl von Assistenten zugeordnet wurde.12 Bei Entgegennahme der für die Opera bestimmten Summen sowie bei Auszahlungen bedurfte er zudem der Anwesenheit des Notars, der auch den gemeinsam mit den Operai vorzunehmenden monatlichen Bücherabschluss zu protokollieren hatte. In den 1350er Jahren kam das Amt des Proveditore hinzu, der als „Bindeglied zwischen dem eigentlichen Bauvorgang und dem Verwaltungsapparat“ fungiert zu haben scheint. Ihm oblagen die Überwachung von Quantität und Qualität der geleisteten Arbeit, Kontrolle und Abrechnung der Lieferungen, die Durchsetzung von Verwaltungsbeschlüssen ebenso wie das Erwirken von Genehmigungen für Änderungen oder Fortführung begonnener Arbeiten etc. Auch ihn unterstützten mehrere Assistenten.13 Die Ausdifferenzierung und Erweiterung der Ämterstruktur in der Opera lässt klar erkennen, dass man die besonderen Anforderungen, die eine Baustelle dieser Größe und dieses technischen Anspruchs stellte, erst schrittweise erkannte und entsprechend reagierte.
Als eigentlicher Bauleiter amtierte der capomaestro. Er war jedoch keineswegs automatisch auch der Entwerfer für die am Bau auftretenden Gestaltungsaufgaben. Gerade in den Jahren der Vorbereitung des definitiven Projektes (1366/67) setzte die Opera verstärkt auf Maler und Steinmetzen, d. h. auf Bildkünstler, denen offenbar höhere gestalterische Kompetenz zugetraut wurde.14 Die capomaestri waren demgegenüber in erster Linie Bautechniker, die zwar auch Entwürfe vorlegen konnten, ihre eigentliche Tätigkeit aber unabhängig von Erfolgen in diesem Bereich ausübten.
Charakteristisch für die
Der Bau der Kuppel, der ab 1417 vorbereitet wurde, stellte nochmals bedeutend höhere Anforderungen als die übrigen Bauteile, bautechnischer ebenso wie -organisatorischer Art. Im August 1418 wurde ein öffentlicher Wettbewerb für ein Modell oder eine Zeichnung zur Wölbung der Kuppel ausgeschrieben. Die Tradition der Entscheidungsfindung durch Wettbewerbe wurde also fortgesetzt; daran sollte sich auch nichts ändern, als es 1436, nach Vollendung der eigentlichen Kuppelwölbung und auf der Höhe von
Im November 1419 richtete die Arte della Lana den Ausschuss der Quatuor offitiales Cupule ein: Für jeweils sechsmonatige Amtsperioden gewählt als sollicitatores et conductores hedifitii prelibati (Antreiber und Geschäftsführer der vorgesehenen Bauten), hatten sie für den reibungslosen Ablauf des Kuppelbaus zu sorgen; sie besaßen dabei die gleichen Vollmachten wie Operai und Zunftkonsuln, mit der Ausnahme, dass sie ohne deren Zustimmung keine eigenständigen Beschlüsse fassen konnten.22 Offensichtlich befand man die bisherige Verwaltungsstruktur für die Durchführung eines so komplexen Bauvorhabens für nicht mehr ausreichend. Die Bauleitung wurde einem Triumvirat übertragen:
Schon den Zeitgenossen galt
Die Ernennung der drei Proveditoren scheint zunächst auf Widerruf erfolgt zu sein; seit 1426 wurden
Ein Unternehmen wie das der Kuppel erforderte neue Wege im Hinblick auf die rationale
Die Buchführung erfolgte in der Domopera in verschiedenen Serien. Die umfangreichste bilden die ab April 1362 erhaltenen Quaterni deliberationum, heute Bastardelli di Deliberazioni e Stanziamenti genannt: in lateinischer Sprache verfasste, kladdenartige Bücher, die jeweils ein halbes Jahr umfassten und vom Notar der Opera geführt wurden. Sie enthalten, jeweils in Untergruppen gegliedert, Beschlüsse (deliberazioni), stanziamenti, catture, fideiussioni. Zwischen 1406 und 1446 gab es parallel auch in Italienisch abgefasste Bastardelli di Stanziamenti e Ricordanze. In Latein sind die Libri di deliberazioni geschrieben, die den Bau betreffende Beschlüsse der Operai sowie der Konsuln der Arte della Lana enthalten. Schließlich wurden vom Kämmerer der Opera Kassenbücher (Quaderni di cassa) geführt, die, ab 1434 erhalten, in doppelter Buchführung angelegt sind. Nur ein Journal hat sich aus dem für uns relevanten Zeitraum erhalten; es mag aber solche für weitere Jahre gegeben haben.
Den Institutionalisierungsgrad der Opera spiegelt die Art und Weise wider, wie die
Was sich mit der Verwaltungsreform von 1331 in Bezug auf die Finanzierung vor allem änderte, war die Tatsache, dass die Zuwendungen der Opera nun ohne zeitliche Begrenzung festgeschrieben wurden.39 Der geringe Baufortschritt der vergangenen Jahrzehnte hatte offenbar die Einsicht befördert, dass ohne eine langfristige finanzielle Sicherung ein Bauprojekt dieser Größenordnung nicht zu stemmen sein würde. Diese Einkünfte hatten drei Standbeine: zum einen direkte kommunale Finanzierung, d. h. einen bestimmten Anteil an verschiedenen Einkünften der Kommune; zum zweiten indirekte kommunale Finanzierung, die also nicht aus den Einkünften der Kommune stammten, der Opera aber aufgrund kommunaler Gesetze zustanden; schließlich, wenn auch erst ab 1380, eine eigenständige Finanzierung dank der Überschreibung ausgedehnter Waldgebiete im
Allerdings sind hierbei gewisse Abstriche zu machen. Denn einerseits wurde die Opera gerade im späten 14. Jahrhundert auch zu zweckfremden Bauunternehmungen (wie der Loggia dei Signori) herangezogen, bei denen man sich ihrer technischen und administrativen Kompetenz gleichermaßen versichern wollte.41 Andererseits bestand immer die Möglichkeit, die Zahlungen an die Opera vorübergehend auszusetzen, wenn etwa militärische Erfordernisse dies nötig machten. Die Rückzahlung der einbehaltenen Gelder konnte erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.42 Überdies waren gerade die der Opera gesetzlich zustehenden Einkünfte in der Praxis nur schwer einzutreiben. So vermieden es Erben und Notare immer wieder, Testamente an die Opera zu melden.43 Und um die direkten Abgaben in vollem Umfang zu erhalten, musste die Opera gar Beamte bei den abgabepflichtigen Behörden unterhalten, die den korrekten Zufluss der Mittel an den Dombau zu überwachen hatten.44 Die Rechte über die ‚grazie fiscali’ schließlich kamen zuweilen nur mit jahrzehntelangen Verspätungen in der Kasse der Opera an.45 Dennoch stellten die langfristigen gesetzlichen Regelungen der Einnahmen eine wesentliche Voraussetzung für das schließliche Gelingen des Dombaues dar.
Die erheblichen Vorteile des
2.2.2 Reverenda Fabbrica di San Pietro
Es mutet angesichts der in
Eine Reform erfuhr die Administration unter
Die dritte große organisatorische Veränderung unter
Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgte wie unter
Ab 1516/17 entzogen der allgemeine Ruin der päpstlichen Finanzen durch
Außerordentlich weitreichend waren die Vollmachten, die
Großbaustellen wie die des
2.2.3 Santa Maria delle Carceri, Prato
Als Behörde zur Ausführung und Verwaltung des Baues fungierte jeweils die dem Träger direkt unterstellte Opera. In
Die Aufgaben und Kompetenzen der Opera, insbesondere in Relation zu denen der übergeordneten Behörde, waren von Fall zu Fall unterschiedlich definiert. Die Opera der Madonna delle Carceri besaß volle Kontrolle über die Verwaltung der Einnahmen, ähnlich wie etwa in
Woher kam das Geld? Das Fundament der Einnahmen legten bei den Sanktuarien stets die Spenden der Gläubigen und Pilger. In
1den Opfergaben am Altar des wundertätigen Bildes (cassecta delle elemosine dell’altare);
2den Messopfergaben (cassecta delle elymosine delle messe);
3den Einnahmen aus dem Kerzenverkauf (cassecta di chi vende le candele e lo sportello de’ mocholi);
4dem gebrauchten Wachs (cassone della cera vechia), das zur Wiederverwendung zurückgegeben wurde.91
U. U. konnte eine Auftrag gebende Kommune auch Sondersteuern oder -abgaben einführen, um den Bau der Kirche langfristig abzusichern, wie etwa beim Bau der Madonna dell’Umiltà in
Bei der Verwaltung von Kult und Baustelle griff die Kommune bisweilen auf bewährte eigene Strukturen zurück. So spielten in
Das Prozedere der Zahlungen ging in
Der Camerlengo hatte in
Als Architekt der Madonna delle Carceri wurde, offenbar auf Wunsch Lorenzo il
Die Steinmetzarbeiten wurden im wesentlichen von Lorenzo di
2.2.4 Städtische Statuten und Bauvorschriften
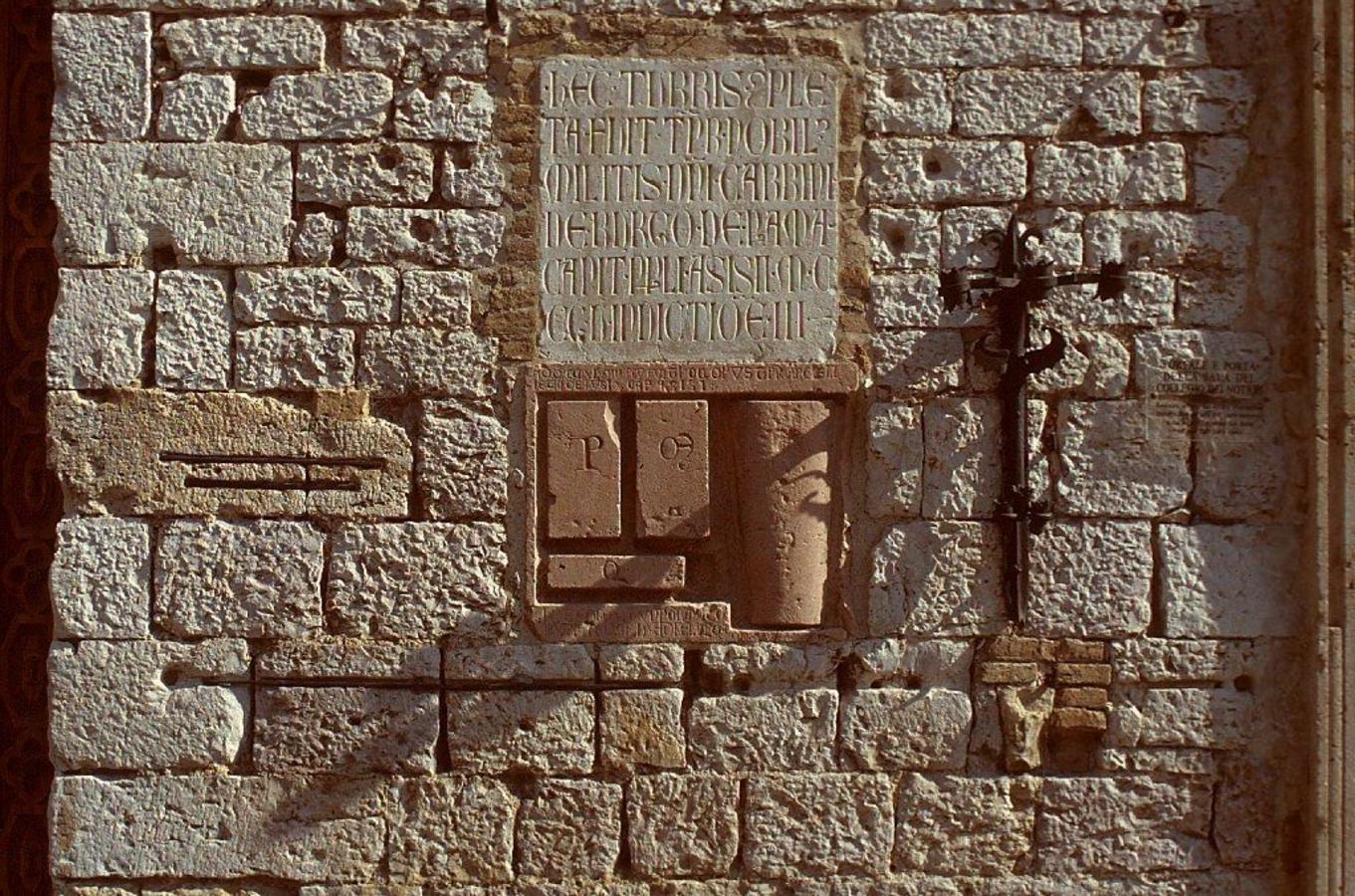
Abb. 2.1: Ziegel- und Dachziegelmodelle am Rathaus von
Die Stadtstatuten sind ein das Mittelalter und die Neuzeit übergreifendes Phänomen. In

Abb. 2.2: Ziegel- und Dachziegelmodelle am Rathaus von Gubbio (Foto: M. Quast).
2.2.5 Capitolati, cottimo und andere bauspezifische Organisationsformen
In einer vergleichenden Untersuchung von römischen conti, capitolati und misure e stime bemerkt Cirielli, dass diese Dokumente jeweils gleichartig aufgebaut sind und vermutet, dass es im 17. Jahrhundert eine Art Referenztext gegeben hat. Aus wissenhistorischer Sicht kann dies bedeuten, dass ein capitolato vom anderen abgeschrieben und lediglich projektspezifisch angepasst wurde und sich auf diese Weise ein Standard herausbildete. Cirielli berichtet, dass die capitolati im konkreten Fall nicht allzu rigide eingesetzt wurden. Das vor Baubeginn erstellte capitolato hinderte die Bauleute im konkreten Fall keineswegs daran, darüber hinaus gehende Arbeiten während des Bauprozesses zu vereinbaren und preislich festzulegen. Beim Bau von Sant’Ivo in
2.2.6 Die Capitani di Parte Guelfa und die Ufficiali di Torre
Ein im vorliegenden Text bislang noch nicht behandelter Bereich des Bauwesens sind die Infrastrukturen, also Straßen, Wasserversorgung, Kanalisation, Festungsbau und Wasserwege. Die Instandhaltung der Straßen im Stato Fiorentino war bereits im 14. Jahrhundert institutionell organisiert. Aus dem Jahre 1318 datiert eine Aufteilung der Zuständigkeiten für die Instandhaltung der Straßen auf die Kirchengemeinden. Hinzu kam für
Die Capitani di Parte Guelfa waren bereits ca. 1250 ins Leben gerufen worden und hatten zunächst die Aufgabe, die Ghibellinen sowie die Feinde der Repubblica Fiorentina zu verfolgen sowie die
Grundlage der administrativen Tätigkeit war die Dokumentation der Straßen. Während sich die Ufficiali di Torre im 14. Jahrhundert geschriebener Verzeichnisse bedienten, in denen die Straßenabschnitte, für die die einzelnen Kirchengemeinden zuständig waren, genau vermessen und beschrieben waren, wurden diese beschreibenden Informationen ab 1461 durch ein Kartenwerk ergänzt. Der Kartensatz wurde bis 1576 laufend annotiert und aktualisiert und blieb offenbar auch nach dem neuen censimento aus den Jahren 1580–95 (Abb. 2.3) weiter gültig, zumal 1664 eine Kopie des älteren Kartensatzes angefertigt wurde.117 In den schematischen, also nicht topographisch genauen Karten wurden alle Straßen dargestellt. Ausgehend von den Kreuzungen wurden die genauen Längen derjenigen Straßenabschnitte in braccia eingetragen, die von der jeweiligen Gemeinde instandzuhalten waren. Hinzu kamen die Beschreibungen der Straßen.
Ein Dauerproblem der Parte und ihrer Vorgängerinstitutionen seit dem 14. Jahrhundert bis zur Auflösung der Parte im 18. Jahrhundert war es, die Gemeinden dazu zu zwingen, ihren Instandhaltungspflichten nachzukommen. So wurden die Straßeninspektoren im 14. und 15. Jahrhundert regelmäßig bestochen, bis die Ufficiali di Torre sich schließlich gezwungen sahen, in den Jahren 1459–61 in einem Kraftakt die erforderlichen Straßenbauarbeiten direkt auszuführen und den jeweiligen Gemeinden in Rechnung zu stellen. Aber auch in den Jahrzehnten danach und im 16. Jahrhundert kamen die Gemeinden ihren Instandhaltungspflichten nicht nach. Daraufhin wurden die Zuständigkeiten ab 1574 umgeschichtet. Zwei der capomaestri der Parte wurden zu Ufficiali dei fiumi ernannt. Sie hatten auch die Zuständigkeit für die Straßen, wurden besser bezahlt und bekamen Tagegeld auf Inspektionsreisen. 1578 wurde für den Stato Fiorentino (ohne
Der Bau von
| Bolognese | 11.568 |
| Firenze – Faenza | 2.478 |
| Firenze – Terra del Sole | 7.168 |
| Maestra del Mugello | 4.623 |
| Valtiberina | 1.761 |
| Maestra del Casentino | 4.442 |
| Maestra del Valdarno sup. | 8.295 |
| Volterrane | 7.542 |
| Pisana | 6.659 |
| Empolese | 925 |
| Romana | 4.685 |
| Firenze – Pistoia | 2.511 |
| di Firenze | 1.381 |
Tab. 2.1: Kosten für Straßenbau und -instandhaltung im Zeitraum 1587–1608, Angaben in Scudi. Quelle: Gallerani and Guidi 1976, 329.
Tab. 2.1: Kosten für Straßenbau und -instandhaltung im Zeitraum 1587–1608, Angaben in Scudi. Quelle: Gallerani and Guidi 1976, 329.
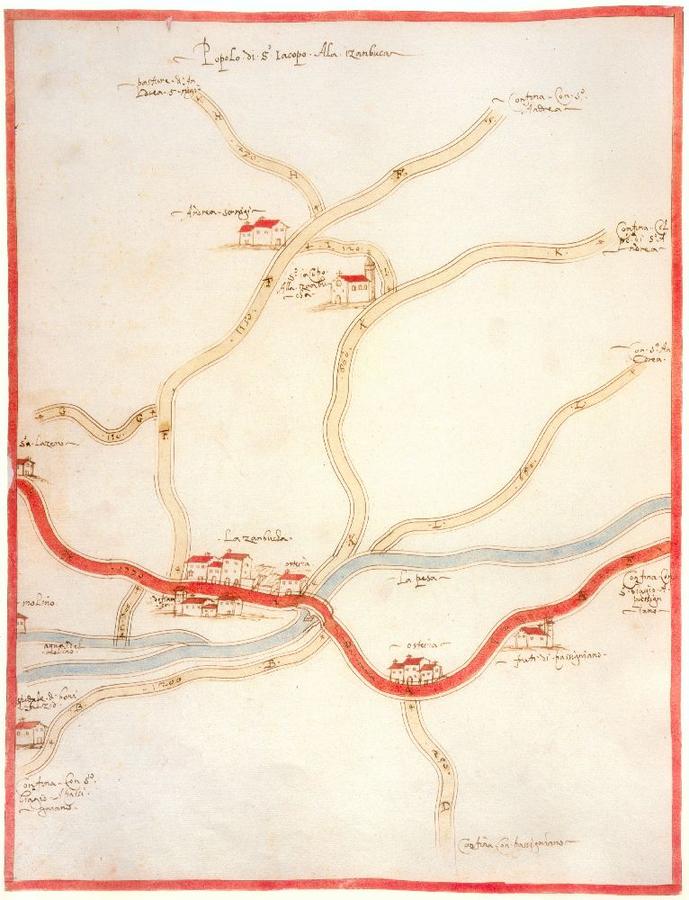
Abb. 2.3: Parte Guelfa, Karte der Straßen, für deren Instandhaltung die Gemeinde von ‚S. Iacopo a la Zambuca‘ (Sambuca) verpflichtet war und strada maestra (im Bild dunkelgrau), 1580–1595 (© Archivio di Stato di
Zu den konkret ausgeführten Straßenbauarbeiten gibt es für das 13. und 14. Jahrhundert praktisch keine Quellen, da die Aufzeichnungen der Ufficiali di Torre und der Parte Guelfa (s. u.) durch einen Brand 1566 zum großen Teil verloren gegangen sind. Ab dem späteren 16. Jahrhundert und insbesondere für die Regierungszeiten von
Aus dem 17. Jahrhundert sind eine Reihe von Mitgliedern der Parte Guelfa bekannt, u. a. der Festungsbauingenieur Jacopo
Ein anderes Beispiel für eine Aufsicht führende Baubehörde sind die für die städtebauliche Entwicklung Roms zuständigen Maestri delle Strade. Diese waren nicht nur eine Verwaltungsbehörde, sondern dienten den Päpsten zur Durchsetzung ihrer jeweiligen Stadtentwicklungspolitik, die die Rolle der Stadt als Zentrum der katholischen Christenheit ästhetisch unterstreichen sollte.
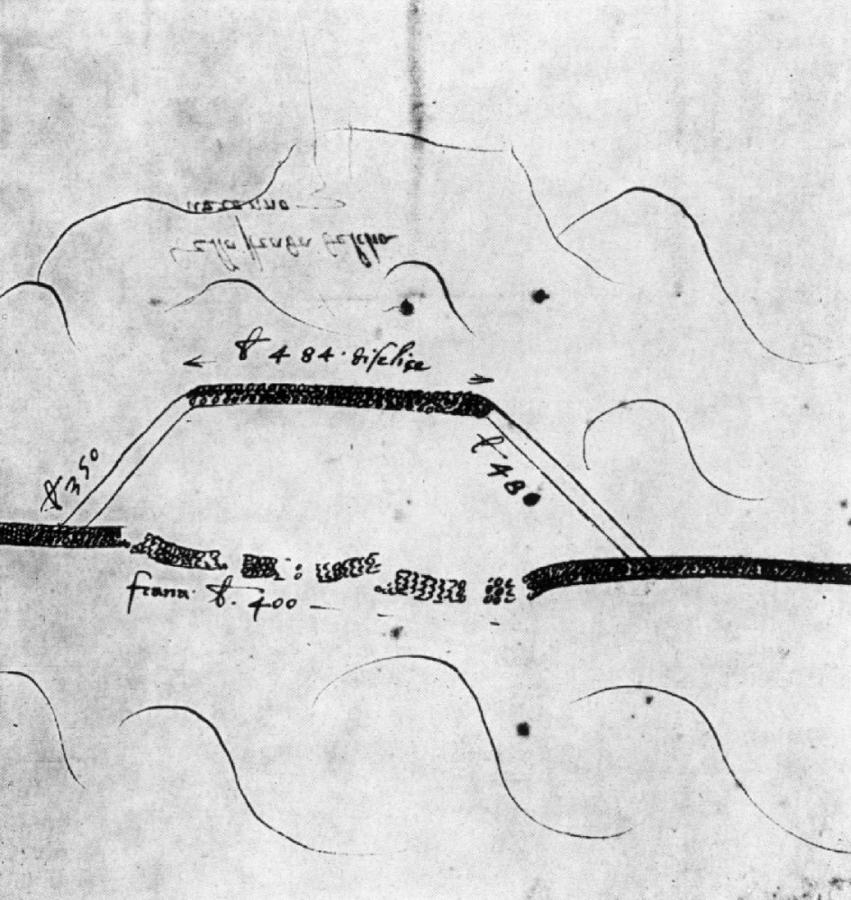
Abb. 2.4: Darstellung des Erdrutsches zwischen
2.2.7 Maestri delle Strade, Rom
Die römische Institution der Maestri delle Strade ist bereits im 13. und 14. Jahrhundert dokumentiert und hat ihre Wurzeln in der Stadtverwaltung des antiken
Im Laufe des 15. Jahrhunderts gelangten die Maestri unter die Kontrolle des Papsttums, das sich seit
Ab dem Jahre 1425 sind die Namen der Maestri delle Strade beinahe lückenlos bekannt.138 Viele der Maestri waren für ein Jahr im Amt, mehrfach wurden dieselben Personen aber bis zu drei mal hintereinander wieder eingesetzt und kehrten bisweilen nach einigen Jahren Unterbrechung erneut in das Amt zurück. Während – zumindest im 17. und 18. Jahrhundert – die Maestri selbst den höchsten sozialen Schichten Roms entstammten, waren die Sottomaestri oft Baufachleute.139 Im Jahre 1646 bekleideten unter anderem Francesco
Aus dem 17. Jahrhundert haben sich zwei Libri litterarum patentium mit Aufzeichnungen der Maestri delle Strade im Archiv der Doria Pamphilj erhalten, die einen Einblick in die Arbeit der Institution in den Jahren 1641–1655 geben.142 Schon die Durchsicht dieser Quellen zeigt, dass jeder Umbau eines Gebäudes, der eine Veränderung des physischen Erscheinungsbildes der Stadt bedeutete, einer Genehmigung bedurfte. In den Büchern wurde für komplexe Fälle zudem skizzenhaft festgehalten, wofür eine Genehmigung beantragt bzw. erteilt wurde. Die Vorgänge reichen von der Errichtung von Strebepfeilern im Straßenraum, der Überbauung von Gassen oder der Errichtung von Zugangstreppen zu Kirchen im öffentlichen Straßenraum, bis zur Beseitigung von Rücksprüngen bzw. der Begradigung von Palastfassaden. Letztere Maßnahmen bedeuteten für den Bauherrn einen Raumgewinn im Palastinneren und bereicherten gleichzeitig den Stadtraum um eine weitere repräsentative Fassade.
2.3 Bauplanung und Entwurf: Grundsätzliches
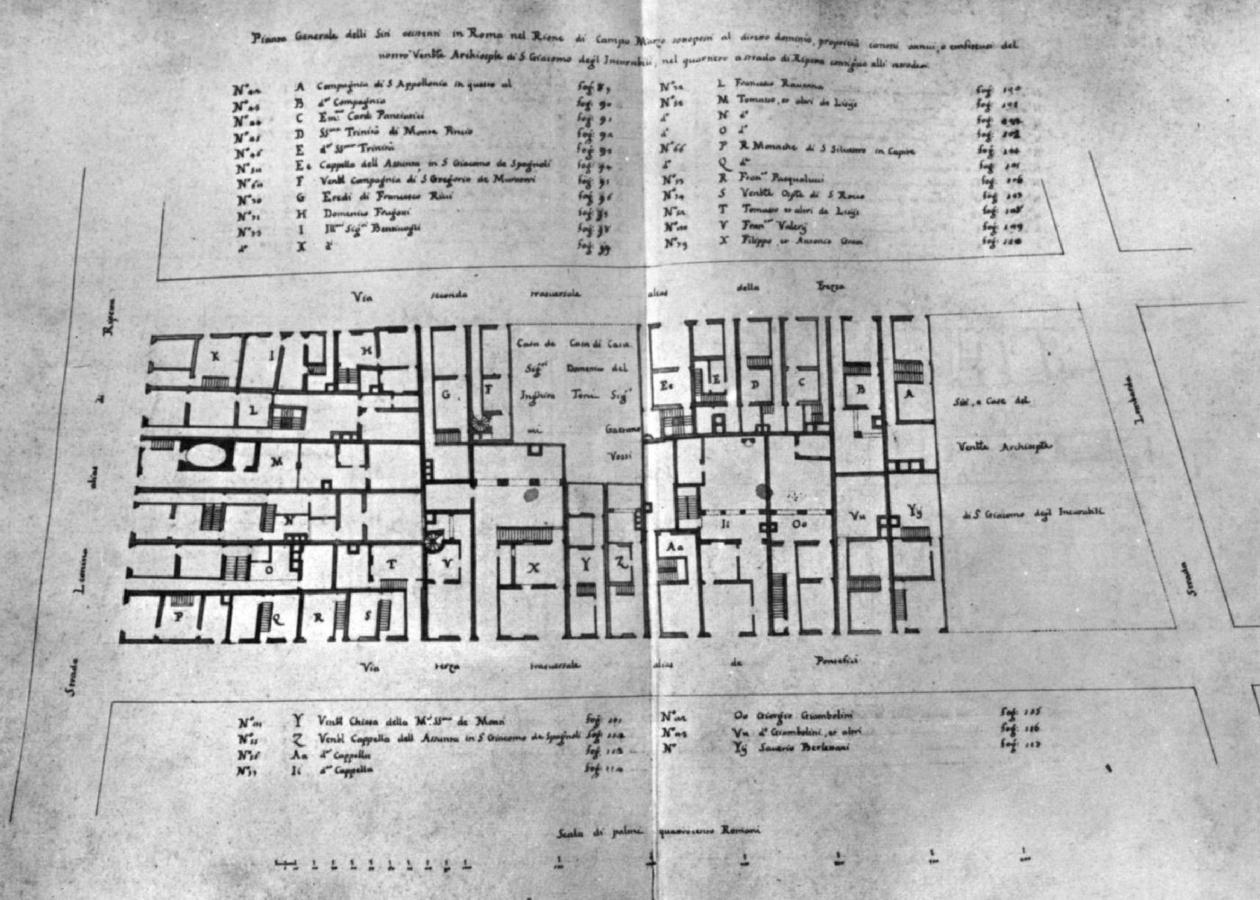
Abb. 2.5: Straßengeviert an der Via Ripetta in
Die Konzentration des Textes auf die Qualifikation und die Entwurfsausbildung der Architekten darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Praxis ein großer Teil der Bauten von Personen ohne Schulung in Entwurfsfragen entwickelt wurde. Diese Personen trafen nicht nur Entscheidungen hinsichtlich der Wahl der Bautechniken und der Vorbereitung der Baustelle (Planung im weiteren Sinne), sondern legten auch Form, Bautyp und die räumliche Konzeption der Bauten fest (Entwurf). Ein Beispiel dafür mag der Neubau einfacher Stadthäuser im
Ein ganz anderes Feld der Planung ohne Architekten erschließt die
2.4 Architekten: Vorbild, ‚Antike‘ und institutionelles Umfeld
2.4.1 Erforschung der Antike als Selbstausbildung der Architekten im 15. und frühen 16. Jahrhundert
| Vitruv/Barbaro (1567) | Ligorio (1553) |
|---|---|
| 1. ‚Lettere‘ (Grammatica) | … |
| 2. ‚Disegno‘ | ‚Sculpire‘ ‚Dipingere‘ ‚Inventioni proportionabili‘ |
| 3. ‚Geometria‘ | ‚Semetria‘ (Simmetria o Geometria?) |
| 4. ‚Prospettiva‘ (Ottica) | ‚Prospettrica‘ |
| 5. ‚Aritmetica‘ | ‚Eremetrica‘ ‚Matematica‘ |
| 6. ‚Storia‘ | ‚Historia‘ |
| 7. ‚Filosofia‘ | ‚Philosophia‘ ‚Moralità‘ |
| 8. ‚Phisiologia‘ | … |
| 9. ‚Musica‘ ‚Hydraulica‘ | ‚Musica‘ |
| 10. ‚Medicina‘ | ‚Medicina‘ |
| 11. ‚Leggi‘ (Diritto) | … |
| 12. ‚Ragioni del cielo e delle stelle‘ (Astronomia) | ‚Astronomia‘ ‚Cosmographia‘ |
| 13. … | ‚Geografia‘ ‚Topographia‘ |
Tab. 2.2: Disziplinen der Architekturausbildung. Quelle: Madonna 1980, 262.
Tab. 2.2: Disziplinen der Architekturausbildung. Quelle: Madonna 1980, 262.
Das Studium der antiken Kultur im weitesten Sinne und auch der antiken Architektur war ab dem späten 14. Jahrhundert von
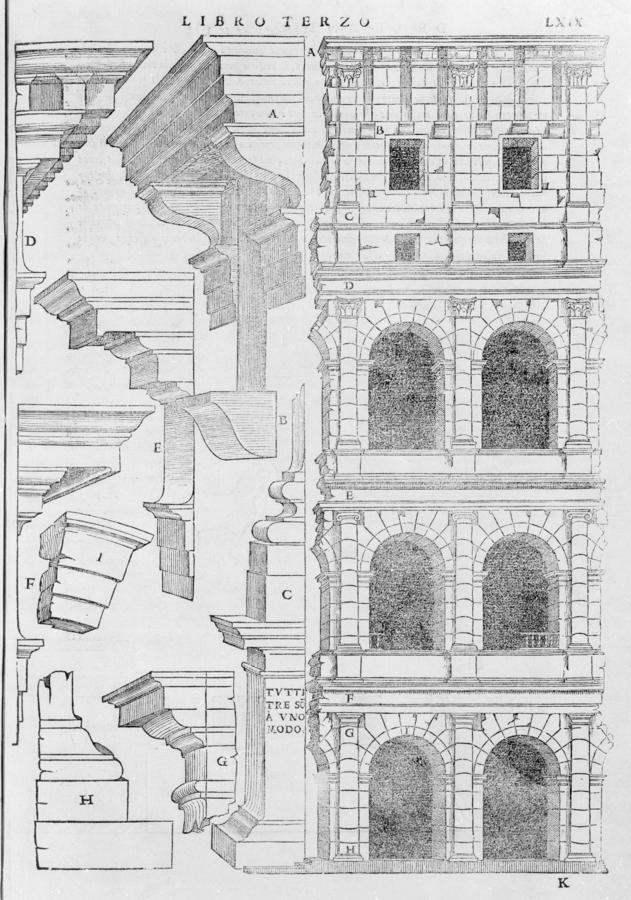
Abb. 2.6: Sebastiano
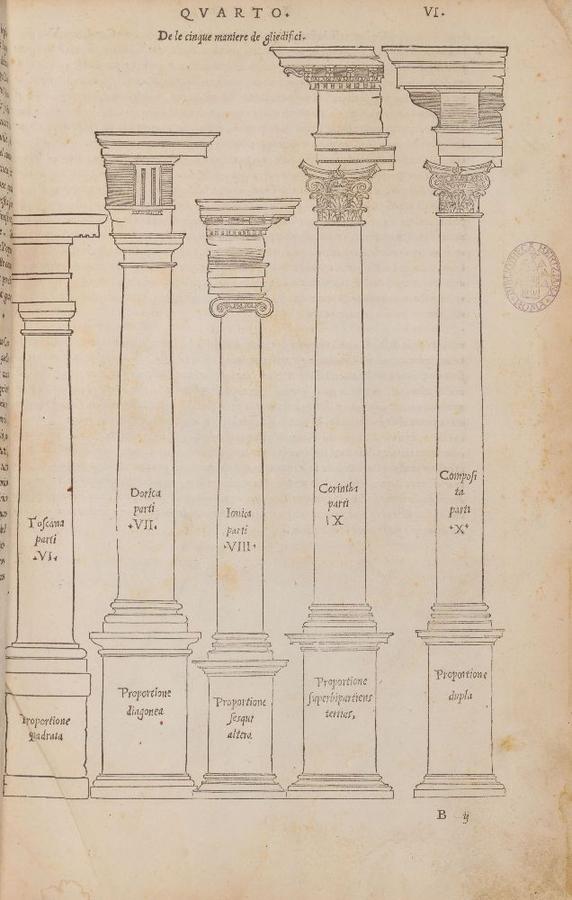
Abb. 2.7: Sebastiano
Die Studien der antiken Architektur bauten aufeinander auf.
2.4.2 Entwurfsleitendes Motiv ‚Antike‘
Wie gingen die Architekten mit dem entwurfsleitenden Motiv ,Antike‘ um? Um diese Frage im Sinne einer Wissensgeschichte der Architektur anzugehen, sollen im Folgenden einige Aspekte angesprochen werden. Zudem sei verwiesen auf den Abschnitt 2.9, wo es unter anderem um die Realisierung einer Formensprache all’antica mit den im 15. Jahrhundert zur Verfügung stehenden
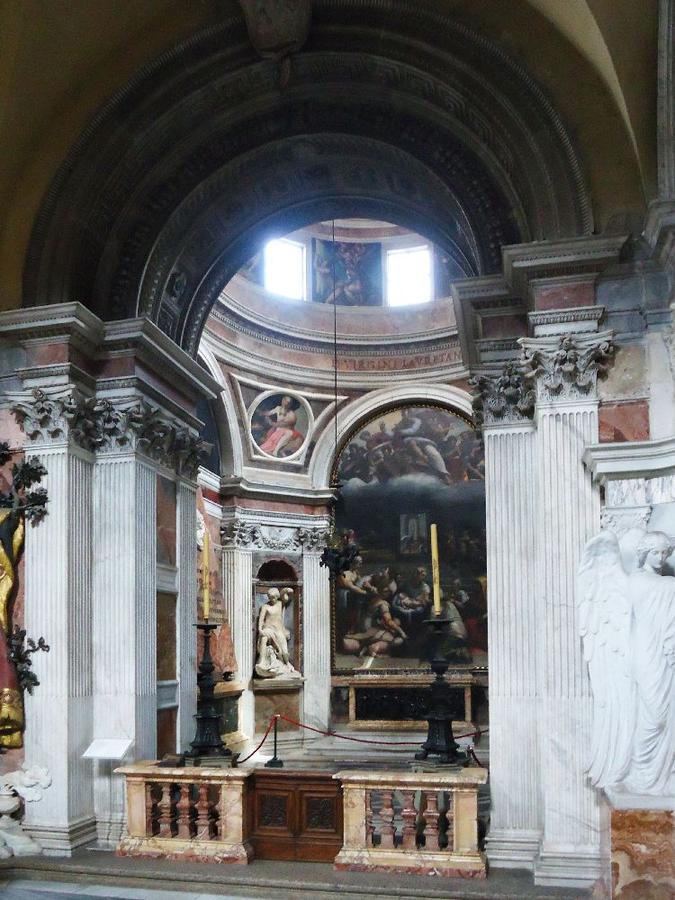
Abb. 2.8:
Filippo
Ein Beispiel für einen anders gearteten Umgang mit der Antike ist der Bau bzw. der grundlegende Umbau des Palazzo del Podestà in
Wie ging der bereits zitierte
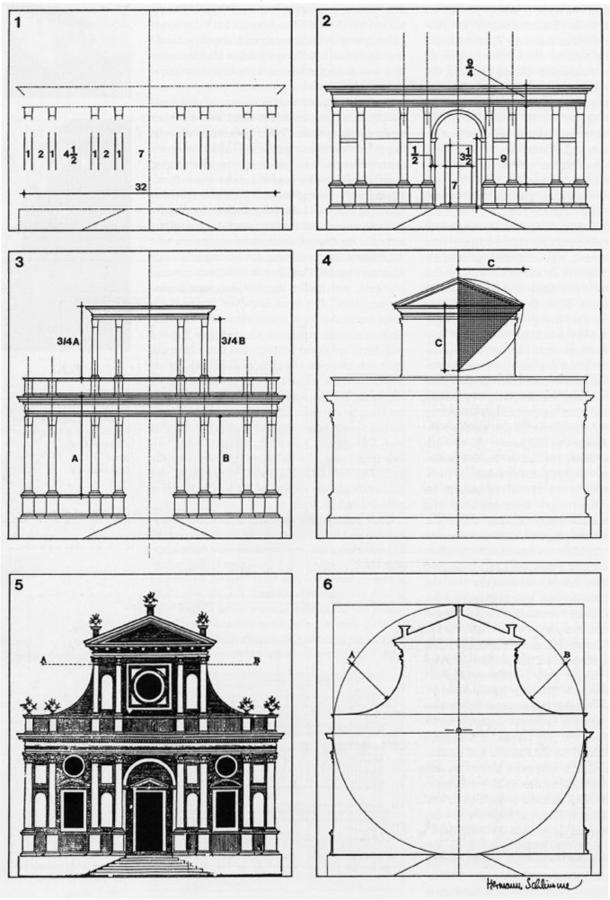
Abb. 2.9: Sebastiano
Mit der Villa wurde ein Bautypus aus der Architektur der römischen Antike übernommen, der im traditionellen Bauwesen am Anfang der Frühen Neuzeit nicht vorhanden war. Ein Beispiel ist
Lassen sich aus den qualitätvollen Entwürfen eines
…certi architetti prattichi intorno alle fabbriche solamente per via di materia e discorso di fare, senza alcuna invenzion loro, di quali ne è piena tuttal’Italia, mercè [sic] di Sebastiano Serlio, che veramente ha fatto piú mazzacani architetti, che non aveva egli peli in barba.169
Man kann es auch positiv formulieren: Dank der Architekturtraktate war der Architektur-Entwurf lehrbar geworden. Entscheidend in diesem Zusammenhang sind die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegründeten Akademien in
2.4.3 Die Accademia del Disegno
Die Accademia del Disegno wurde im Jahre 1563 unter Federführung von Giorgio
Wer wurde Architekt in der Renaissance? Die Architekten der Renaissance verstanden sich als Künstler des disegno. Diese Betonung des künstlerischen Anteils an der Arbeit des Architekten kann als Tendenz lange zurückverfolgt werden. Im Jahre 1334 war mit
Welches waren die Prinzipien der Ausbildung an der
An der Akademie wurden regelmäßige Mathematik-Vorlesungen organisiert.184 Mathematik galt als der Schlüssel, um die sichtbare Welt zu verstehen. Wer die mathematischen Grundlagen der Natur, d. h. Geometrie, Perspektive, Arithmetik und damit auch die der Natur innewohnenden Proportionssysteme begriffen hatte, konnte die Natur in Kunstwerken darstellen bzw. neue Kunst- und Bauwerke im Sinne der Naturregeln konzipieren. Von diesen mathematischen Wissenschaften oder auch Künsten gewinne die Malerei Perspektive und Symmetrie. „Symmetrie“ meint in der Malerei-Theorie ebenso wie in
Eine architekturspezifische (Entwurfs-)Lehre an der Accademia del Disegno ist über mehrere Quellen nachweisbar. Dazu gehören neben den Statuten v. a. Aussagen Gherardo
2.4.4 Die Querelle des Anciens et des Modernes
Für die ästhetischen Diskussionen der Aufklärung war die Frage des Geschmacks von besonderer Bedeutung, womit die Bedienung des Geschmacks (in
Die Erörterung des bon goût im Jahre 1672 führte angesichts der Bewusstheit des subjektiven Charakters von Geschmack zu der vorläufigen Einigung, dass man als geschmackvoll bezeichne, was intelligenten Menschen gefalle.197 Die Bindung des Geschmacks an die Urteilsfähigkeit bestimmter Personenkreise sollte verhindern, dass die Bildung ästhetischer Kriterien, mit Hilfe derer man ja die angestrebte Normativität herzustellen gedachte, insgesamt in Frage gestellt würde.198 François
Das Verständnis von Proportion als arbiträrer Größe resultierte wesentlich aus der damals empirisch neu gewonnenen Einsicht, dass sich die Existenz einheitlicher und dadurch verbindlicher Säulenproportionen als Kriterium objektiver Schönheit bei dem Vergleich antiker Werke und dem Studium von
Noch vor der Gründung der
Einen wichtigen Beitrag zu der in
2.4.5 Die Accademia di San Luca
Die personelle Struktur der Akademie sah an höchster Stelle das Amt des principe vor, der jährlich gewählt und von zwei rettori und vier consiglieri assistierend unterstützt wurde. Die vier beratenden Ämter der consiglieri hatten durch zwei Maler, einen Bildhauer und einen Architekten besetzt zu werden. Die Akademie war mit der Zielsetzung gegründet worden, die im Verfall begriffenen Künste über die Etablierung eines höheren Standards der Künstlerausbildung zu erneuern. Die Aufgabe der gewählten accademici bestand folglich darin, den Studenten in ihrer jeweiligen Kunstgattung Unterricht zu erteilen, der an jedem Sonn- und Feiertag nach der Messe stattfand. In den Statuten von 1617, 1675 und 1715/16 findet sich wiederholt der nicht erwiesenermaßen auch umgesetzte Vorschlag, den Unterricht täglich abzuhalten, wie dies an der 1666 gegründeten Accademia di
Gemäß Federico
Der Pontifikatswechsel im Jahr 1700 – neuer Papst wurde
Der akademische Diskurs der ersten Settecentohälfte wurde vor allem von der Auseinandersetzung über eine Neubewertung der Architektur als überlegener Kunstgattung bestimmt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es im Verlauf des letzten Viertels des 17. Jahrhunderts in
Über die Architekten, die das Amt des principe bekleideten, blieb die Tradition des späten barocken Klassizismus über die Jahrhundertmitte hinaus auch in der Accademia di San Luca tonangebend.236 Die in der akademischen Lehre für lange Zeit vorherrschende Tendenz übertrug sich allerdings nicht in dem zu erwartenden Maß auf die Entwurfsarbeit der Studenten. Innerhalb der Entwurfspraxis griffen diese gerne auf Inspirationsquellen zurück, die auch außerhalb der Akademielehre gesucht und gefunden wurden. Als eine solche sind insbesondere die architektonischen
Neben den akademischen Stil nach Prägung
Aus einem Generalinventar der beweglichen Besitztümer der Akademie von 1756 geht hervor, dass sich auch die Situation der didaktischen Hilfsmittel, die den Studenten als Anschauungs- und Lernmaterial zur Verfügung standen, damals verändert hatte. Anstelle der klassischen Texte von
Die Abkommen von 1676 in Bezug auf den Zusammenschluss der Accademia di San Luca mit der zehn Jahre zuvor gegründeten Accademia di
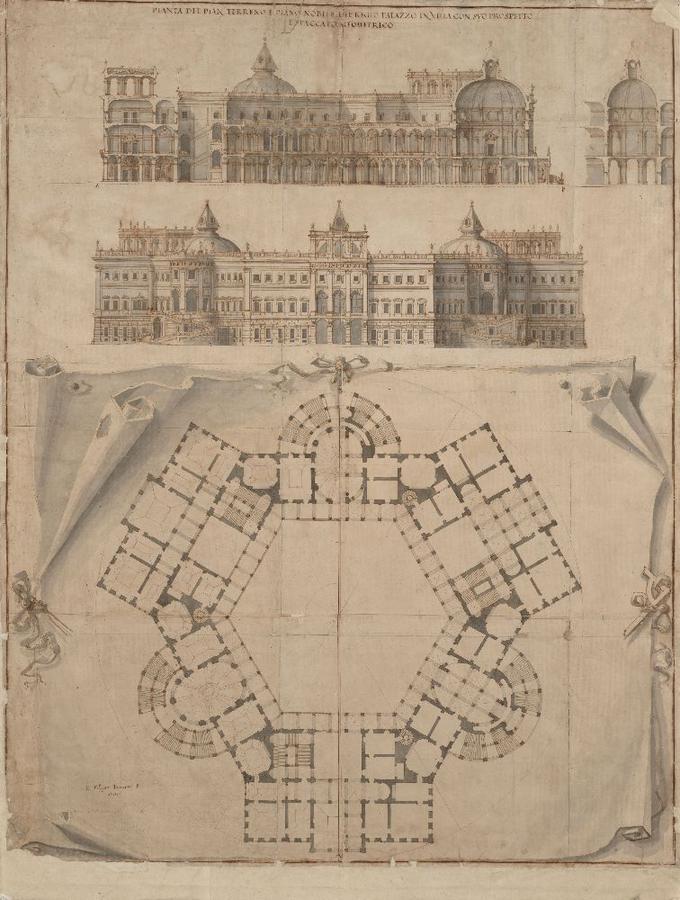
Abb. 2.10: Filippo
In unregelmäßigen Zeitabständen veranstaltete Wettbewerbe gehörten sehr wahrscheinlich schon von Beginn an zum akademischen Leben der Accademia di San Luca. Wettbewerbe bzw. die Vergabe von Preisen würden in
Bezüglich des Umgangs mit formalen Elementen vertrat
Die herrschende Konkurrenzsituation um Aufträge und Stellen war Grund für das z. T. ausgeprägt eifersüchtige Verhalten unter den Architekten, das James
2.5 Planung und Wissen um Umweltbedingungen
Auch regionale und lokale umwelttechnische Besonderheiten beeinflussen das Bauwesen. Überschwemmungen und Sumpfbildung waren entlang der Flüsse Po, Arno und Tiber drängende Probleme, deren Lösung in der Frühen Neuzeit erhebliche Bedeutung beigemessen wurde. Über ökonomische Interessen wie Landgewinnung und Fischfang hinaus ging es auch um gesundheitliche Aspekte, etwa den Schutz vor Malaria. In der
Die schlechte Belastbarkeit des Baugrunds in
2.5.1 Wissen über den Bau in Erdbebengebieten am Beispiel von Sizilien und Kalabrien im 17. und 18. Jahrhundert
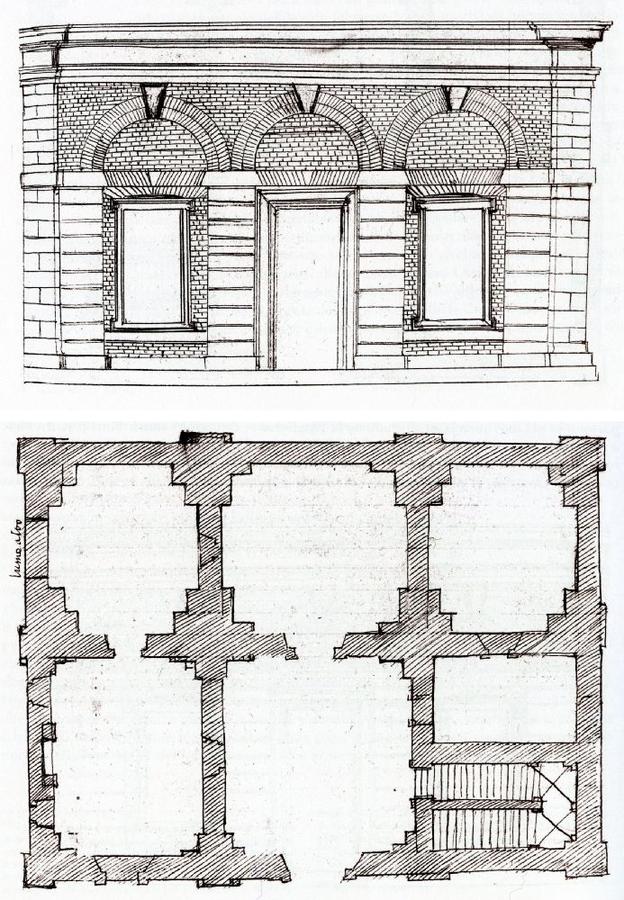
Abb. 2.11: Pirro
Als erste profunde Quelle der Frühen Neuzeit, die eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Möglichkeiten antiseismischer Architektur verrät, gelten noch immer Pirro
Die Erkennung einer wichtigen kausalen Beziehung im Kontext von Erdbeben und Bauwesen reicht mindestens bis in die letzte Seicentodekade zurück, und zwar war den Menschen in der Folge des Erdbebens in
Bei diesem Erdbeben handelte es sich um eine ca. zwei Jahre andauernde Periode wiederholter seismischer Aktivitäten, die am 9. Januar 1693 mit einem ersten Erdstoß der Stärke VIII (MCS) einsetzte. Das zwei Tage darauf erfolgte Hauptbeben war verantwortlich für eine der größten Katastrophen in
Von nicht unerheblichem Einfluss auf die Wiederaufbauqualität nach Erdbeben waren in der Vergangenheit die von der jeweiligen Regierung ergriffenen verwaltungs- und finanzpolitischen Maßnahmen. Die am weitesten verbreitete und älteste Strategie bestand in einer zeitlich beschränkten Steuererleichterung, die je nach Ausmaß der Schäden eine Steuerbefreiung von einem bis zu zehn Jahren mit sich brachte. Seit dem 13. Jahrhundert im Königreich
Die spanische vizekönigliche Regierung reagierte auf das Erdbeben von 1693 mit der Entsendung verschiedener Beamter, die die Schäden begutachten, Rettungsaktionen einleiten und den Wiederaufbau überwachen sollten.279 So wurde Giuseppe
Im Verlaufe des Settecento, nach den großen Beben von 1693 in
Nach dem Erdbeben von 1693 lassen sich in
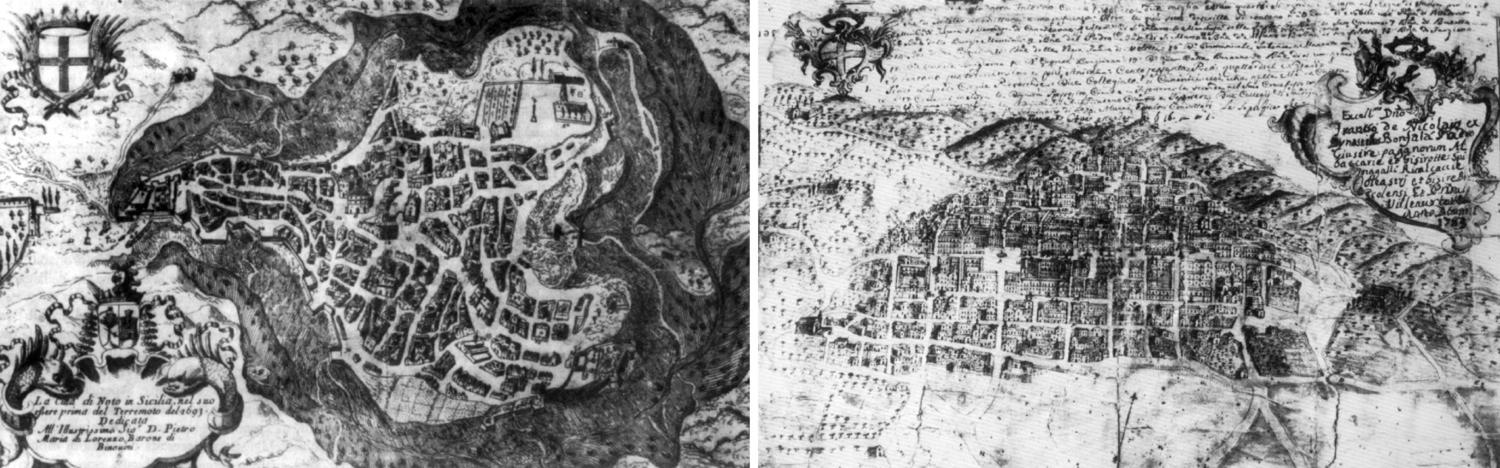
Abb. 2.12: Ansicht von Noto Antica (Stich nach einem verlorenen Original, Mitte 18. Jh.?, Aufbewahrungsort unbekannt; Foto: Atti e Memorie, Istituto per lo studio e la valorizzazione di Noto Antica, Noto, 1972, Anno III, cap. IX; aus: Tobriner 1989, p. 15 fig. 2); rechts: Vedute von
Bei den in situ mit modernisiertem Stadtplan wiedererrichteten Städten – z. B.
Der interessanten Fragestellung, inwieweit Erdbeben weniger Ursache als vielmehr Anlass für eine renovatio urbis, eine Rekonfiguration des städtischen Raums gegeben haben könnten, kann im Rahmen der hiesigen Darstellung nicht erschöpfend erörtert werden. Mehrfach finden sich Äußerungen, die die Beben als eine Art Katalysatoren oder Motoren einer Modernisierung der den veränderten Ansprüchen nicht mehr genügenden ostsizilianischen Architektur und städtischen Gestalt interpretieren.300 Durch die post-seismische Bauaktivität nach 1693 gelang es
Puglianos vergleichende Untersuchung der Bebenauswirkungen von 1726 und 1823 in
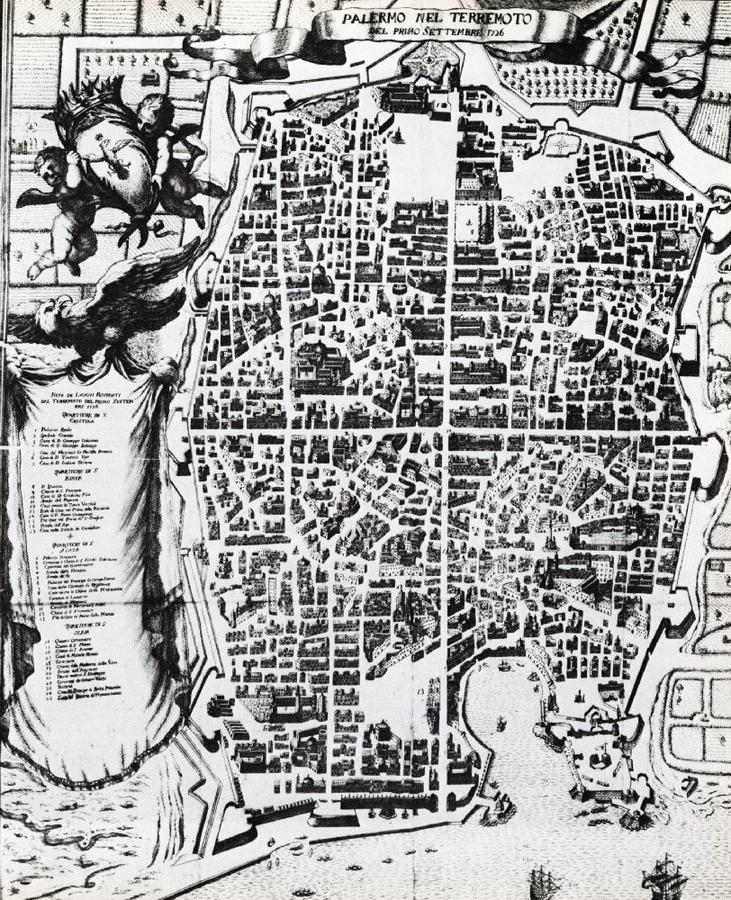
Abb. 2.13: Antonino
Die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Bodenbeschaffenheit und Gebäudestabilität spiegelt sich in der besonderen Aufmerksamkeit, die in der palermischen Traktatliteratur Fragen der Fundamentierung gewidmet ist. Tommaso Maria
Beim Wiederaufbau von
Giovanni Biagio
Der Architetto Prattico lässt
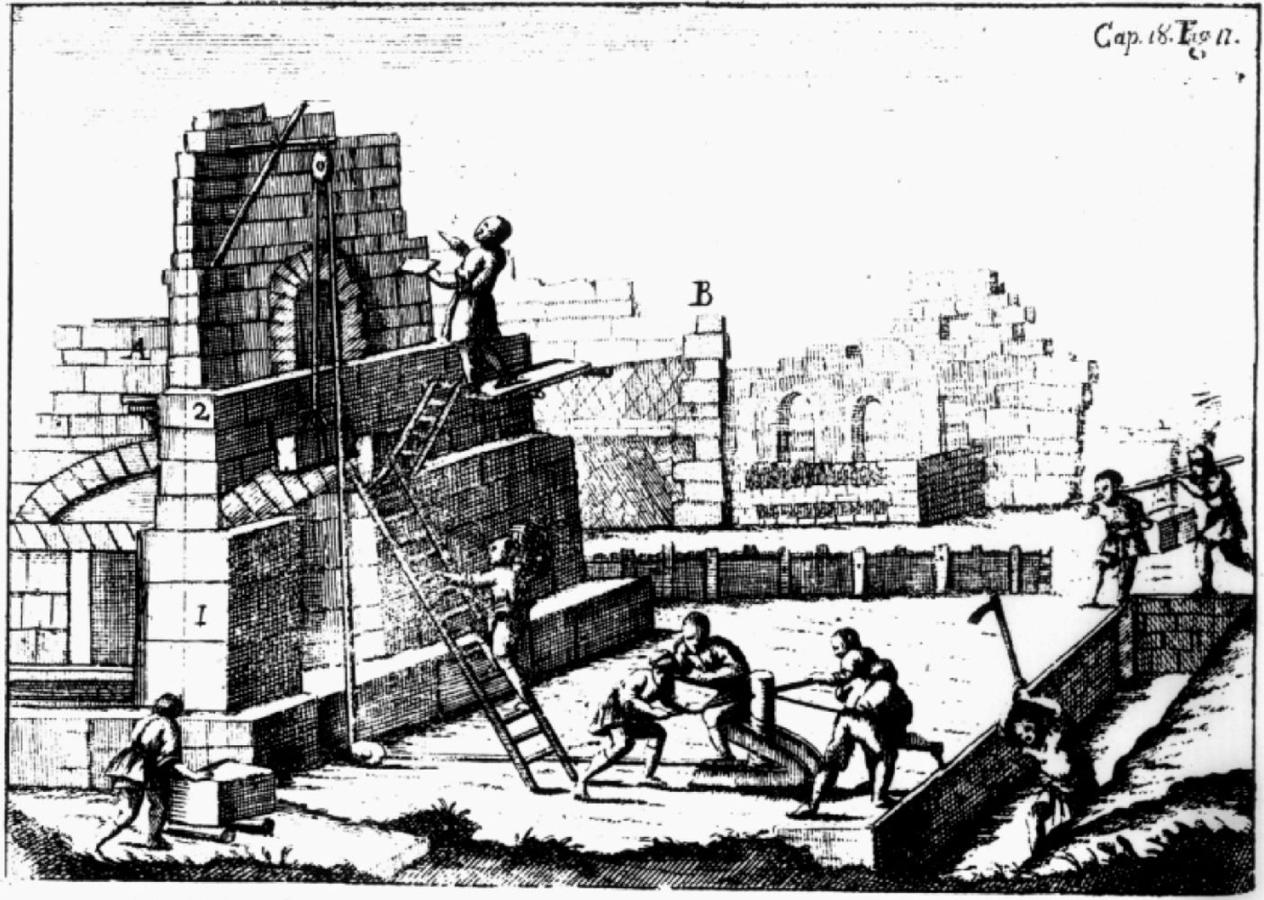
Abb. 2.14: Giovanni Biagio
Aus der von Pugliano konsultierten Traktatliteratur spricht nach dessen Aussage die Überzeugung der Verfasser, dass eine korrekte Anwendung der regola d’arte alle konstruktiven Probleme in Hinsicht auf mögliche Naturphänomene löste, weswegen sich weniger direkte als implizite Hinweise auf Erdbebenproblematiken finden ließen.322 Eine nach den Regeln der Kunst, d. h. eine entsprechend der theoretischen Vorgaben errichtete Mauer z. B. bedürfe keiner Hilfsmittel um standzuhalten; folgerichtig wird auch der Gebrauch eiserner Anker zur Unterstützung einsturzgefährdeter Wände von
Eine der Anleitungen
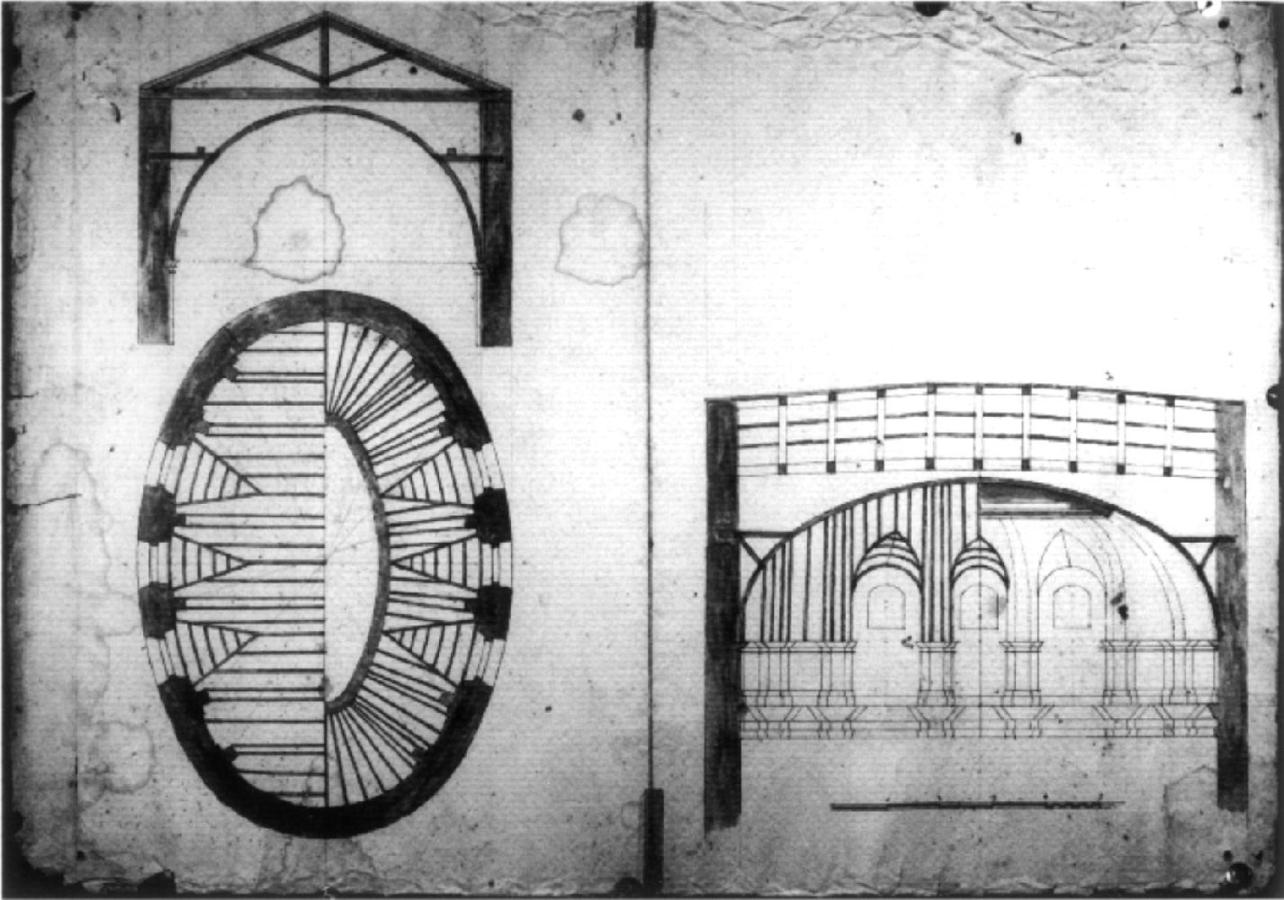
Abb. 2.15: Dachkonstruktion der Klosterkirche S. Chiara. Biblioteca Comunale di

Abb. 2.16: S. Chiara in
In den Kontext der beim Wiederaufbau von
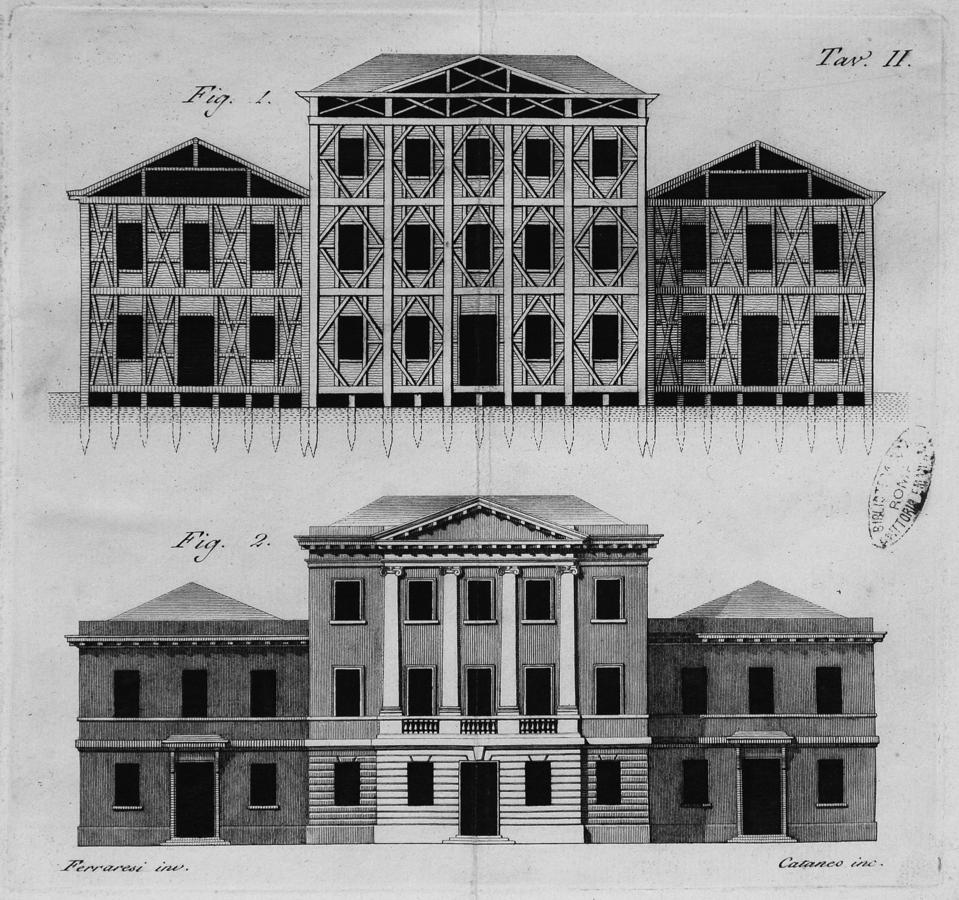
Abb. 2.17: Vincenzo

Abb. 2.18: Innenwand eines im Abbruch begriffenen Hauses am Corso
Eine andere, in der römischen Antike bereits bekannte336 und in ihren neuzeitlichen Anfängen bis in das 17. Jahrhundert zurückzuverfolgende Form der Prävention bot eine dem deutschen Fachwerk recht ähnliche, sowohl auf
2.5.2 Bauen unter Berücksichtigung von Klimafaktoren
Eine Formulierung über die Anwendung geneigter Dachflächen zum Schutz vor eindringendem Regenwasser findet sich bereits bei
An
Überlegungen zu einem solcherart ,standortgerechten Bauen‘ lassen sich ebenfalls im Traktat von Francesco di Giorgio
In den Quattro libri dell’architettura von Andrea
Sir Henry
„[…], the Italians are very precise in giving the Cover a gracefull pendence or slopenesse, dividing the whole breadth into Nine parts; whereof two shal serve for the elevation of the highest Toppe or Ridge, from the lowest. But in this point the quality of the Region is considerable: For (as ourVitruvius insinuateth) those Climes that feare the falling and lying of much Snow, ought to provide more inclining Pentices: and Comelinesse must yeeld to Necessity.“355
Auch Vincenzo
„[…] altro coperto ricerca un’edificio regio, ò sacro, ò secolare: & altro poi uno di mediocre qualità, & altro poi si dee usare dove l’aria è temperata, & anco differentemente nellaSpagna, e nella Francia, ò nella Germania, come qui in Italia, e finalmente in altri, e differenti paesi.“356
In Bezug auf
„E quanto all’altezza de’ coperti nellaGermania, & anco nella Francia, & altri paesi dove regnano grandissime nevi, e venti osservano di fare il piovere de’ loro coperti, e particolarmente de gl’edifici molto grandi in forma del triangolo d’uguali lati; acciò che le nevi non vi si fermino sopra, perche in Vienna, Città dell’Austria, & in Praga feggio della Boemia, e molte altre vi si fermano le nevi lunghissimo tempo; […]“358
Offenbar zuerkannte
„InGermania osservano più per una certa consuetudine, che per il bisogno di fare i Tetti delle loro case, e palazzi molto acuti, e ricoperti de tegoline, piane, e quadrelatere, ò fatte à scaglie de pesci, come si vede fino a’ confini della Lorena: […].“359
Eine Feststellung, die kurz darauf wieder klimatischen Argumentationen Platz macht, denn, so bemerkte
„Per quello, che noi habbiamo osservato inGermania, & in Francia fanno i loro tetti molto acuti gl’uni; perche nella Francia, tallhor vi regnano grandissimi Venti, i quali respingono le pioggie all’insù, e con tanto empito del Vento Circio, overo Maestro Tramontana, che egli lieva i tetti alle case,[…]. E nella Germania vi cadono poi molte, e frequenti nevi; le quali per la molta pendentia de’tetti non vi si possono fermare: la onde se essi fussero piani, ò cõ poca pendentia esse aggravarebbono, molto cõ pericolo delle fabriche.“361
Die in der Realität vorgefundene Unregelmäßigkeit bei der Verteilung unterschiedlich hoher Dächer auf einzelne Landstriche, die im Widerspruch zu einer alleinigen Abhängigkeit der Dachhöhe vom Klima stand, scheint
1673, nur zwei Jahre nach der Gründung der Académie Royale d’Architecture in
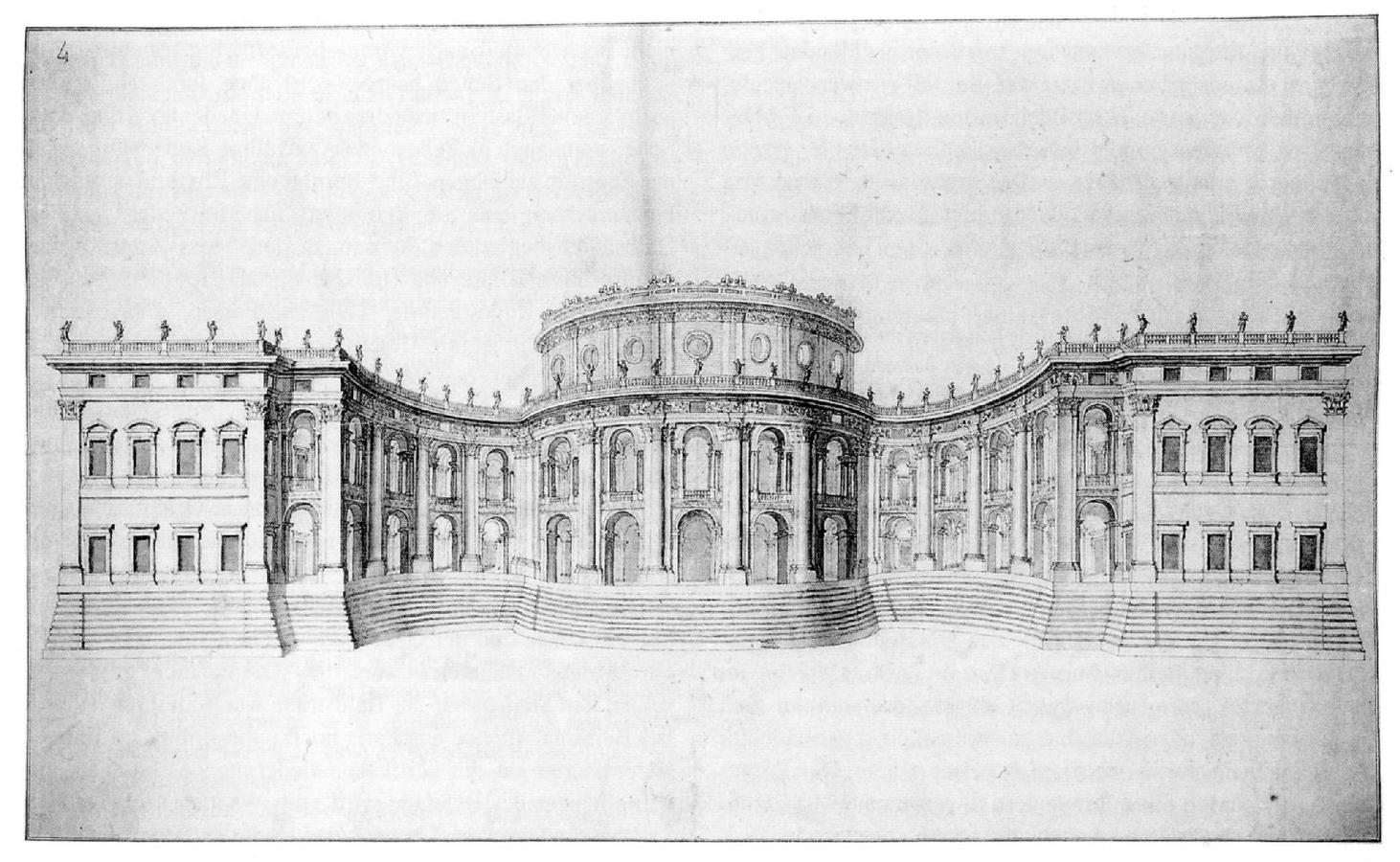
Abb. 2.19: Gian Lorenzo
In der Vergangenheit, vor allem seit dem 17. Jahrhundert, wurde verschiedentlich der Versuch unternommen, das flache bzw. nur mit geringem Neigungswinkel errichtete ,italienische Dach‘ auch in andere Klimaregionen zu übertragen. Ursprünglich rührte dieses Motiv vom mittelalterlichen Wehrbau her und war seit der Frührenaissance vermehrt für den privaten Palastbau in
Gian Lorenzo
Die Kritik von Jean-Baptiste
„[…] il est certain par une expérience universelle que la quantité de pluies et de neiges qui tombent àParis, pendant les hyvers, empesche qu’aucune terrasse, ni mesme les combles plats, y puissent subsister au plus vingt ou trente années.“366
Kälte, Feuchtigkeit sowie Regen- und Schneefülle führten dazu, dass die Appartements sieben bis acht Monate des Jahres geheizt werden müssten, so dass man in
Berninis Zeichnungen sollen den Abbé
„En voyant les couvertures du palais des Tuileries, il [Bernini] a dit que le défaut qu’il y a dans la hauteur de ces couvertures ne s’est pas sans doute introduit tout d’un coup, […]. […] on les [ces couvertures qui étaient basses dans un temps] élève un peu davantage, puis un peu plus, et enfin si excessivement qu’elles ont presqu’autant de hauteur que le reste du bâtiment, et cela sans que l’oeil s’aperçoive de l’horrible difformité.“369
Hier sind unterschwellig auch nationale Unterschiede berührt, die ein Bestehen nationalsprachlicher Architekturformen, wie sie in Bezug auf die unterschiedliche Dachgestaltung wohl erstmals in Sebastiano
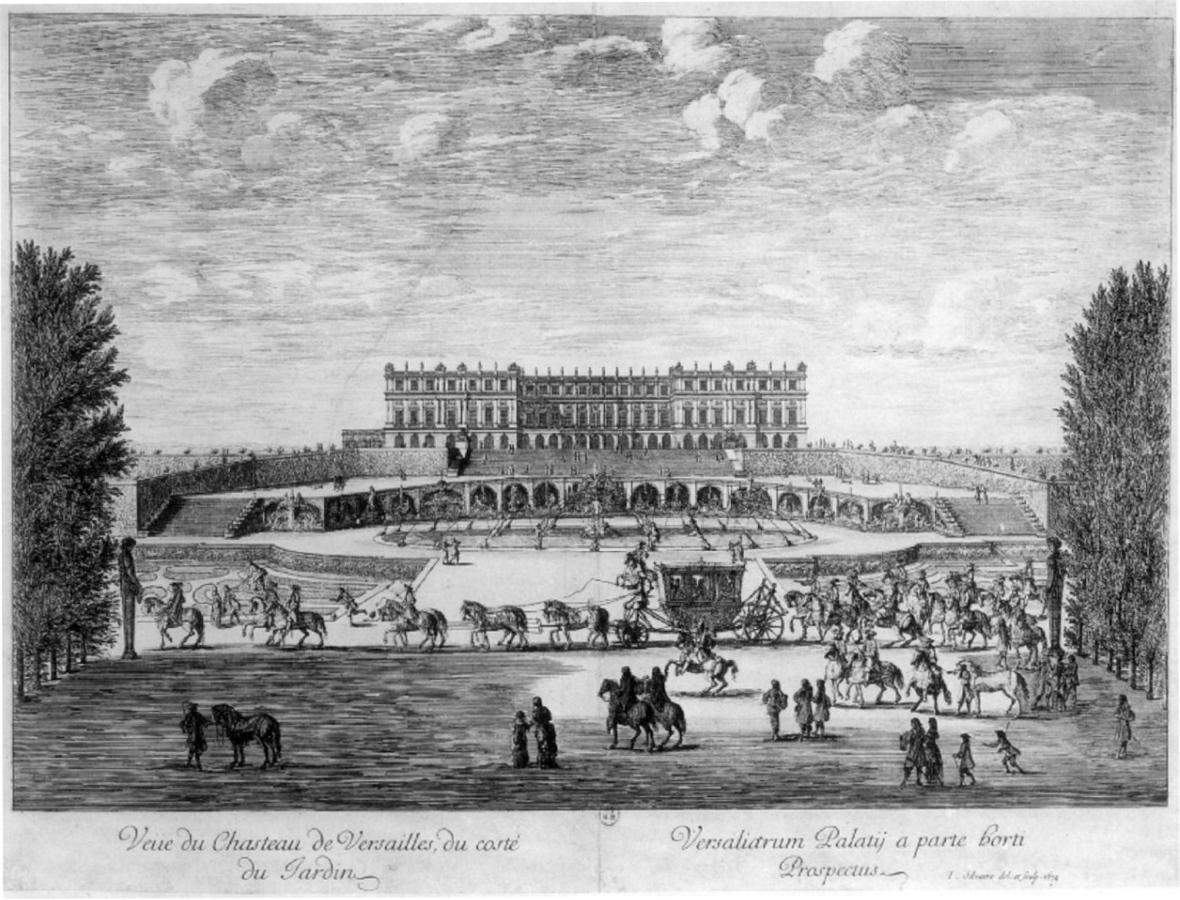
Abb. 2.20: Israël Silvestre, Ansicht des Schlosses in
Die im Zusammenhang mit dem Ausbau des bestehenden Jagdschlosses
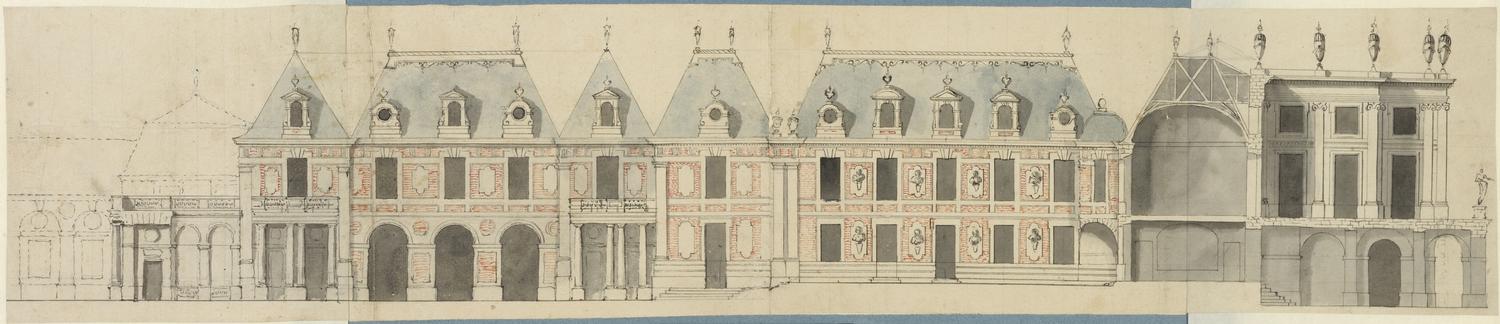
Abb. 2.21:
Ein weiteres Beispiel für ein Transferieren des italienischen Flachdachmodells in transalpine Gegenden bildet der von Johann Bernhard Fischer von
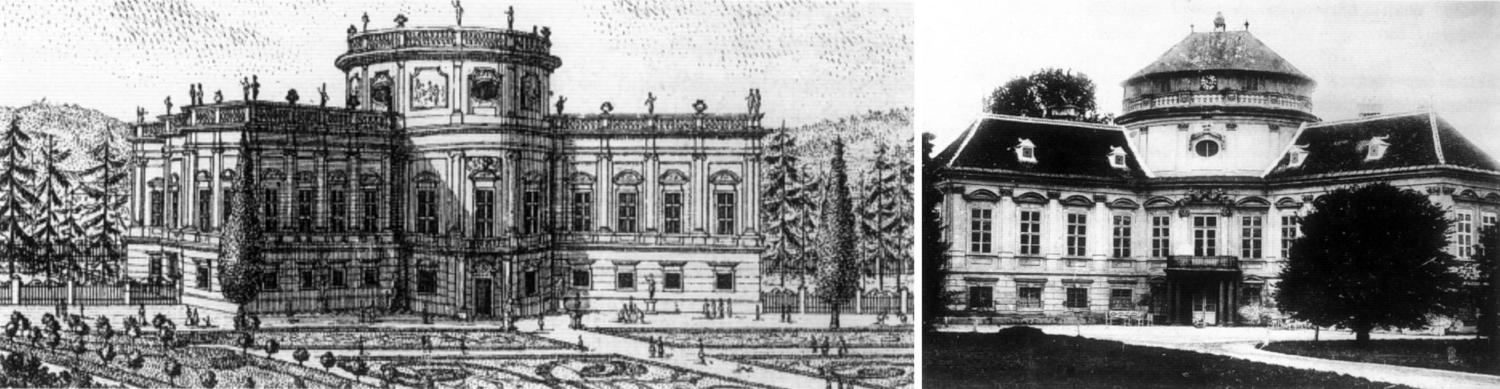
Abb. 2.22: Gartenpalais Althan,
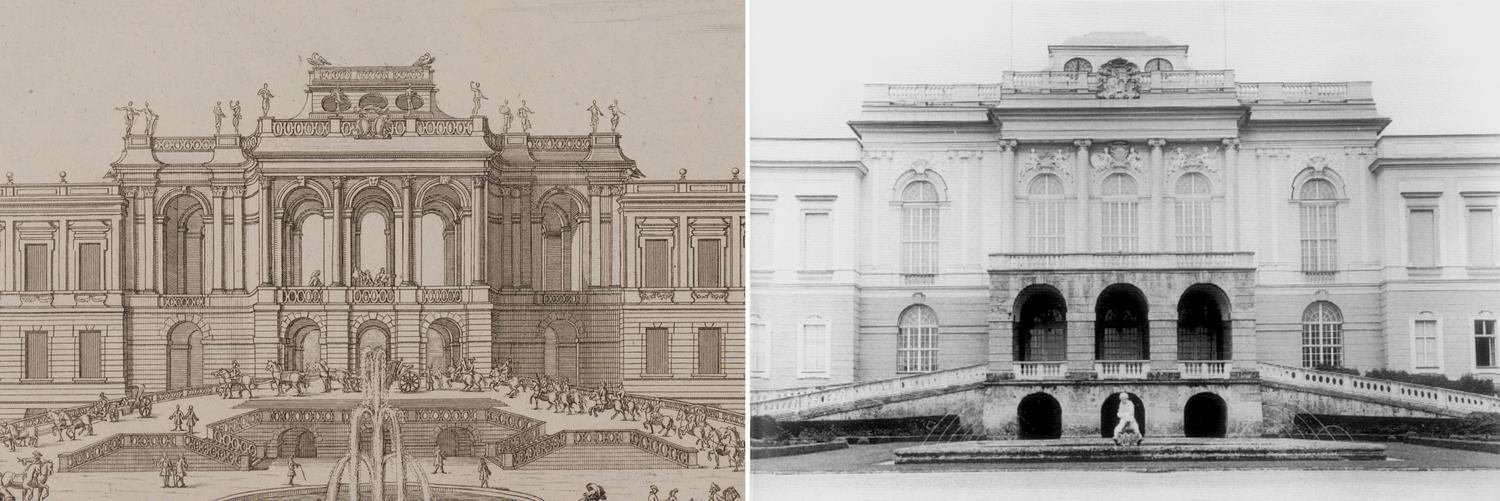
Abb. 2.23: Schloss Klesheim,
Anders als bei
2.6 Planungs- und Entwurfstechniken
2.6.1 Zeichnungen
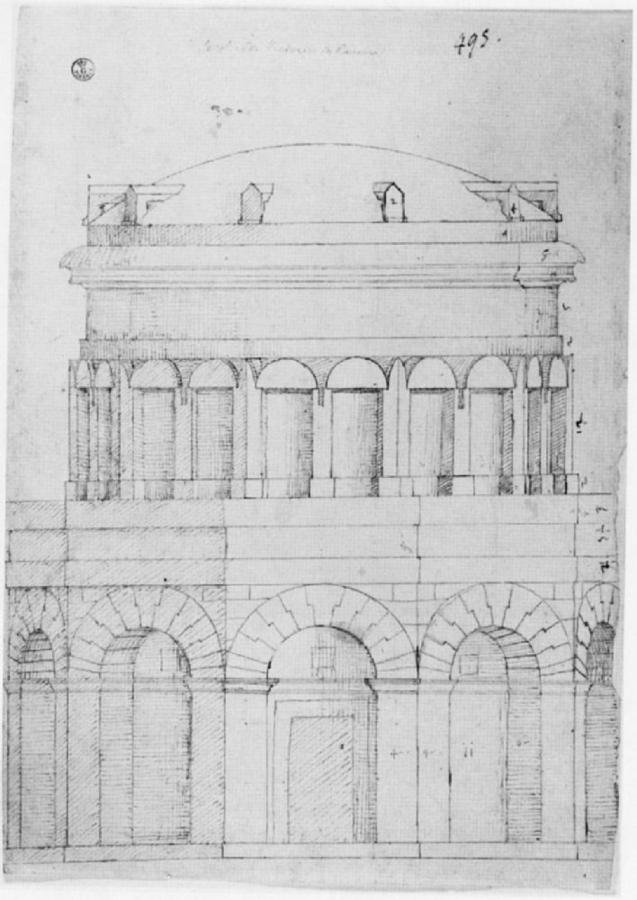
Abb. 2.24: Antonio da
Architekturrisse im Maßstab 1:1 oder in maßstäblicher Verkleinerung und Orthogonalprojektion gab es ausgehend vom deutschsprachigen Raum seit der Mitte des 13. Jahrhunderts.389 Auch in der italienischen Renaissance spielten Architekturzeichnungen für das Planen und Bauen eine große Rolle. Seit dem 15. Jahrhundert wurden Architekturzeichnungen auf Papier gemacht, das seit 1276 von der Manufaktur Fabriano hergestellt wurde. Noch im 18. Jahrhundert waren große Papierbögen sehr teuer. Aus den
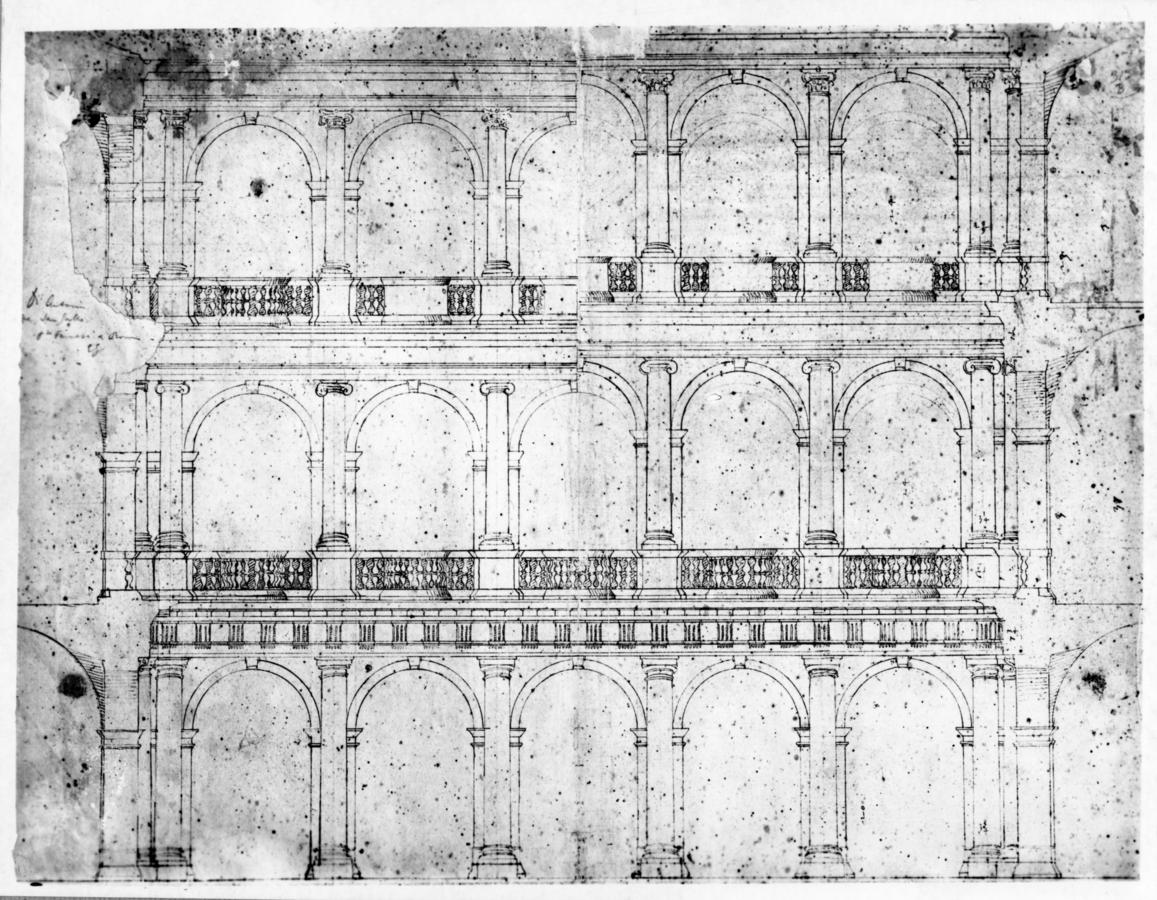
Abb. 2.25: Antonio da
Trotz der entscheidenden Bedeutung der Orthogonalprojektion für die Architektur behielt auch die perspektivische Darstellung für die Architekturzeichnung eine große Bedeutung. Hier wurde die Wissensbasis im 15. und 16. Jahrhundert erheblich ausgebaut.397 Als Wissenschaft vom Sehen war die Perspektive Teil der Artes Liberales. Das Wissen war aus der Antike (Optik von
Die Beherrschung der Perspektivkonstruktion, vor aber aber die Vervollkommnung der Orthogonalprojektion förderten die Entwicklung und Nutzungsbreite des Mediums Architekturzeichnung. Die Architekturzeichnung war zunächst entscheidend als Entwurfs- und Arbeitsmittel. In skizzenhafter, aber auch in mit Lineal gerissener Form wird der Entwurf auf dem Papier manifest, kann kritisiert, abgeändert und weiterentwickelt werden. Solche iterativen Prozesse können auf demselben Blatt bzw. auf chronologisch aufeinanderfolgenden Blättern stattfinden, für die es seit dem 15., aber vor allem seit dem 16. Jahrhundert zahllose Beispiele gibt, etwa im Rahmen der Planungen für St. Peter durch
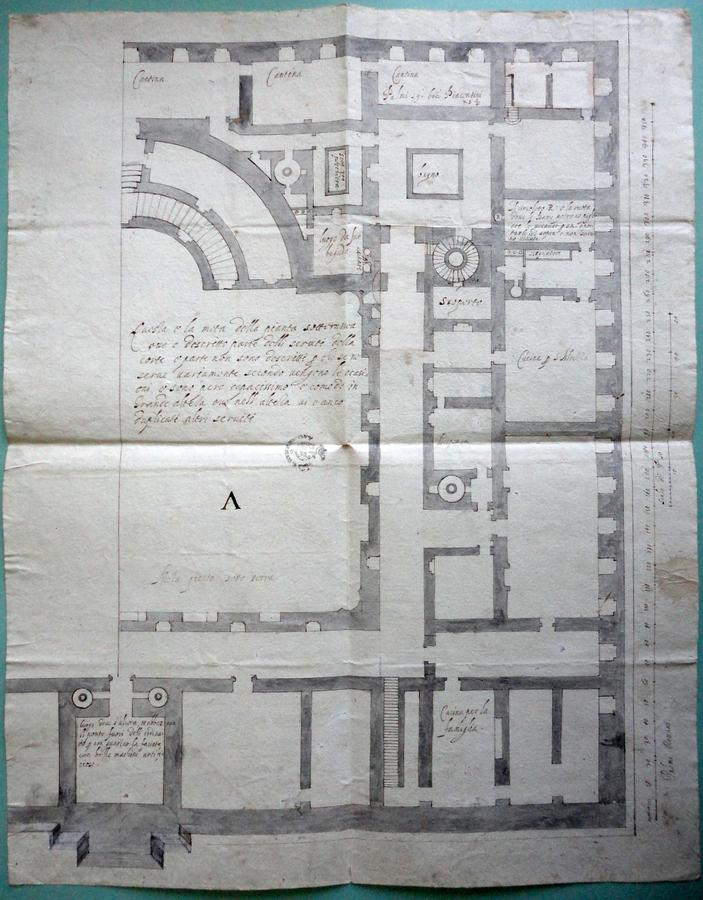
Abb. 2.26: Giacinto Barozzi da
Die Architekturzeichnung spielte zudem eine erhebliche Rolle als Bauplan, d. h. als Medium, um den Entwurf auf die Baustelle und an die Bauhandwerker zu kommunizieren. Im 15. und frühen 16. Jahrhundert war ein Durchplanen der Bauten vor ihrer Ausführung noch nicht üblich. Das beginnt mit Antonio da  cm große Zeichnung zu kopieren. Welche Informationen enthielten die Baupläne? Sie enthielten Lage und Dicke der Wandzüge, Lage und Breite der Tür- und Fensteröffnungen mit entsprechenden Maßangaben, einen Maßstab und waren so genau gezeichnet, dass man Maße zweifelsfrei auf ganze und halbe palmi mit dem Stechzirkel herausgreifen konnte. Gezeichnete wie geschriebene Maße sind nicht kleiner als
cm große Zeichnung zu kopieren. Welche Informationen enthielten die Baupläne? Sie enthielten Lage und Dicke der Wandzüge, Lage und Breite der Tür- und Fensteröffnungen mit entsprechenden Maßangaben, einen Maßstab und waren so genau gezeichnet, dass man Maße zweifelsfrei auf ganze und halbe palmi mit dem Stechzirkel herausgreifen konnte. Gezeichnete wie geschriebene Maße sind nicht kleiner als
 Palmo (bzw.
Palmo (bzw.
 Palmo im Fall von Säulenordnungen) gestückelt. Der Maßstab der Zeichnungen, die den gesamten Palast zeigen, beträgt
Palmo im Fall von Säulenordnungen) gestückelt. Der Maßstab der Zeichnungen, die den gesamten Palast zeigen, beträgt
 , für die Säulenordnungsdetails wurde
, für die Säulenordnungsdetails wurde
 gewählt. Konstruktive Details wie Mauerwerksverbände oder wie eine Fensteröffnung im Rohbau auszubilden ist, um anschließend eine Werksteinaedikula anbringen zu können, wurden nicht dargestellt. Diese Entscheidungen wurden den
gewählt. Konstruktive Details wie Mauerwerksverbände oder wie eine Fensteröffnung im Rohbau auszubilden ist, um anschließend eine Werksteinaedikula anbringen zu können, wurden nicht dargestellt. Diese Entscheidungen wurden den  für kleine Gebäude bis
für kleine Gebäude bis
 für die Grundrisse großer Bauten und Lagepläne. Die wie zufällig wirkenden Maßstäbe sind ein Phänomen, das bis ins 18. Jahrhundert anhält und mit dem Wunsch erklärt werden kann, ein Blatt möglichst gut auszunutzen.407
für die Grundrisse großer Bauten und Lagepläne. Die wie zufällig wirkenden Maßstäbe sind ein Phänomen, das bis ins 18. Jahrhundert anhält und mit dem Wunsch erklärt werden kann, ein Blatt möglichst gut auszunutzen.407
Die Architekten des 15. und 16. Jahrhunderts hatten die Angewohnheit, mit der Maßeinheit der eigenen Heimatstadt bzw. Wahlheimat zu arbeiten.408 So arbeitete  Palmi oder 1
Palmi oder 1
 Braccia beträgt. Hier vereinfacht Vignola ganz offenbar die Maße im Hinblick auf die Baustelle. Nach Traktat-Proportionen für das Theaterwandmotiv wäre eine Pfeilervorlage 6
Braccia beträgt. Hier vereinfacht Vignola ganz offenbar die Maße im Hinblick auf die Baustelle. Nach Traktat-Proportionen für das Theaterwandmotiv wäre eine Pfeilervorlage 6
 Oncie breit gewesen. Derart feinteilig gestückelte Maße kommen aber in den Zeichnungen nicht vor.410
Oncie breit gewesen. Derart feinteilig gestückelte Maße kommen aber in den Zeichnungen nicht vor.410
Neben der zeichnerischen, maßstäblichen Verkleinerung ganzer Bauten oder Teilen davon, wurden den Bauleuten auch Detailzeichnungen von Profilen im Maßstab
 gegeben. Vielfach haben solche Profilzeichnungen nicht überlebt, viele sind in ausgeschnittener Form als Positiv erhalten, was darauf schließen lassen könnte, dass das Negativ zum Herstellen der aus einem Holzbrett geschnittenen und mit Metall beschlagenen Profilschablone verbraucht wurde.411 Wie diese dann wiederum zum Herstellen der Werksteinprofilierungen genutzt wurden, wird im Abschnitt 2.9 beschrieben. Cooper trägt eine Reihe erhaltener Profilzeichnungen von
gegeben. Vielfach haben solche Profilzeichnungen nicht überlebt, viele sind in ausgeschnittener Form als Positiv erhalten, was darauf schließen lassen könnte, dass das Negativ zum Herstellen der aus einem Holzbrett geschnittenen und mit Metall beschlagenen Profilschablone verbraucht wurde.411 Wie diese dann wiederum zum Herstellen der Werksteinprofilierungen genutzt wurden, wird im Abschnitt 2.9 beschrieben. Cooper trägt eine Reihe erhaltener Profilzeichnungen von
Dank der präzisen Zeichentechnik und der Eindeutigkeit einer Orthogonalprojektion waren Zeichnungen regelmäßig Vertragsbestandteil, wie im Fall der nach Plänen
2.6.2 Modelle
Lepik hat die Architekturmodelle der Frührenaissance in  ), wobei es sich jeweils um Ziegelsteinkonstruktionen handelte. Für den Mailänder Dom ist um 1400 ein transportables Holzmodell nachweisbar, das erstmals die Bezeichnung modello erhielt. Modelle wurden aufgrund ihrer großen Überzeugungskraft genutzt, hatten aber nicht allein die Funktion eines Demonstrationsmediums, sondern wurden gleichrangig mit Zeichnungen als gültige Entwürfe verstanden. Stand ein detailliertes Holzmodell als Grundlage für die Bauausführung zur Verfügung, war eine ständige Anwesenheit des entwerfenden Architekten auf der Baustelle entbehrlich. So war
), wobei es sich jeweils um Ziegelsteinkonstruktionen handelte. Für den Mailänder Dom ist um 1400 ein transportables Holzmodell nachweisbar, das erstmals die Bezeichnung modello erhielt. Modelle wurden aufgrund ihrer großen Überzeugungskraft genutzt, hatten aber nicht allein die Funktion eines Demonstrationsmediums, sondern wurden gleichrangig mit Zeichnungen als gültige Entwürfe verstanden. Stand ein detailliertes Holzmodell als Grundlage für die Bauausführung zur Verfügung, war eine ständige Anwesenheit des entwerfenden Architekten auf der Baustelle entbehrlich. So war

 . Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).
. Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).Abb. 2.27: Holzmodell des St. Peter-Entwurfes von Antonio da  . Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).
. Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).

Abb. 2.28: Filippo
Städtische und kirchliche Großprojekte wurden vielfach von Wettbewerben begleitet, so zum Beispiel die zum Teil bereits benannten Dome in
Der Nachfolger
Die zunehmende räumliche Komplexität der Architekturentwürfe im 17. und 18. Jahrhundert, die sich über Grundriss, Aufriss und Schnitt kaum mehr darstellen lässt, weist dem Modell eine weitere, entscheidende Rolle zu. Nur im Dreidimensionalen des Modells werden die entwerferischen Ziele der Architekten deutlich, so etwa das Spiel mit den Blickachsen und den Veduten oder die Licht-, Raum- und Farbwirkung. Eine starke Detaillierung der Modelle und ihre farbige Fassung sind für diese Zwecke unabdingbar. Mit aufgeklebten Aquarellen wurden Fresken farbig simuliert. Vergoldungen, Stuck und sogar Skulpturen sind regelmäßig Teil der Modelle im 18. Jahrhundert. Beispiele sind die Modelle für die Sakristei von St. Peter (1715) von Filippo
Eine wichtige Rolle spielten die Modelle im Zusammenhang mit den Architekturwettbewerben, beginnend mit dem nie wirklich ausgeschriebenen Wettbewerb für den dem Heiligen Ignatius von
2.6.3 Zum Problem der Planungstiefe in der Renaissance
Wie umfassend die Architekten der Renaissance ihre Projekte in der Praxis vor Baubeginn durchplanten, ist nur in den seltensten Fällen erkennbar. Das ist nicht zuletzt ein Überlieferungsproblem, bleibt doch nahezu immer ungewiss, wie viel des einst vorhandenen Entwurfsmaterials sich erhalten hat. Dennoch lassen das, was noch vorhanden ist, sowie die Schriftquellen in einigen Fällen durchaus Rückschlüsse auf die
Ähnlich scheint
Extreme Positionen enthüllt ein Blick auf die größte Baustelle der frühen Neuzeit, St. Peter. Vom ersten Architekten des Baues, Donato
Die angestrebte
Die konsequenteste Verwirklichung eines solchen Ansatzes stellte schließlich jenes Projekt für die Vollendung des Neubaus dar, das  angelegt, misst es gut 7,30 m in der Länge und knapp 4,70 m in der Höhe. Es ist begehbar und enthält zahlreiche Details bis hin zu den Kapitellen und Balustern an Kuppel, Türmen und Laternen; ursprünglich war es farbig gefasst und enthielt sogar weiße Wachsstatuetten in den zahllosen Nischen.442 Seine Kosten beliefen sich auf 5.500 Scudi – eine Summe, für die man wohl eine eigene kleine Kirche hätte errichten können.
angelegt, misst es gut 7,30 m in der Länge und knapp 4,70 m in der Höhe. Es ist begehbar und enthält zahlreiche Details bis hin zu den Kapitellen und Balustern an Kuppel, Türmen und Laternen; ursprünglich war es farbig gefasst und enthielt sogar weiße Wachsstatuetten in den zahllosen Nischen.442 Seine Kosten beliefen sich auf 5.500 Scudi – eine Summe, für die man wohl eine eigene kleine Kirche hätte errichten können.
Man hat diesem Modell wegen seiner Größe und seiner detaillierten Ausarbeitung eine Sonderstellung in seiner Gattung zuschreiben wollen443 – zu Unrecht. Denn zum einen hat es seine Vorläufer in jenen gemauerten, ebenfalls begehbaren Gesamtmodellen, die im späten 14. Jahrhundert zur Visualisierung der Ausführungsprojekte mittelitalienischer Großkirchen angelegt wurden.444 Zum anderen gibt es um 1500 mindestens einen Fall für ein großes, hölzernes Gesamtmodell, das in ganz ähnlicher Weise wie bei  – statt
– statt
 – sogar noch größer gewählt.
– sogar noch größer gewählt.
Worin
Unter
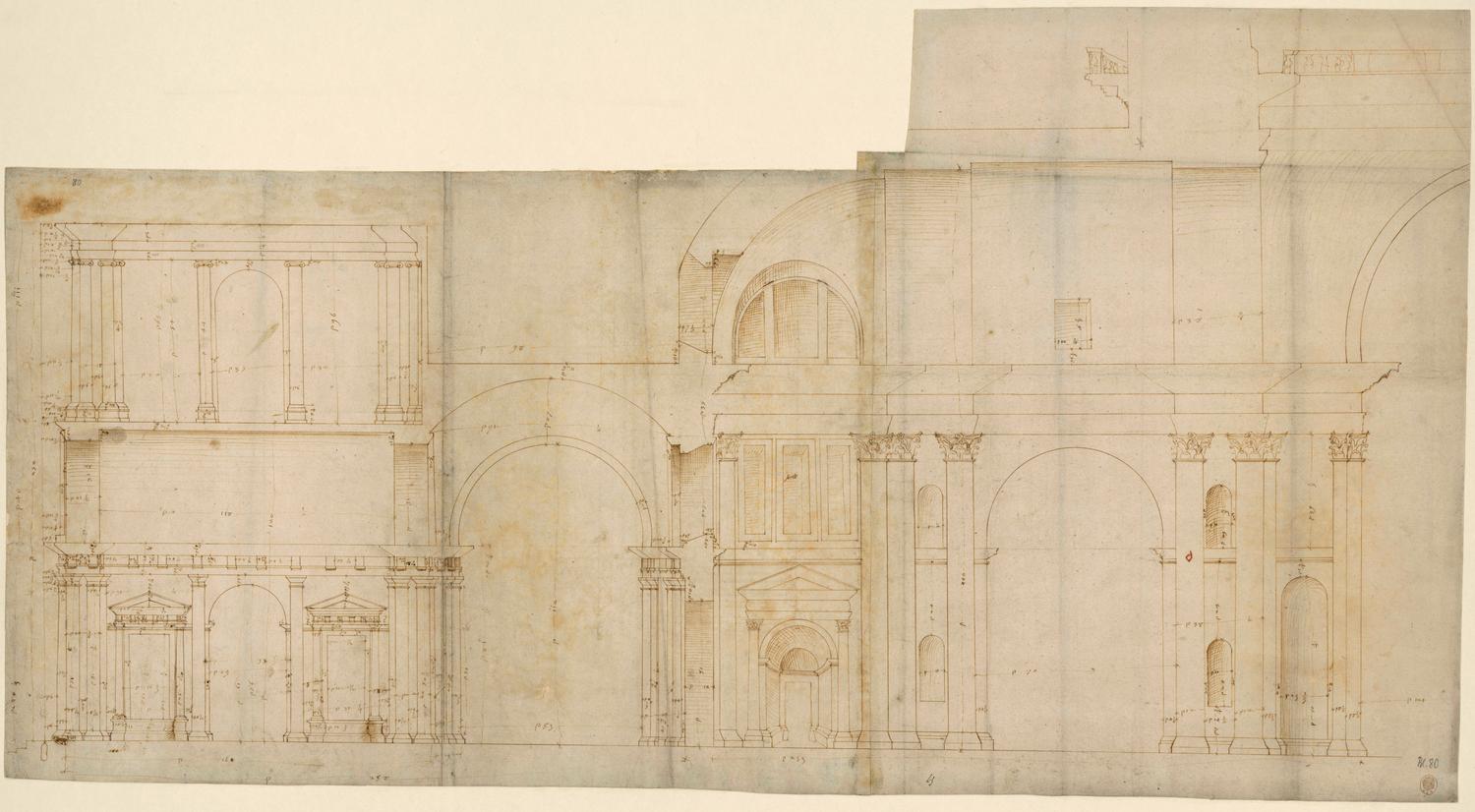
Abb. 2.29: Anonym (frankophoner Zeichner), Maßzeichnung nach dem Holzmodell des St. Peter-Entwurfes von Antonio da
brica eine entsprechende Festlegung für die Zeit nach dem Tod des Meisters für ratsam hielten; so entstand 1558 das in seinen Details überaus präzise große Holzmodell der Kuppel.457 Auch hier freilich fühlte sich
Dass für die Kuppel ein recht genaues Modell erarbeitet wurde, mag auch zusammenhängen mit einer im Vorjahr stattgefundenen Episode, die schlagendes Licht auf einen besonderen Aspekt der Problematik
Dass das Verständnisproblem hier so schwerwiegende Auswirkungen hatte, hängt freilich mit einem anderen Problem zusammen: dem der mangelnden Präsenz
2.6.4 Vom Territorium zum dekorativen Detail: Städtebaulicher Entwurf in der Frühen Neuzeit
In der Praxis begegnet man städtischen Planungen, die einen Rückgriff auf geometrisches Formenvokabular vermuten lassen, bereits am Ausgang des 13. Jahrhunderts: So liegt vielen der urbanistischen Schöpfungen Arnolfo di
Der Gedanke an eine plan- und realisierbare ‚ideale‘ Stadt scheint innerhalb der frühneuzeitlichen
Der erste, der in der Frühen Neuzeit die Thematik der Idealstadt nicht nur am Rande behandelte, sondern ausführlich beschrieb und auch abbildete, war Averlino,
Das erste Mal, dass solche Ideen innerhalb der Frühen Neuzeit Eingang in die Praxis gefunden haben, war mit der Umgestaltung des Dorfes
Das Aussehen von städtischen Anlagen oder Arealen, die über geometrischem Grundriss erdacht bzw. errichtet waren und die sich seit dem Cinquecento zunehmend auf dem europäischen Kontinent in Theorie und Praxis durchsetzten, entsprang aber nicht ausschließlich dem veränderten ästhetischen Bedürfnis und Schönheitsideal der Renaissancezeit, der Prävention extern verursachter Bauschäden oder dem Willen nach sozialer Veränderung, sondern verdankte sich im Gegenteil ebenso und in ganz entscheidendem Maße den militärischen Erfordernissen und neuen militärtechnischen Entwicklungen. Wiederholte Situationen der Bedrohung durch inneritalienische Konflikte oder die Raubüberfälle der Osmanen im östlichen Teil
Obgleich die gemischten Systeme der Übergangszeit nicht gänzlich verschwanden, entwickelte sich das Bastionärsystem unter dem Druck der historischen Ereignisse im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zum charakteristischsten Element der militärischen Verteidigung:479 Die Furcht vor einem drohenden Einfall der Türken in
Im Quattrocento waren die Geschichte und Entwicklung von Zivil- und Militärarchitektur noch aufs engste miteinander verbunden gewesen, und die Entwicklung der Verteidigungsstrukturen war gemeinsam mit jener im Bereich der Kunst vorangeschritten. Im Verlauf des Cinquecento ging die Beschäftigung mit dem Thema der Stadtbefestigungen dann jedoch vorwiegend in die Hand von Spezialisten über, und die neuen Technologien riefen eine Aufsplitterung der bis dahin in einer Person vereinigten Tätigkeiten des Architekten und Ingenieurs hervor.482 Dabei handelte es sich um einen Prozess, der nicht nur die allmähliche Trennung von Militär- und Zivilarchitektur in Gang setzte, sondern der auch die Gattung des reinen Festungsbautraktats entstehen ließ und sich bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu großen Teilen vollzogen haben würde.483 Die Traktate behandelten nun meist speziellere Gebiete, so widmeten sie sich beispielsweise ausschließlich den Säulenordnungen, der Mechanik, der Hydraulik, der ländlichen Architektur oder Feldmesskunst.484 Im Verlauf des 16. Jahrhunderts wurde die Militärarchitektur zu einer eigenen Disziplin und bildete nicht länger, wie dies seit
Die beschriebene Spezialisierung, d. h. die Verteilung des Wissens auf verschiedene Wissensträger, führte in logischer Konsequenz dazu, dass einige Traktatschreiber zu mehr Kollaboration unter den einzelnen Wissensträgern aufforderten und die Zusammenarbeit von Architekt und Ingenieur sich verstärkte.490 Lag vordem die Planungsintensität bei der Invention neuer Städte vornehmlich in der Größendimension der zu bearbeitenden Aufgabe (ganz gleich ob idealen oder realen Charakters), so war sie jetzt eher in der Tiefe begründet, mit der einige Theoretiker des Cinquecento, darunter auch
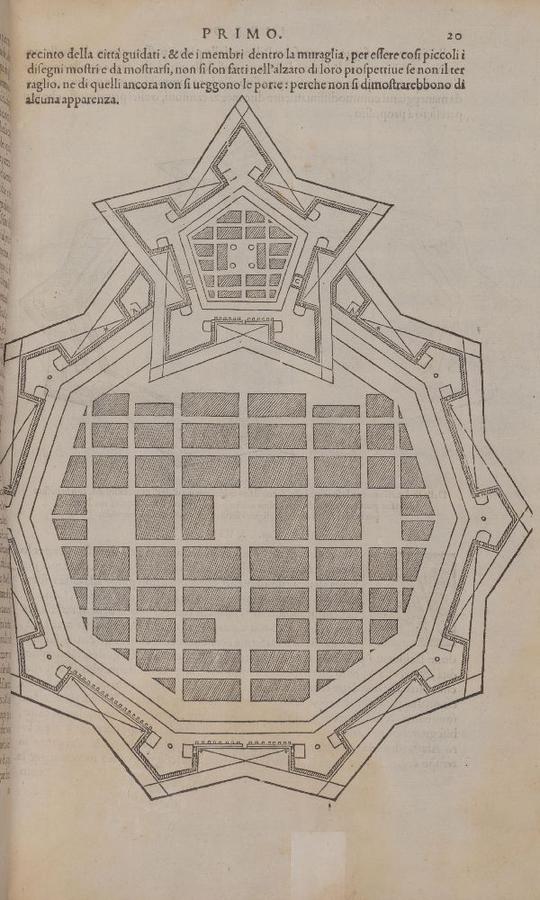
Abb. 2.30: Pietro
Es bleibt noch zu bemerken, dass in den militärischen Traktaten im allgemeinen darauf bestanden wurde, dass die Befestigungen von Städten und hiermit gleichzeitig ihre äußeren Formen in erster Linie den besten Verteidigungsmöglichkeiten und damit den Vorgaben der örtlichen Gegebenheiten und Topographie gehorchen sollten. Auf diesem Punkt insistierte neben
„[…] disegnare in carta e fare modelli, scrivere discorsi sopra delle fortificazioni è cosa necessaria, perché altrimenti non si può fare cosa buona alla mente se in carta o modello non si farà prima.“494
Zurück zu den formalen Aspekten frühneuzeitlicher Stadtplanung: Die Mehrzahl der italienischen Architekturtheoretiker der Renaissance bevorzugte für den Befestigungsring der von ihnen erdachten Idealstädte gemäß
Wie beschrieben war die Entwicklung, die sich innerhalb der architekturtheoretischen Traktate in Bezug auf die Planung der Ideal- und Planstadt vollzog, eng mit den Fortschritten der Militärtechnik verbunden. Daneben sollte aber nicht vergessen werden, dass die Einflüsse insgesamt zahlreicher Natur gewesen sind. Zu diesen gehörte auch das zeitgenössische Wissen über die Geschichte des Städtebaus und deren mediale Vermittlung in Form schriftlicher und bildlicher Zeugnisse.501 Zum allgemeinen Hintergrund einer erschöpfenden Betrachtung der Idealstadt zählen desgleichen die Legenden und Mythen, die sich um die ersten Stadtgründungen rankten, sowie das Wissen, das sich aus den in die Frühe Neuzeit überkommenen Vorbildern der Antike generiert hatte, wie z. B. die Kenntnis der 443 v. Chr. neu gegründeten Stadt
Die bildliche Rekonstruktion der Stadt geschah auf verschiedene Arten:503 zum einen mittels Chorographien, perspektivisch angelegten Veduten und Vogelperspektiven, wobei diese die architektonischen Formen und Strukturen des dargestellten Objekts oft genug verfremdeten, so dass die Einheimischen Schwierigkeiten hatten, ihre Städte darauf wiederzuerkennen. Solche städtischen atlanti oder teatri bildeten die Basis für die Vermittlung der im Sinne von Homogenität und Lesbarkeit ,idealisierten‘ oder auch ,möglichen‘ Stadtgestalt für die Nicht-Ansässigen, insbesondere die Ausländer. Veduten und die literarischen laudes waren ein Mittel, die Städte den ersten Touristen näherzubringen. Was ihnen fehlte, die detaillierte Darstellung von Stadtorganismus und Wegesystem sowie die exakte Wiedergabe der Größendimensionen und Distanzen (eben die der Konzeption unterliegenden geometrischen Formen), konnte nur von einem anderen, nicht perspektivisch, sondern orthogonal angelegten Darstellungssystem geleistet werden: dem Grundrissplan oder der Ichnographie. Eine verhältnismäßig große Anzahl davon entstand vor allem in
Darüber hinaus gab es plastische Darstellungen in Form dreidimensionaler Objekte oder Reliefs. Diese wurden seit der Renaissance für verschiedene Zwecke hergestellt, so z. B. als religiöse Opfergaben oder für politische Zeremonien. Auch hierbei aber standen militärische Gründe im Vordergrund. Bei den Flachreliefs und den architektonischen oder urbanistischen Modellen
Stichpublikationen, die antike und in geringerem Maße auch moderne Gebäude zeigen, traten im 16. Jahrhundert vor allem in
Eine andere Wissensquelle für den Ideentransfer mit besonderer Relevanz für die Vorstellungen von der Idealstadt bildete mit Sicherheit auch die Literaturgattung der Utopie, die für gewöhnlich auf
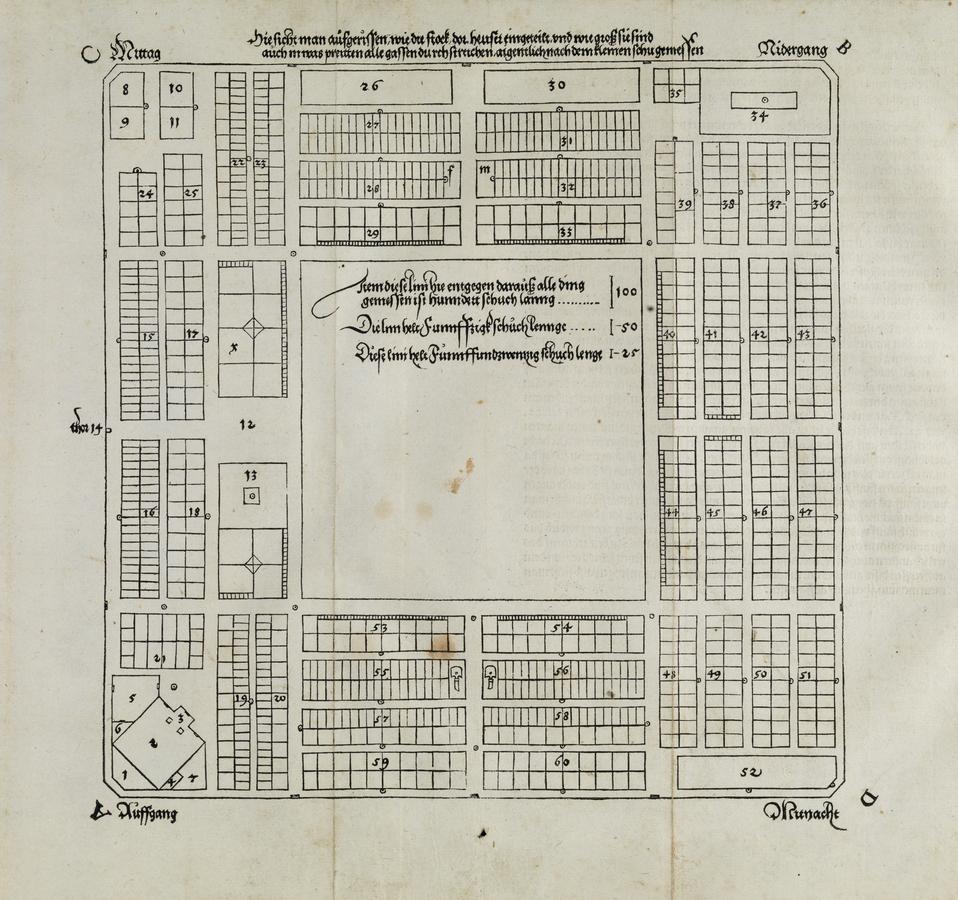
Abb. 2.31: Albrecht
Im Jahre 1515 konfrontierte der englische Humanist Thomas
Amaurotum, die von
Den allmählichen Übergang zur stärker hierarchisierten, der vielerorts veränderten Staatsführung geschuldeten Konzeption der barocken Stadt markieren auf dem Gebiet der politischen Utopie besonders sprechend Tommaso
Die Diskussion über die Idealstadt, die sich in der Renaissance nicht in einem fest definierten Konzept bewegte, ist letztlich nicht von jener über die Architektur und die Stadt zu trennen und innerhalb des gesamten kulturellen Komplexes zu betrachten.518 Blütezeit dieser Diskussion bildeten das italienische Quattro- und Cinquecento.519 Vor dem Hintergrund des Verständnisses von Staat und Stadt als sozialer Strukturen im Sinne des Allgemeinwohls, wird die Idealstadt in der Praxis nach Oechslin
„…una possibile concretizzazione delle riflessioni di base sul còmpito dell’architetto, quindi un caso eccezionale o esemplare di una trascrizione altrimenti vincolante in senso generale del suo ruolo all’interno della società.“520
Wie bereits
Die große Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die man in der Frühen Neuzeit mathematischen Motiven und Strukturen zollte und die sich auf oben dargestellte Art auch in der Städteplanung offenbarte, fand im Bereich der Philosophie beredten Ausdruck in den Schriften von René
Um einen Nexus zu finden zwischen einer internen und einer formalen Idealität der Stadt (letztlich also Inhalt und Form), wurde zur Begründung der Analogie zwischen geordneter Gesellschaftsstruktur der Stadt und der Perfektion geometrischer Formen oft auf die Staatstheorien von
2.6.5 Vom Territorium zum dekorativen Detail: Das Beispiel der Stadtbaugeschichte von Turin
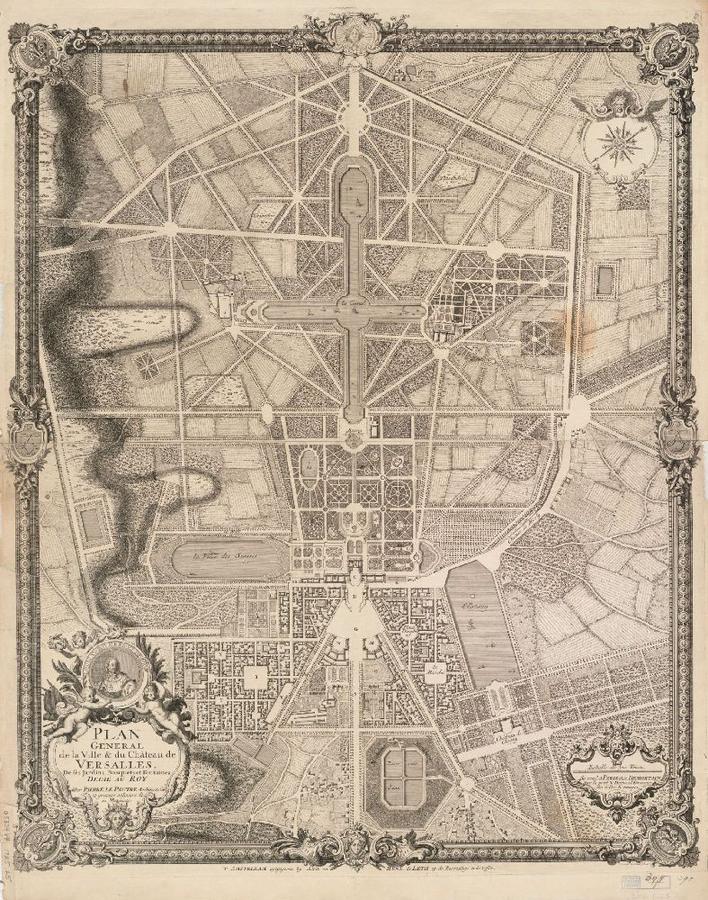
Abb. 2.32: Pierre Le
Die zur Zeit der Renaissance durch die Befestigungsanlagen fest definierte Umrisslinie der Stadt verlor im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts in den Fällen, in denen die Verteidigungsfunktion nicht mehr notwendig schien, ihren geschlossenen Charakter, so z. B. beim Ausbau des Dorfes
Das Vorbild, an dem sich die Gestaltung der Residenzen des Absolutismus in erster Linie orientierte, war
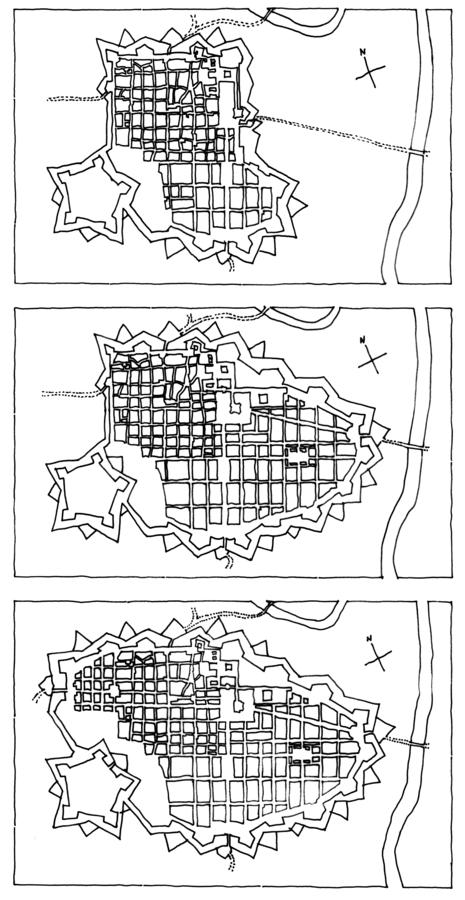
Abb. 2.33: Die städtebauliche Entwicklung
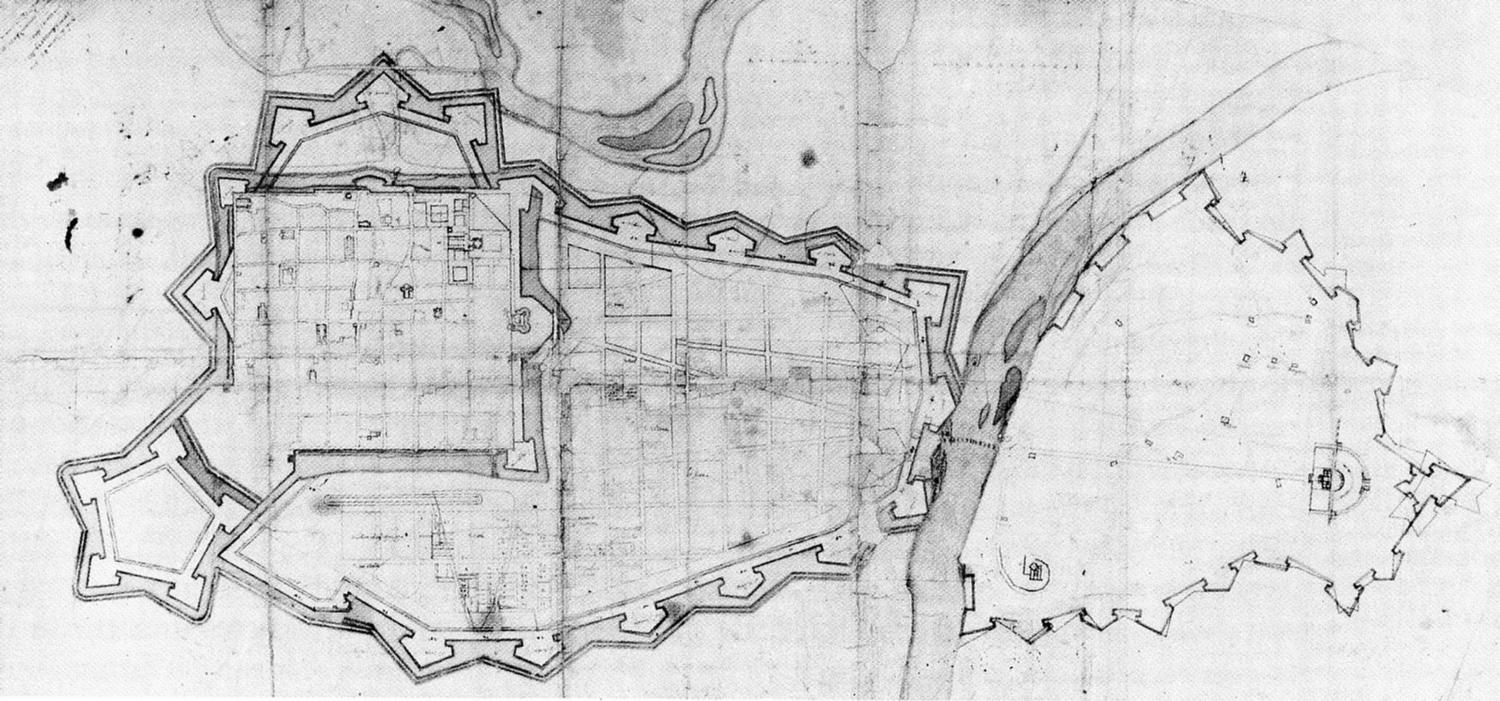
Abb. 2.34: Ercole Negro di
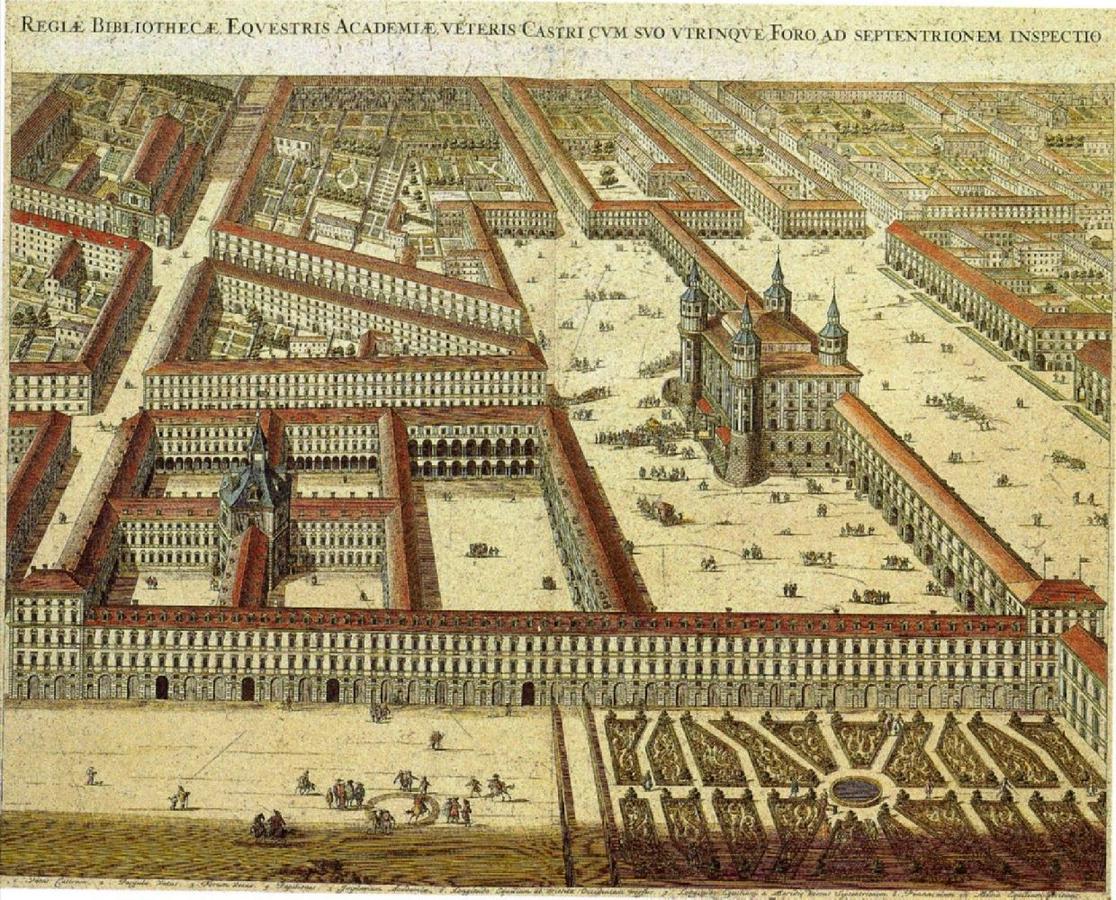
Abb. 2.35: Giovanni Tommaso
In
Im Anschluss an den Vertrag von Chateau-Cambrésis (1559), der dem Herzogtum Savoyen die verlorenen, nunmehr kaum befestigten Erblande zurückbrachte, hatte der Herzog Emanuele
Der erste städtebauliche Eingriff, der in den überkommenen Stadtorganismus vorgenommen wurde, bestand aus dem Einschneiden zweier neuer Straßen in das bestehende Rastersystem. Für die Bebauung der Vie Nuove sah schon Ascanio
Die erste Stadterweiterung von 1620 in Richtung Süden basierte auf einem Plan des Militäringenieurs Negro di Ercole di
Einheitlichkeit war in
Gegen Ende des Seicento vermittelte
2.6.6 Vom Territorium zum dekorativen Detail: Filippo Juvarras Tätigkeit am Turiner Hof
Die Zeitspanne, die sich zwischen dem Sieg von
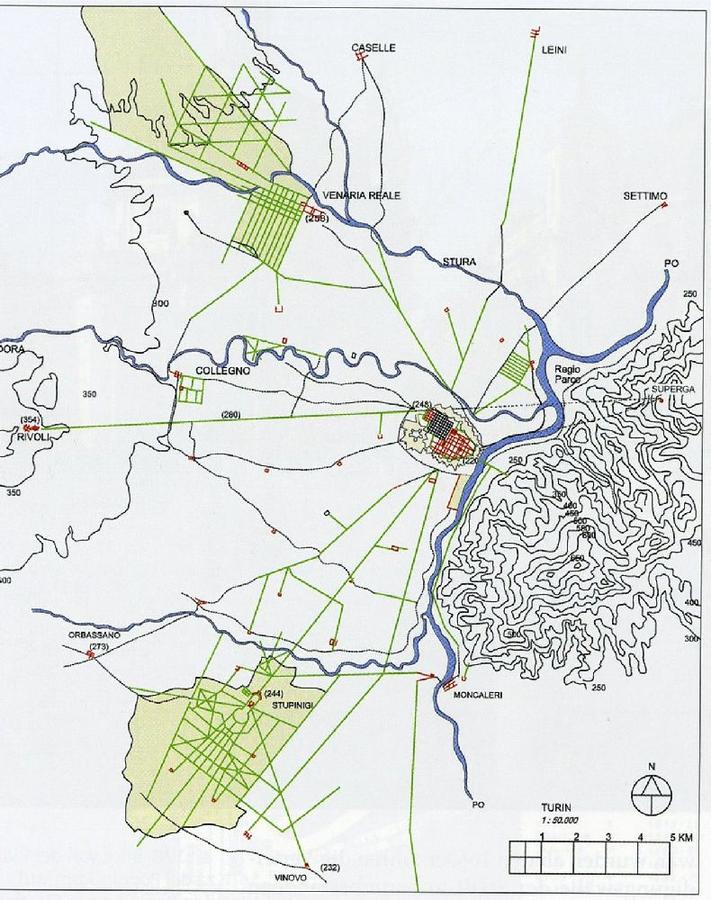
Abb. 2.36:
Unter Respektierung des in der Vergangenheit verfolgten städtebaulichen Konzepts, d. h. Einhaltung der funktionalen Hierarchie, eines gleichförmig-kontinuierlichen Fassadenverlaufs, eines regelmäßigen Gesamtbildes und Einsatz geradlinig geführter privilegierter Achsen, alles im Sinne szenographischer Gestaltung, unterbreitete
Die ebenfalls durch
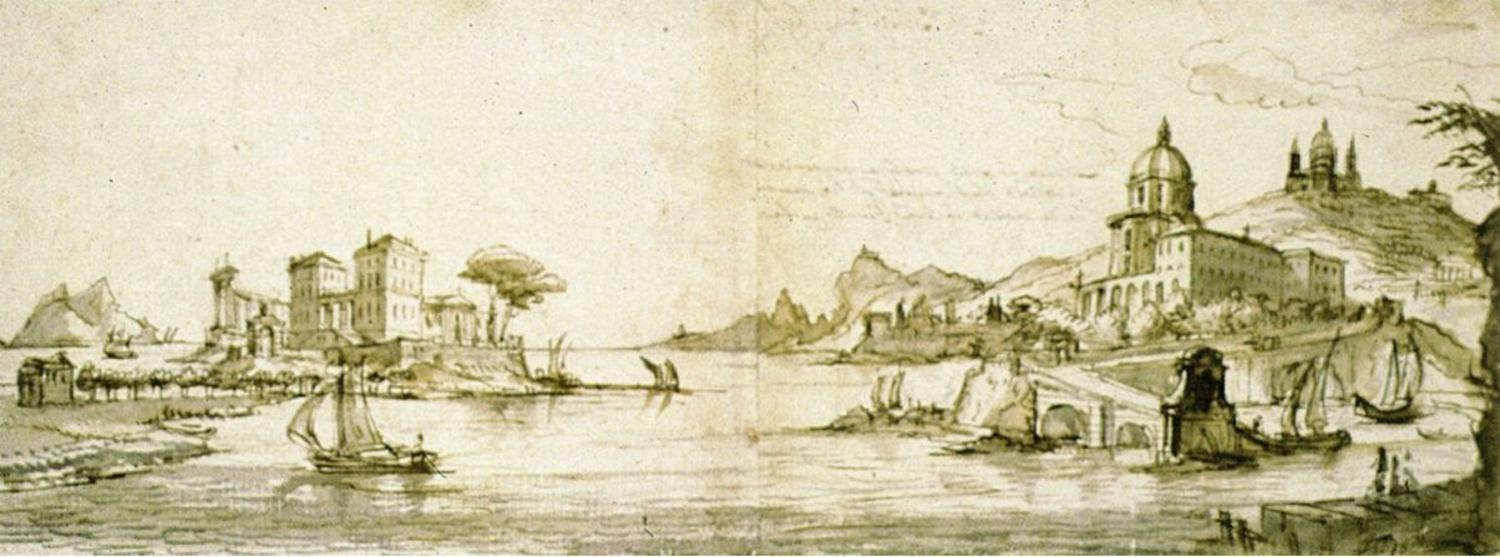
Abb. 2.37: Filippo
Das Beispiel der Zeichnung verdeutlicht
Neben der Achse
Von dem in elliptischer Form gestalteten salone der palazzina als Mittel- und Angelpunkt der symmetrischen Gesamtanlage von
Die Strukturierung der
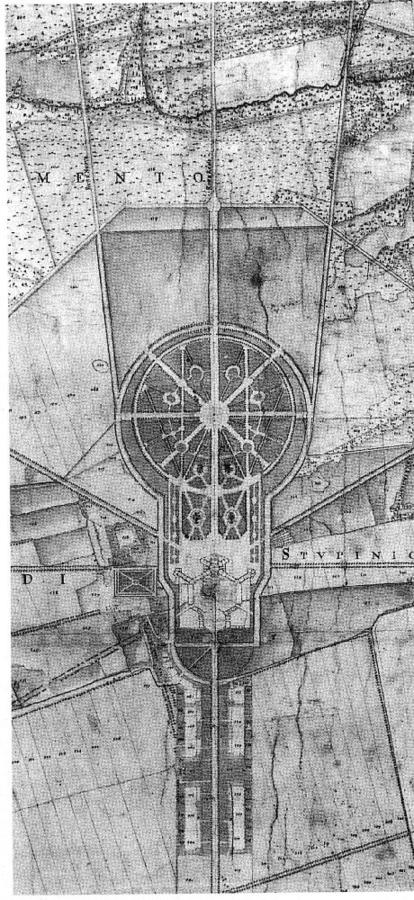
Abb. 2.38: Plan der Gesamtanlage von
Für solch große Bauaufträge, die auch in typologischer und künstlerischer Hinsicht mit
Die Umsetzung des Entwurfs in die Praxis erforderte eine sehr enge Zusammenarbeit der an der Baustelle beteiligten Handwerksbetriebe. Von
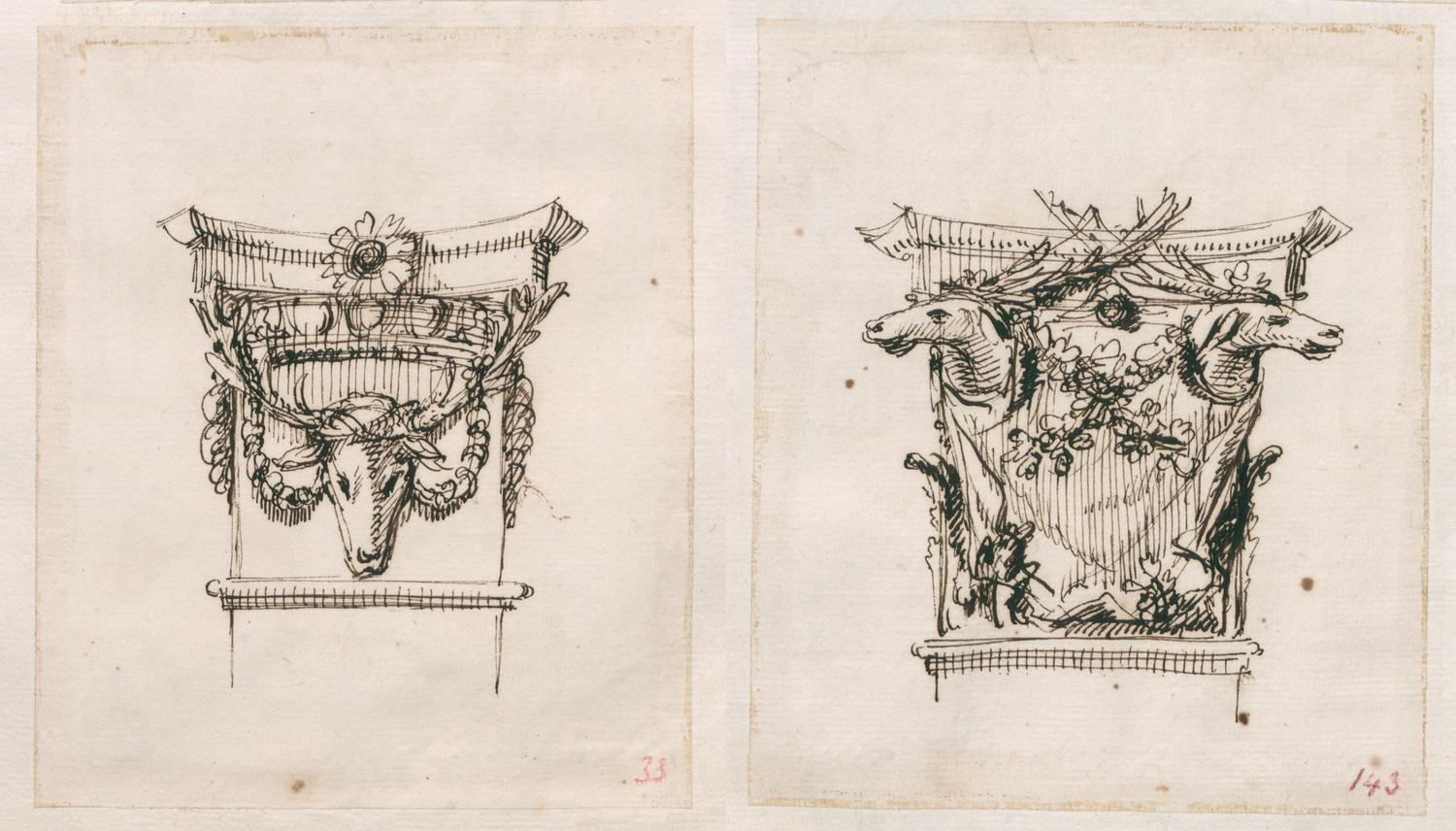
Abb. 2.39: Filippo
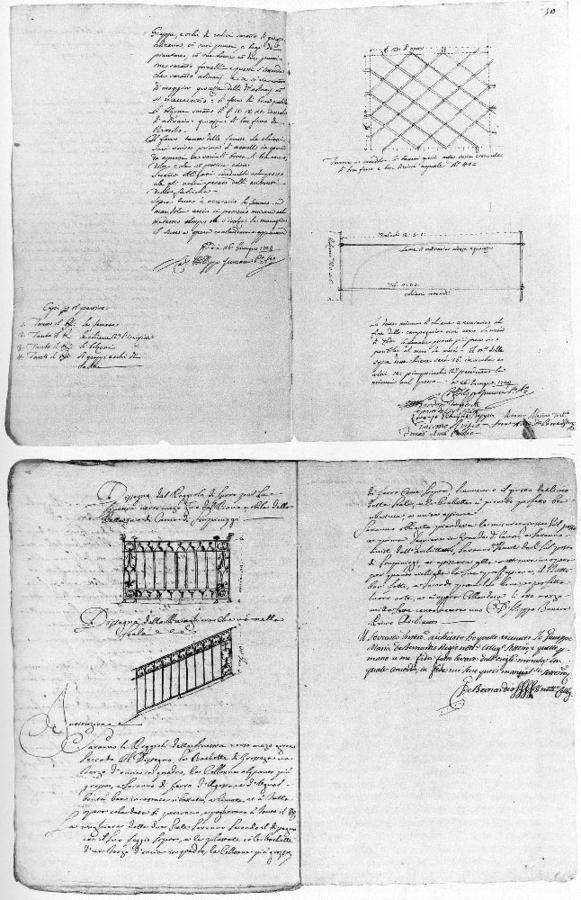
Abb. 2.40: Filippo
Ein Beispiel für
2.7 Logistik
2.7.1 Transport
Leider wird in der Literatur nicht gesagt, wie teuer Routine-Transporte auf dem Tiber waren. Scavizzi, die den Schiffsverkehr auf dem Tiber zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert untersucht hat, beschreibt, welche Tagelöhne die Arbeiter auf den Schiffen bekamen. Anhand der Akten der Steuerverwaltung analysiert sie, wie sich das auf dem Tiber transportierte Güter-Volumen im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt hat.573
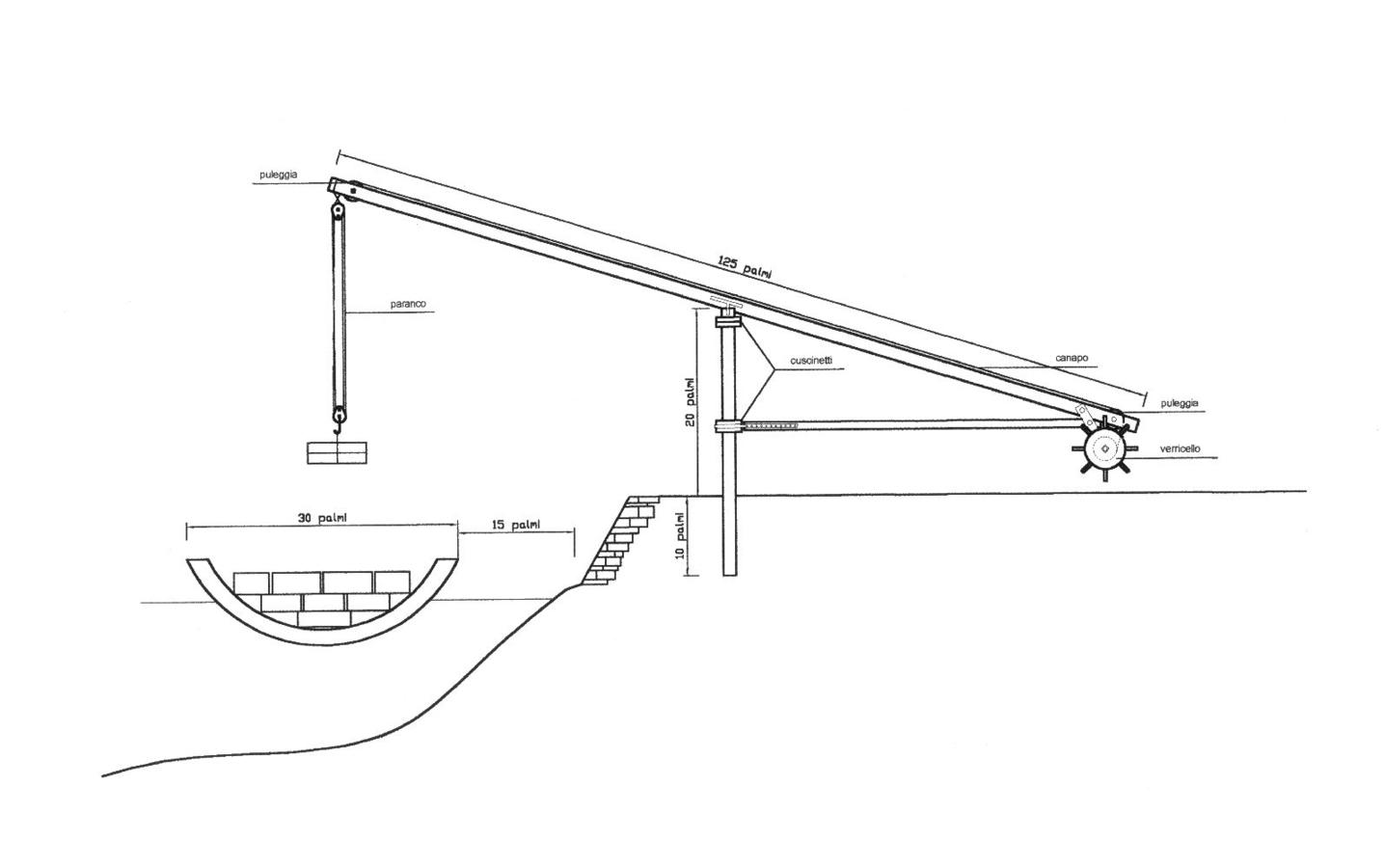
Abb. 2.41: Kran zum Be- und Entladen von Schiffen; Rekonstruktion von Nicoletta Marconi nach einer anonymen Zeichnung, BAV, codici Chigiani PVII, 13, c.69
Bauholz, das für provisorische Strukturen gedacht war, wurde zu chiodettoni oder chiode, d. h. zu Flößen zusammengebunden und den Tiber hinuntergeflößt. Holz für
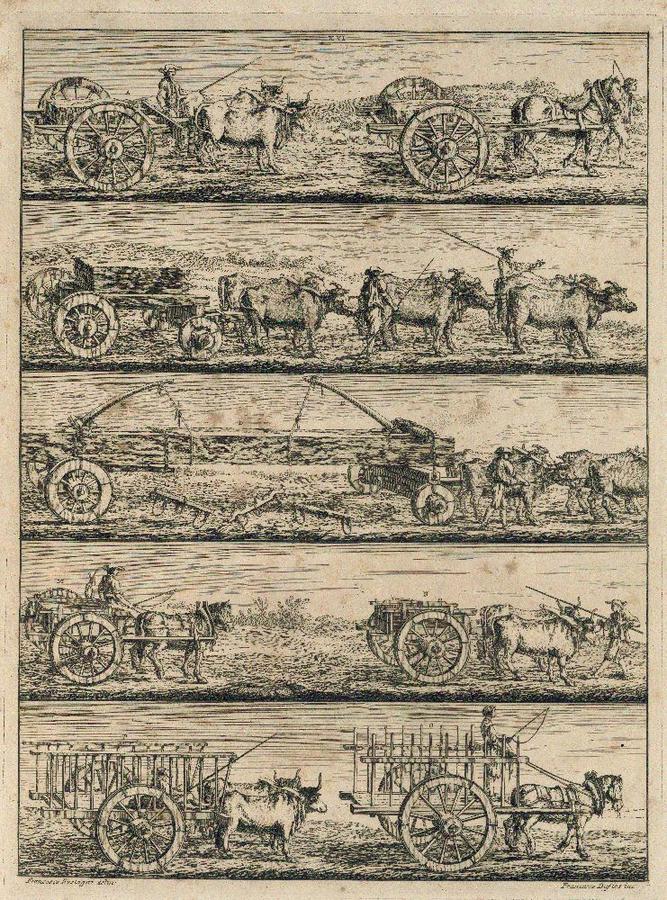
Abb. 2.42: Nicola
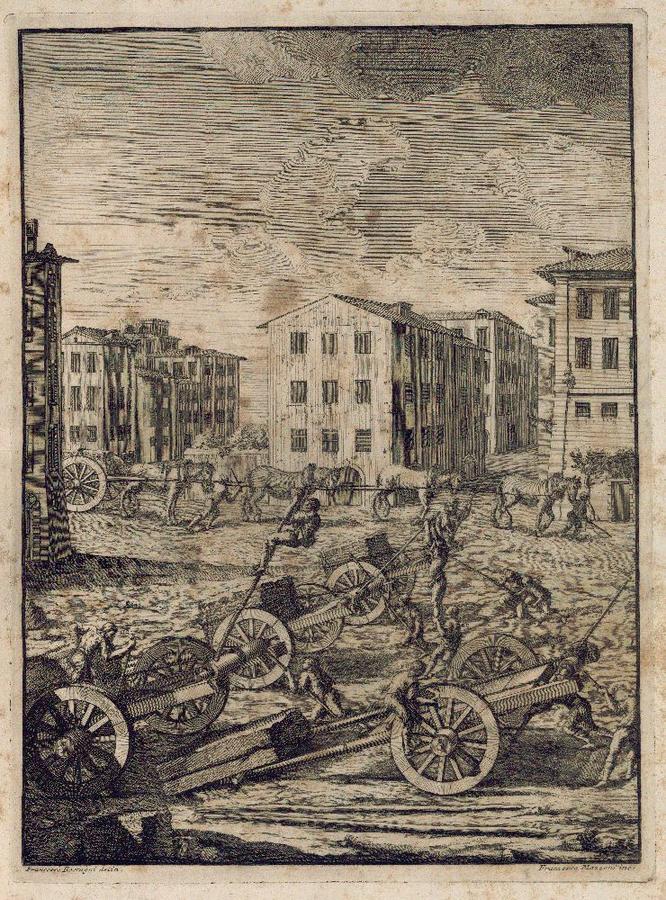
Abb. 2.43: Nicola
Große Steinblöcke konnten mit einer über mindestens drei Seile stabilisierten antenna von den Schiffen abgeladen werden (siehe unten, Abschnitt 2.9.4). Für leichtere Blöcke wurden capre eingesetzt. Die ökonomischste Variante der Ver- und Entladung schwerer Steinblöcke war es, sie unter einen Wagen zu binden und von Ochsen über eine Rampe auf das Schiff bzw. an Land ziehen zu lassen, wo die Seile gelöst wurden.577 Zum Be- und Entladen von Schiffen dienten auch Auslegerkräne (Abb. 2.41), die Marconi für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts aus den Codices Chigi rekonstruieren konnte. Der Ausleger ist 125 palmi (28 m) lang und wurde an Land von Pferden (daher auch die Bezeichnung mazzacavallo) oder mit Menschenkraft gedreht.
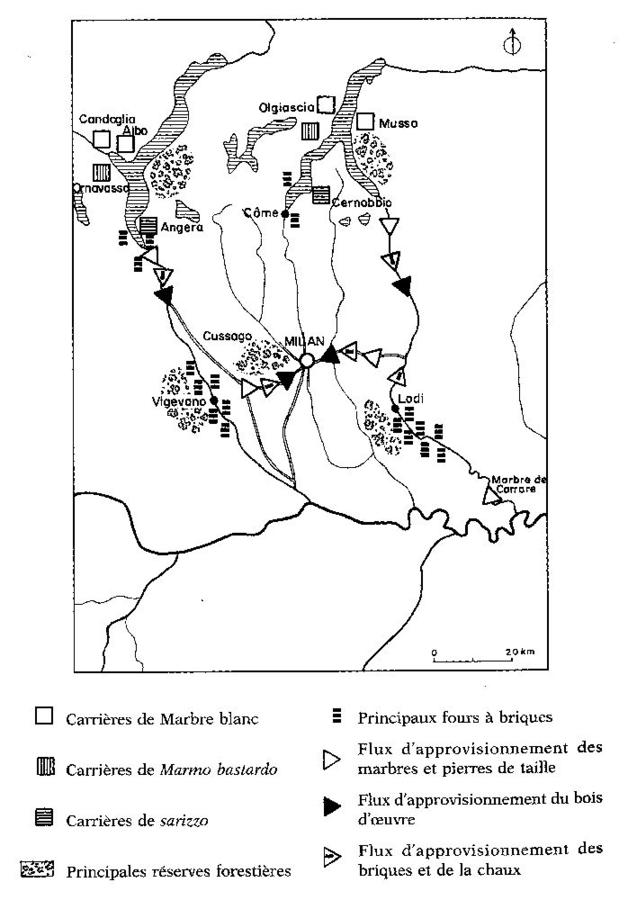
Abb. 2.44: Die Versorgung
Das Transportwesen mit Wagen war ebenfalls gut organisiert.
Im Jahre 1560 begann der Bau der Uffizien in
Der Transport des Marmors aus den Steinbrüchen in  Lire, bei Landtransport kamen 2 Lire 6 S. hinzu, d. h. der Landtransport kostete 30% mehr. Die Dombaustelle in
Lire, bei Landtransport kamen 2 Lire 6 S. hinzu, d. h. der Landtransport kostete 30% mehr. Die Dombaustelle in
Es gehörte zum Wissen und zur Erfahrung der Bauleute, die Lasten richtig einzuschätzen und den besten Transportmodus zu wählen. Wagen konnten nicht für beliebige Lasten ausgelegt werden. Als Wagenlast (carrettata) galten zunächst 3.000 Libbre, also etwas mehr als eine Tonne. Dies bezeichnete aber eher eine Durchschnittsladung und war durchaus nicht die maximal auf einem Wagen transportierbare Last. Allein die von
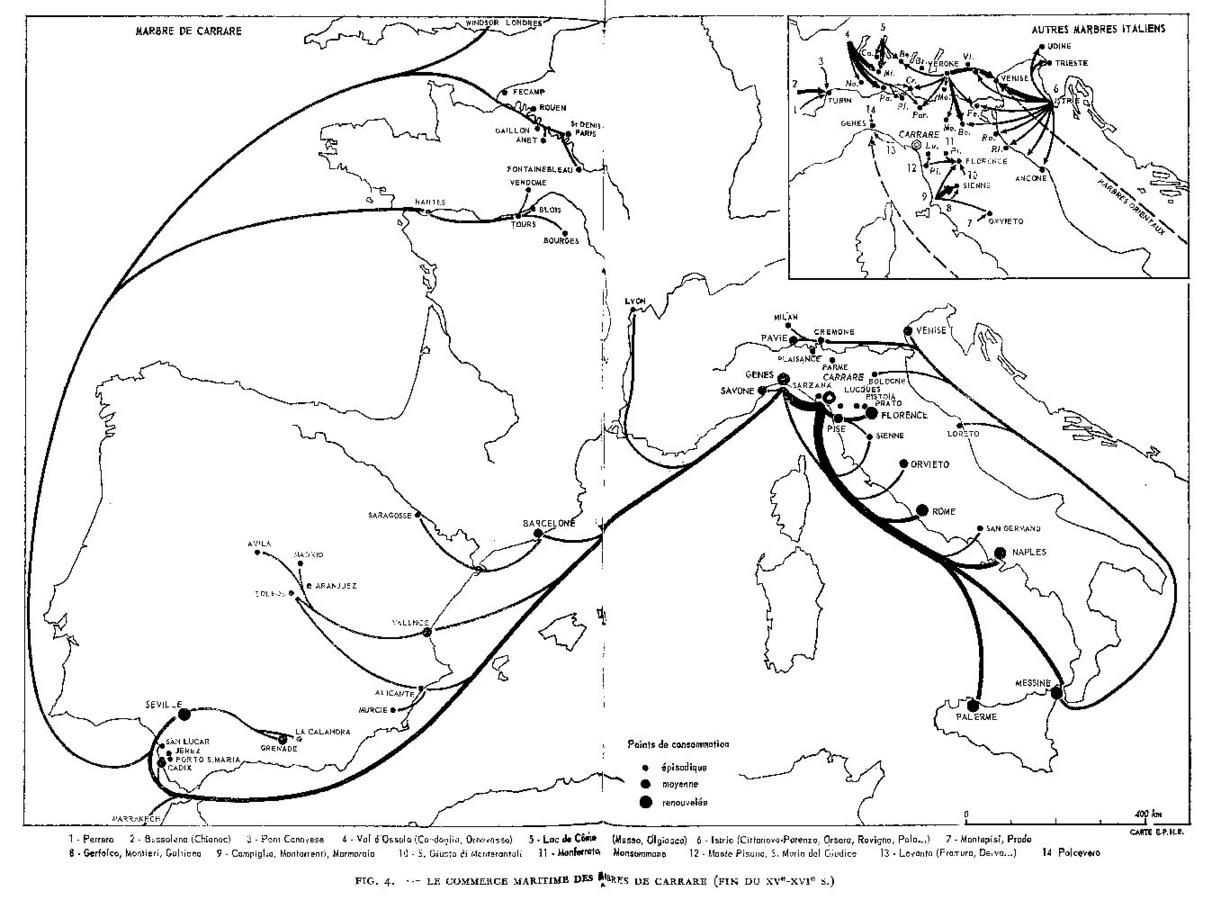
Abb. 2.45: Der Seehandel mit

Abb. 2.46: Der Transport eines
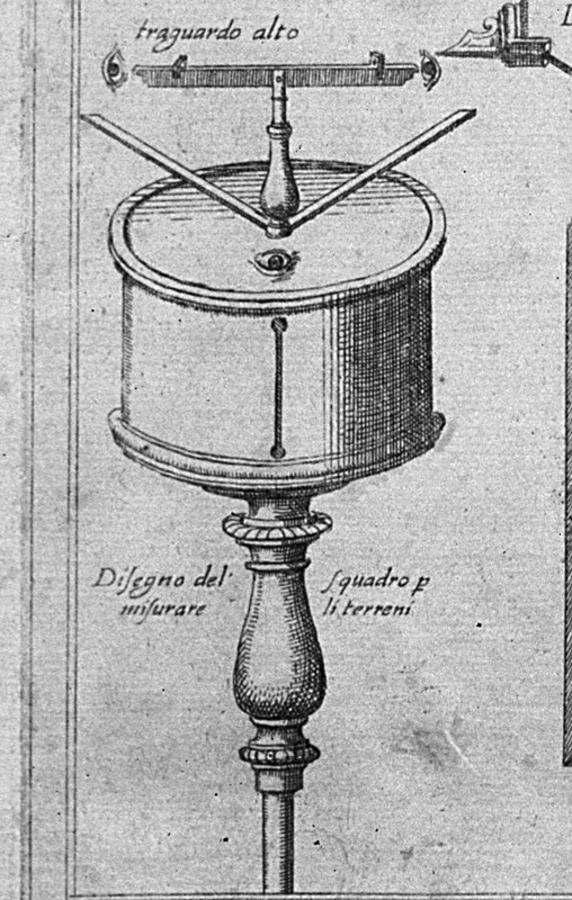
Abb. 2.47: Giovanni
Es wurden aber noch deutlich höhere Lasten transportiert: Der vatikanische Obelisk, den Domenico
Welchen Anteil hatte der Transport an den Gesamtbaukosten? Scavizzi wertet Listen zur Anwesenheit von Bauleuten aus, die der Ingenieur Cornelius
2.7.2 Baustoffhandel
2.7.3 Baustellen-Logistik
Die allgemeine Tendenz in
Im späten 15. Jahrhundert besorgten vor allem
Da sich die compagnie gegenseitig Konkurrenz machten und jede von ihnen mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeitete, war Regulierung erforderlich. Marconi beschreibt die Maßnahmen, mit denen die päpstliche Administration Spekulationen mit Aufträgen sowie das Abziehen von Arbeitskräften von bereits laufenden Baustellen zugunsten neuer Aufträge verhindern wollte. Eine Verordnung für die Maurer aus dem Jahre 1596 kontrollierte die Zugehörigkeit zur Università degli muratori (Maurerzunft) und schrieb den capomastri vor, wann und wie sie ihre Untergebenen zu bezahlen hatten, um Spekulation und Ausbeutung zu unterbinden. Die Verordnung regelte auch die Einbeziehung von Subunternehmern, die oftmals in die mit dem Hauptauftrag verknüpften Risiken eingebunden wurden. Um für die Reverenda Fabbrica arbeiten zu können, mussten die Firmen eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Die Bauleute mussten praktische Erfahrungen aus anderen Bauaufträgen haben (homini pratichi et che abbino fatte altre opere) und sie mussten Kapital und eine Werkstatt in
Mit der compagnia entstand aber nicht zuletzt auch ein neuer Wissensraum, in dem technisches und logistisches Wissen eine Symbiose eingingen. Die schlüsselfertige Erstellung von Bauteilen dürfte die compagnie angespornt haben,
Entscheidend für die Baustellen-Logistik waren aber nicht nur ökonomische Aspekte, sondern auch die traditionelle Aufteilung der Aufgaben nach Gewerken. Aufgabe der Maurer war bis mindestens zum Ende des 18. Jahrhunderts die Versorgung der Baustelle mit Maschinen, der Bau von Arbeits- und
2.7.4 Baustellen-Organisation
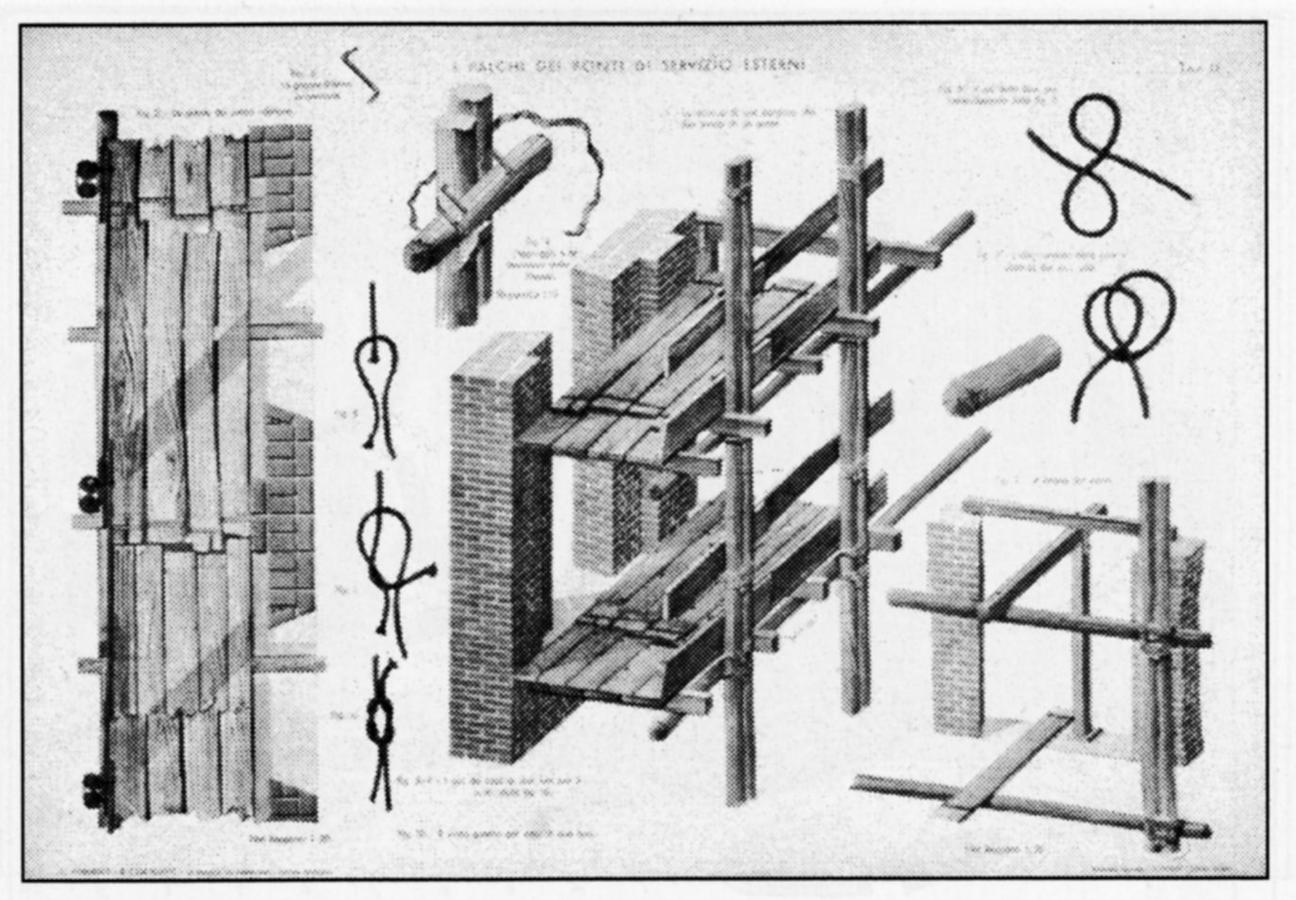
Abb. 2.48: Mit der Mauer aufwachsendes Arbeitsgerüst, aus: Formenti 1893, Teil 1, Taf. II.
Entscheidende Voraussetzung für eine Baustelle ist die Versorgung mit Wasser. Baustellen haben einen großen Wasserbedarf. Wasser wird für das Löschen von Kalk eingesetzt, für die Zubereitung von Mörtel, Putz und Farben, für das Wässern der Ziegelsteine vor dem Einbau, für das Schneiden und Polieren von Marmor und Travertin sowie für das Schleifen der Ziegelsteinoberflächen (arrotatura) und der Fußböden (orsatura). In
Die
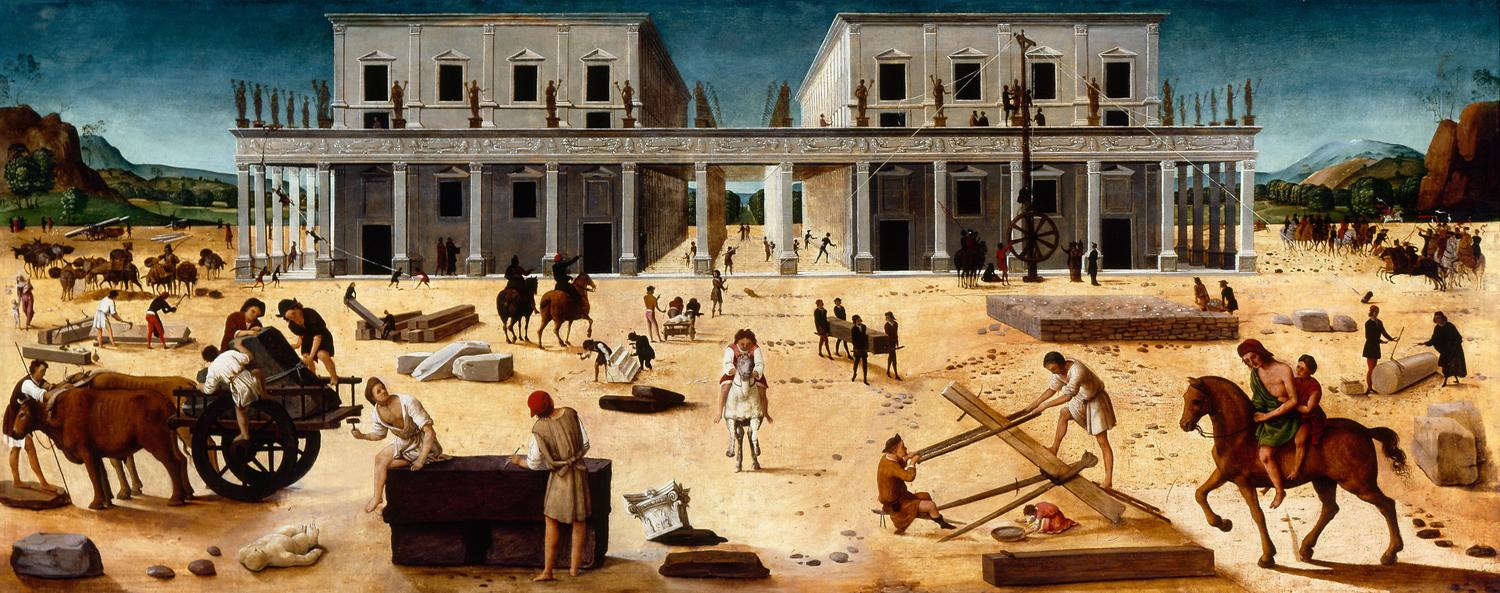
Abb. 2.49: Piero di
Aus praktischen Gründen wurden die Materialien in unmittelbarer Nähe der Baustelle gelagert. Ziegelsteine und Natursteine wurden nach Möglichkeit direkt unterhalb des Gerüstes getrennt voneinander aufgeschichtet. Dort positionierte man auch Fässer mit Kalk und Wasser. Für längere Lagerung von Baumaterialien wurden auf Baustellen außerhalb der Stadtmauern Magazine gebaut. Das konnten einfache Schutzdächer oder sogar regelrechte Holzhäuser sein (casotti in legno), in denen Material und Werkzeug vor Wetter und Diebstahl geschützt waren. In engen innerstädtischen Situationen wurden die Erdgeschoss- und Nebenräume in den an die Baustelle angrenzenden Häusern als Lager für Baumaterial angemietet, etwa bei Sant’Agnese in Piazza Navona oder auf dem Montecitorio. Wurden die Räume dabei beschädigt, musste die Baustelle haften.608
Auf der Baustelle selbst wurden Lasten mit Hilfe von Tragestangensystemen (Abb. 2.49, Mittelgrund, Mitte) von einem Ort zum anderen gebracht. Das Prinzip war dabei das gleichmäßige Verteilen einer Last auf viele Schultern. Ein Beispiel für ein Tragegestell ist die barella, mit denen zwei Personen Mörtel, Kalk etc. tragen konnten.609
Wenn möglich wurde der Bauzaun so großzügig angelegt, dass innerhalb der Umfriedung Platz für das Wiegen von Wagen (das geschieht mit einer großen Laufgewichtswaage offenbar Rad für Rad) und für die Zubereitung und Bearbeitung von Baumaterial blieb. Solche Arbeitsbereiche wurden in der Regel überdacht. Wenn Platz vorhanden war, wurde auf der Baustelle ein Kalkbrennofen eingerichtet, in dem Kalksteine, Travertinreste etc. zu ungelöschtem Kalk verarbeitet wurden. Unabhängig davon, ob Platzmangel dazu zwang oder ob man den Aufwand nicht selbst treiben wollte, konnte ungelöschter Kalk auch im Handel gekauft und gut abgedeckt auf Karren auf die Baustelle gefahren werden. Das Löschen des Kalks hingegen fand in der Regel auf der Baustelle statt. Um den Kalk zu löschen, wurde auf der Baustelle ein abgelegener, schattiger und feuchter Ort ausgesucht und dort eine Grube ausgehoben (siehe Abschnitt 2.8.2). Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich dann aber auch der Handel mit gelöschtem Kalk, d. h. die Arbeitsteilung im Bauwesen nahm weiter zu. Zimmerleute bekamen lange Verdachungen auf der Baustelle, um die Balken vorzubereiten. Auch die Steinmetzen hatten ihre Schutzdächer, unter denen sie bei jedem Wetter arbeiten konnten. Tischler hingegen arbeiteten in der Regel in ihrer eigenen bottega und lieferten die fertigen Produkte auf die Baustelle. Auch das Anmischen von Putzen und Farben erfolgte nicht auf dem Bauplatz, da dessen staubiges Ambiente unvorteilhaft war.610
Zu den Arbeitszeiten auf den Baustellen gibt es relativ wenige Informationen. In seinem Architekturtraktat schlägt
2.7.5 Friktionen und Probleme
2.8 Materialwissen
2.8.1 Verwendete Materialien
2.8.2 Kalk
2.8.3 Puzzolanerde
2.8.4 Holz
Das Holz kam aus verschiedenen Waldgebieten aus der weiteren Umgebung Roms. In den Sabiner Bergen konnte zwischen Oktober und März Holz geschlagen werden. Die Qualität eines Brettes hängt stark von der Position im Baumstamm ab, aus der es stammt. Mezzareccia heißt ein Brett, das aus der Mitte stammt, asciatone ein aus dem Randbereich des Stammes entnommenes, sich werfendes, also qualitativ schlechteres Brett. Bretter mit gebogenen Oberflächen wurden auch rodone, rondoncello oder stanghetta genannt. Fodero wiederum hieß ein Brett, das rundherum geschnitten ist. Bretter, die kürzer sind als 12 Palmi (ca. 2,70 m), wurden als mozzette bezeichnet. Bretter, die schmaler als ein Palmo sind (0,2234 m), hießen marmaglie. Die Bezeichnung mercantile steht für legname assortito, also paketweise verkauftes Schnittholz, das günstiger war als Schnittholz, das Stück für Stück ausgewählt wurde. Zur Ablagerung von Holz gibt es für das frühneuzeitliche
2.8.5 Schmiedeeisen
In hölzernen Dachbindern fand Schmiedeeisen ebenfalls Verwendung. Zumindest der horizontale Zugbalken (catena) wurde regelmäßig mit einer schmiedeeisernen Schlaufe an den vertikalen Hängebalken (monaco) gehängt. Vielfach dienten verkeilte schmiedeiserene Laschen (staffoni) dazu, die Holzelemente des Binders an den Auflagern zusammenzuhalten.625
2.8.6 Abdichtungen
Für Abdichtungen wurde cocciopesto verwendet. Cocciopesto oder coccio pisto ist ein Mörtel aus Ziegelsteinpulver,
2.8.7 Ziegelsteine
Ziegelsteine wurden verwendet für Mauern, für Fußböden, für die Errichtung von Bögen, Gewölben, Kuppeln, in hart gebrannter Form für sichtbar belassenes Ziegelmauerwerk an Fassaden. Ein Beispiel für die differenzierte Verwendung von Ziegelsteinen im römischen Bauwesen ist die Cappella Sistina (1585–87, an Santa Maria Maggiore).628 Die Mauern, Bögen, Pendentifs, aber auch das Kreuzgewölbe im Seitenschiff vor der Kapelle sowie die Wölbungen der Kapellen des Heiligen  -steinige Schale aus Ziegelsteinen geschichtet wurde.629 Die Kuppel der Cappella Sistina besteht im Gegensatz zum Tambour aus neuen Ziegelsteinen. Im Innenraum wurden ebenfalls neue Ziegel verwendet. Dabei kamen die teuersten Ziegelsteine zum Einsatz, nämlich geschnittene und im Wasser geschliffene Ziegelsteine (mattoni tagliati arotati ad acqua) aber auch trocken geschliffene Ziegelsteine (mattoni rotati a secco). Hierbei handelt es sich um normierte Verfahrensweisen der Ziegelvor- und -nachbearbeitung, die eine bestimmte Produktqualität garantierten.630
-steinige Schale aus Ziegelsteinen geschichtet wurde.629 Die Kuppel der Cappella Sistina besteht im Gegensatz zum Tambour aus neuen Ziegelsteinen. Im Innenraum wurden ebenfalls neue Ziegel verwendet. Dabei kamen die teuersten Ziegelsteine zum Einsatz, nämlich geschnittene und im Wasser geschliffene Ziegelsteine (mattoni tagliati arotati ad acqua) aber auch trocken geschliffene Ziegelsteine (mattoni rotati a secco). Hierbei handelt es sich um normierte Verfahrensweisen der Ziegelvor- und -nachbearbeitung, die eine bestimmte Produktqualität garantierten.630
Scavizzi beschreibt die Herstellung von Ziegelsteinen.631 Die Ziegelbrennöfen funktionierten im Sommer (meist von April bis September), da es nur dann warm genug war, um die Ziegel vor dem eigentlichen Brennvorgang ausreichend zu trocknen. In diesem Zeitraum mussten genügend Ziegelsteine hergestellt werden, um das florierende Bauwesen in
Über die konstruktive Verwendung von Ziegelsteinen und ihre differenzierte Verwendung zum Wohle der Bauwerkstabilität ist bereits berichtet worden. Baudekoration mit Ziegelsteinen spielte hingegen in der Italienischen Frühen Neuzeit nur eine untergeordnete Rolle, etwa für den Bereich der Fußböden. Ziegelstein- oder besser Terracottafußböden wurden bereits in der Antike benutzt und von
Im durch den Ziegelbau dominierten
Außerhalb der
2.8.8 Naturstein
Scavizzi beschreibt die Verwendung von Naturstein im römisch-frühneuzeitlichen Bauwesen.644
Die visuelle Kultur der Renaissance verlangte den Einsatz von Naturstein. Aus Kostengründen wurden neben echten Steinen auch steinvortäuschende Putze verwendet. Der Ersatz des Marmors (siehe folgender Abschnitt) durch gleichaussehende Putze wird schon von
2.8.9 Marmor und die Verwendung von Spolien
Marmor gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Qualitäten. Die Marmorvorkommen verteilen sich über den gesamten Mittelmeerraum. Von überall her wurde der Marmor in der Antike nach
Aufgrund der seltsamen Formationen in ihrer Maserung sind sogenannte lumachelle in der Frühen Neuzeit regelmäßig Teil von Kunstkammern.654 Brocatello, feinteilig gelb-rot gegliedert und eine Spielart der lumachelle, kommt aus dem katalanischen
Der Begriff Brekzie (breccia) kommt aus der Geologie und steht für Gesteinskonglomerate, die unter hohem Druck ,zusammengebacken‘ worden sind. Eine breccia, die sich an Resten antiker Villen in
Der Einsatz antiker Bauteile (Spolien) in neuen architektonischen Kontexten im
Satzinger gibt einen Überblick über den Gebrauch von Spolien im
Mit Buntmarmor ausgestattete Familienkapellen in den römischen Kirchen gehörten seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert zu den wichtigsten Bauaufgaben. Dabei kamen Spolienteile und Spolienmarmor ebenso zum Einsatz wie neu gebrochener Marmor. Es stellt sich die Frage, in wie weit die Verwendung von Spolienmarmor im Vergleich zu neu gebrochenem Marmor einen Kostenvorteil brachte oder ob das Prestige, Spolien zu verwenden, sogar einen Aufpreis bedeutete. Für den Marmor wurden exorbitante Summen ausgegeben. Papst
Ein Großteil der Kosten für die Cappelle Sistina und Paolina ist der Ausstattung geschuldet, die in beiden Fällen bis zum Hauptgebälk komplett aus Marmor besteht. Neben der Cappella Gregoriana in St. Peter waren diese beiden Kapellen der Höhepunkt der mit Marmor ausgestatteten Kapellen in
Dass die benannten Kosten für eine Marmorausstattung durchaus plausibel sind, zeigen kleine, privat finanzierte Kapellen mit Buntmarmorausstattung. Für die Ausstattung einer Kapelle in Sant’Andrea della Valle wurde mit Kosten in Höhe von 15.000–20.000 Scudi gerechnet.671 Geringer waren die Kosten für die Ausstattung der Kapellen in der Kirche Il Gesù, die im Grundriss kleiner und deutlich niedriger sind. Die um die Jahre 1646–1650 ausgeführte Marmorausstattung (inklusive Skulpturen) der Cappella Cerri in Il Gesù kostete insgesamt, d. h. inklusive der Bezahlung der Bearbeitung des Marmors und der Metallarbeiten 6.980,77 Scudi. Davon waren mindestens 3.939,10 Scudi allein in die Beschaffung des Marmormaterials investiert worden. Eine Säule aus verde antico kostete allein 180 Scudi, eine weitere aus bianco e nero antico 125 Scudi. Die in
Überschlägt man die mit Marmor auszustattende Oberfläche der Cappella Cerri (mit Fußboden und 3 Wänden), so erhält man eine Fläche von etwa 180 qm, während in den Cappelle Sistina und Paolina jeweils etwa 1000 qm, d. h. etwa 6 mal so viel Fläche zu bedecken war. Die Marmorausstattung würde in den Kapellen an Santa Maria Maggiore also hochgerechnet 42.000 Scudi kosten (wobei die schwer zu beziffernden Geldwertveränderungen hier unberücksichtigt bleiben müssen). Aus der Kostenaufstellung in den Libri di conti von Domenico
2.8.10 Bekannte und relevante Materialeigenschaften: Architekturtraktate
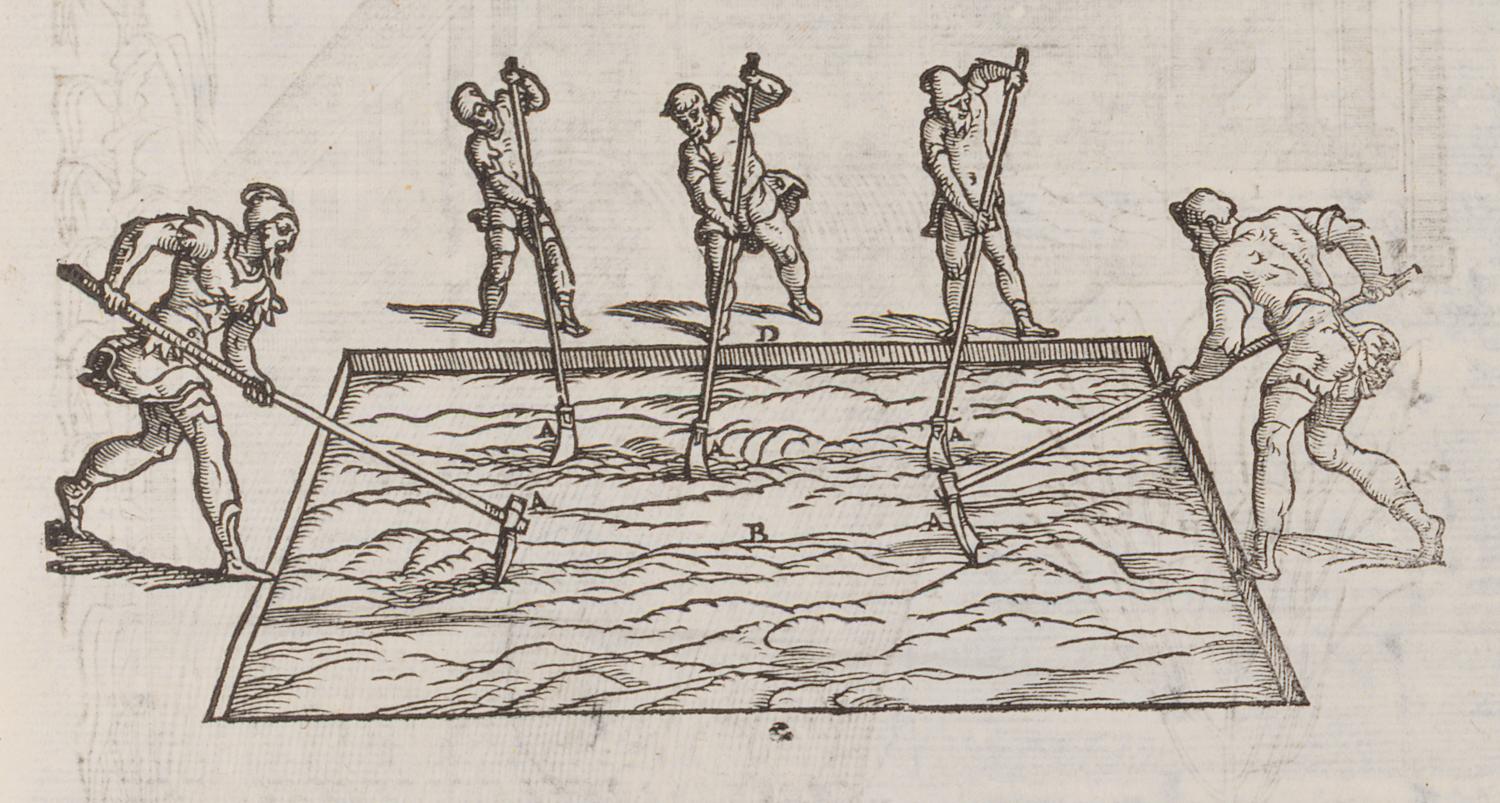
Abb. 2.50: Antonio
Daniele
Die Vorgänge des Kalkbrennens und des Kalklöschens und das Materialverhalten in diesen Übergängen erklärt
Auch Antonio
Leon Battista
Sebastiano
Vincenzo
2.8.11 Bekannte und relevante Materialeigenschaften: Festigkeitslehre
Bernardino Baldi publizierte im Jahre 1621 einen Kommentar zu den Mechanischen Problemen, die
Die Trennung von Fragen des Materials und der Konstruktion war im Kontext der
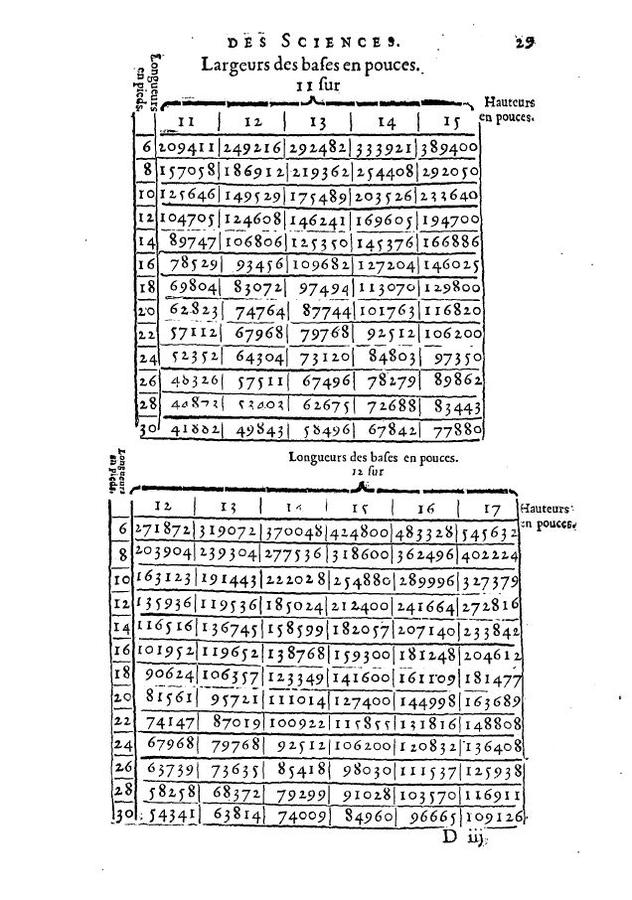
Abb. 2.51: Antoine
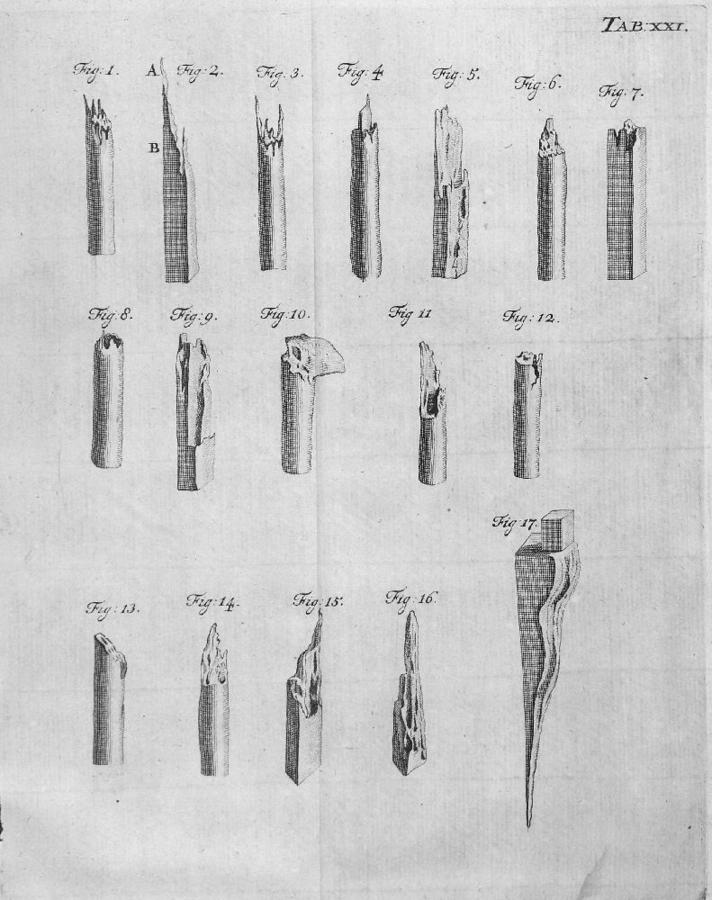
Abb. 2.52: Petrus van
Gargiani gibt einen Überblick über Versuchsanordnungen und Versuchsreihen, mit denen man Materialeigenschaften empirisch näher kam.692 Leonardo Da
Alle Testreihen haben einen standardisierten Aufbau, so dass die Ergebnisse vergleichbar werden und systematisch Kenntnisse gewonnen werden können. Bei den Tests für die Belastbarkeit von Holzbalken spielen sowohl die Materialeigenschaften wie auch die Geometrie der Konstruktion eine Rolle. Dennoch werden diese Komponenten sehr wohl auseinandergehalten: Pierre
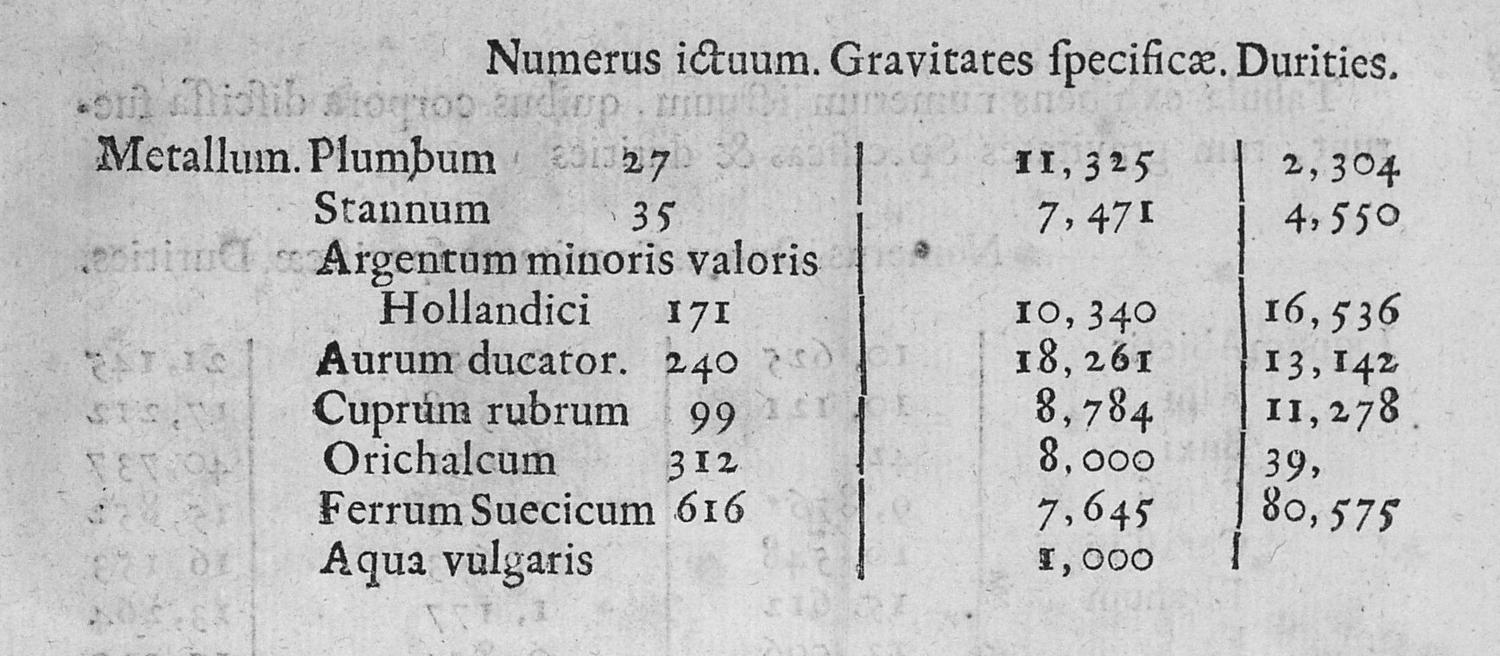
Abb. 2.53: Petrus van
Interessant ist in diesem Zusammenhang der Fall Petrus van  Rheinischen Zoll im Versuch ausgehalten hatte, genau die Ergebnisse von van Musschenbroeks Experiment Nummer LXXVII.700 Sie fügten den von van Musschenbroek empirisch ermittelten Einzelwert in ihre strukturmechanischen Berechnungen der Peterskuppel ein. Die Normalisierung von Festigkeitswerten in Tabellenform war also in den Augen der anerkannten Fachleute noch nicht verlässlich, beruhten also vermutlich auf zu wenigen Messungen. Dennoch gab van Musschenbroek eine Denkrichtung vor, die von Erfolg gekrönt sein sollte. Die Normalisierung von Festigkeitswerten wurde auf der Grundlage sehr viel zahlreicherer Messergebnisse weiterverfolgt und die Tabellen setzten sich durch. An dem bei den Mathematikern zu beobachtenden Grundprinzip, Materialfestigkeitswerte in Formeln einzusetzen, die die strukturmechanischen Gegebenheiten einer Konstruktion abbilden, hat sich bis heute nichts geändert. Tabellenwerke bzw. Software-Bibliotheken mit Materialfestigkeitswerten oder Belastungsgrenzen sind fester Bestandteil statischer Berechnungsverfahren. Den langsamen Prozess der Normalisierung von Materialwerten in Tabellenwerken nachzuvollziehen, ist ein Desiderat der Bautechnikgeschichte.
Rheinischen Zoll im Versuch ausgehalten hatte, genau die Ergebnisse von van Musschenbroeks Experiment Nummer LXXVII.700 Sie fügten den von van Musschenbroek empirisch ermittelten Einzelwert in ihre strukturmechanischen Berechnungen der Peterskuppel ein. Die Normalisierung von Festigkeitswerten in Tabellenform war also in den Augen der anerkannten Fachleute noch nicht verlässlich, beruhten also vermutlich auf zu wenigen Messungen. Dennoch gab van Musschenbroek eine Denkrichtung vor, die von Erfolg gekrönt sein sollte. Die Normalisierung von Festigkeitswerten wurde auf der Grundlage sehr viel zahlreicherer Messergebnisse weiterverfolgt und die Tabellen setzten sich durch. An dem bei den Mathematikern zu beobachtenden Grundprinzip, Materialfestigkeitswerte in Formeln einzusetzen, die die strukturmechanischen Gegebenheiten einer Konstruktion abbilden, hat sich bis heute nichts geändert. Tabellenwerke bzw. Software-Bibliotheken mit Materialfestigkeitswerten oder Belastungsgrenzen sind fester Bestandteil statischer Berechnungsverfahren. Den langsamen Prozess der Normalisierung von Materialwerten in Tabellenwerken nachzuvollziehen, ist ein Desiderat der Bautechnikgeschichte.
2.9 Bautechniken
2.9.1 Mauerwerkstechnik
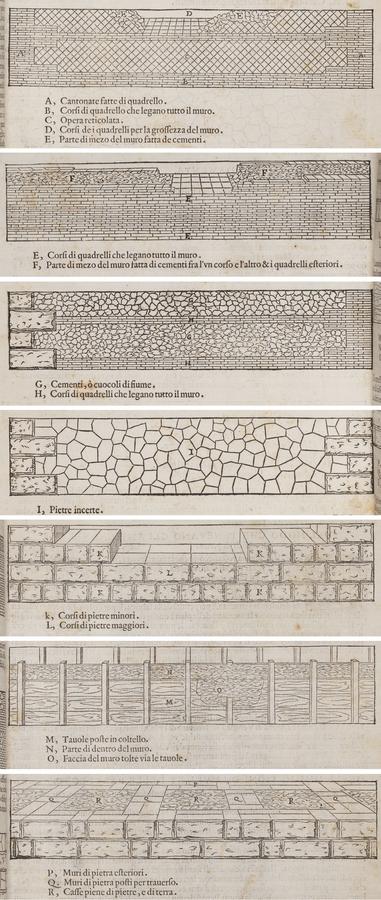
Abb. 2.54: Andrea
Die verbreitetste Bauweise im frühneuzeitlichen
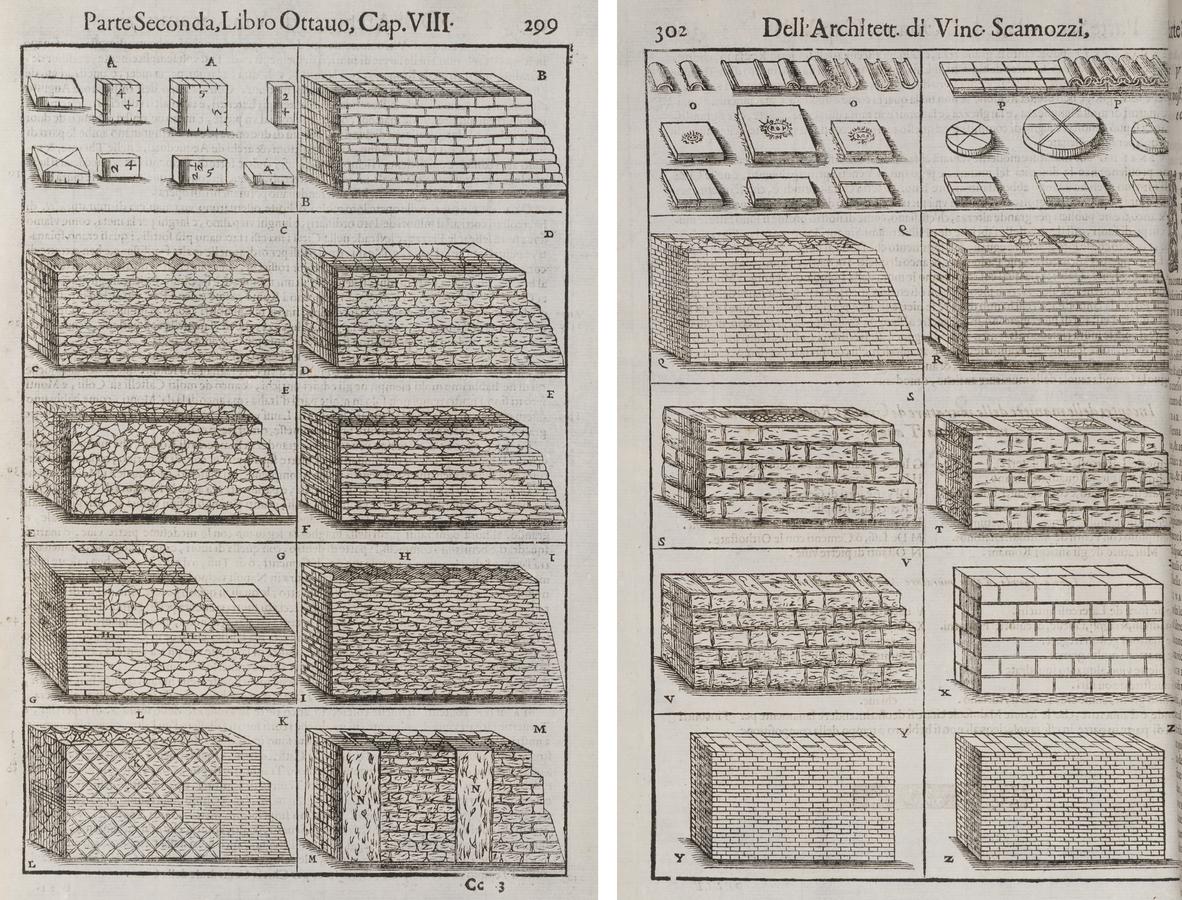
Abb. 2.55: Vincenzo
In den Traktaten der Renaissance spielt die Bautechnik der Römischen Antike insgesamt eine große Rolle. Das gilt natürlich zunächst für die Neuausgaben und Übersetzungen des antiken

Abb. 2.56: Jacopo Barozzi da
Die von

Abb. 2.57: Jacopo Barozzi da
Ein gutes Beispiel für diese Kompetenzenteilung ist der nach Entwurf

Abb. 2.58: Brunnen an der Rampa di San Sebastianello, ,abgeschnittene‘ Ziegelsteinschale, ca. 1570 (Foto: H. Schlimme).

Abb. 2.59: Francesco
Varagnoli hat die cortine laterizie d. h. die Sichtziegelschalen im  Scudi, d. h. etwa 3 mal so viel.711 Der hohe Preis des Materials erklärt sich, weil die am besten und am gleichmäßigsten gebrannten Ziegel aus den Bränden ausgewählt wurden. Die Verbindung zum rückwärtigen Mauerwerk wurde durch Bindersteine hergestellt. Diese wurden in den Ausschreibungsunterlagen (capitolati) vehement gefordert, aber – wie im Fall von Sant’Andrea della Valle – nicht gesondert vergütet. Daher waren die Bauleute gerade bei Verträgen a tutta roba geneigt, die Bindersteine selten oder gar nicht zu setzen.712 Beim Collegio Romano, der Casa Professa der Jesuiten und auf der Flanke von San Giovanni die Fiorentini sind die Bindersteine zahlreich, aber nicht regelmäßig. Im Übrigen ist die Präsenz von Bindersteinen generell sehr gering. Abgesehen von den Bindern sagen die capitolati wenig über konstruktive Details oder über die Ziegelsteinformate. Die Verwendung der üblichen Formate wird schlicht vorausgesetzt. Auch der Mauerwerksverband (l’apparecchio) wird in den capitolati nicht benannt.
Scudi, d. h. etwa 3 mal so viel.711 Der hohe Preis des Materials erklärt sich, weil die am besten und am gleichmäßigsten gebrannten Ziegel aus den Bränden ausgewählt wurden. Die Verbindung zum rückwärtigen Mauerwerk wurde durch Bindersteine hergestellt. Diese wurden in den Ausschreibungsunterlagen (capitolati) vehement gefordert, aber – wie im Fall von Sant’Andrea della Valle – nicht gesondert vergütet. Daher waren die Bauleute gerade bei Verträgen a tutta roba geneigt, die Bindersteine selten oder gar nicht zu setzen.712 Beim Collegio Romano, der Casa Professa der Jesuiten und auf der Flanke von San Giovanni die Fiorentini sind die Bindersteine zahlreich, aber nicht regelmäßig. Im Übrigen ist die Präsenz von Bindersteinen generell sehr gering. Abgesehen von den Bindern sagen die capitolati wenig über konstruktive Details oder über die Ziegelsteinformate. Die Verwendung der üblichen Formate wird schlicht vorausgesetzt. Auch der Mauerwerksverband (l’apparecchio) wird in den capitolati nicht benannt.
Ein Verputz für Mauerwerk bestand üblicherweise aus den drei Schichten rinzaffo, arriccio und colla. Der rinzaffo ist die unterste Putzschicht, die aus Kalk und groben Zuschlägen wie Ziegelbruch oder Kies gemacht wurde. Die Aufgabe des rinzaffo war es, die Unregelmäßigkeiten des Mauerwerks auszugleichen. Die zweite Putzschicht, der arriccio, besteht aus Kalk und pozzolana sowie feinem Kies und Sand als Zuschlagstoffen. Der arriccio soll die Setzungen während des Abbindens des Mauerwerks ausgleichen und eine glatte Oberfläche für die Aufbringung der obersten Putzschicht colla bieten. Die colla kommt in den Baudokumenten in
2.9.2 Opus quadratum, zweischaliges Mauerwerk
Opus quadratum bezeichnet aus Natursteinblöcken hergestelltes Mauerwerk, das als römisch-antikes Mauerwerk schlechthin gilt. Als Beispiele können Bauten wie das Kolosseum in

Abb. 2.60: San Marco,
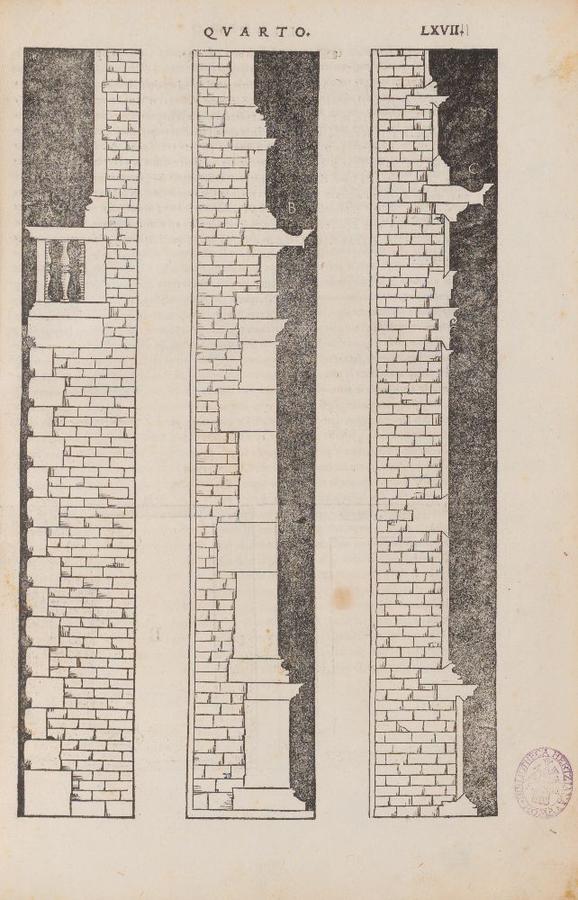
Abb. 2.61: Sebastiano

Abb. 2.62: San Luigi dei Francesi,

Abb. 2.63: Giacomo della
Eine reine Natursteinquaderkonstruktion ist im frühneuzeitlichen

Abb. 2.64: Filippo
Die visuelle Kultur der Antike und der Renaissance baute auf echten Naturstein. Bei Geldmangel waren aber steinvortäuschende Putze statthaft. Eine Natursteinverkleidung ließ sich auch aus Stuck nachahmen und die Steinmaserung aufmalen. Eine solche Handhabung ist an der Kurie im römischen Forum Romanum noch zu erkennen. Die Renaissance übernahm die Verfahren, Natursteinverkleidung zu simulieren, aus der Antike.
Die Architekten der Renaissance zitierten bisweilen die Ästhetik antiker

Abb. 2.65: Leon Battista

Abb. 2.66: Palazzo della Cancelleria,
Der antikisierende Charakter des opus isodomum lag in seiner perfekten Regelmäßigkeit. Rustikamauerwerk mit unterschiedlich hohen Steinlagen, wie am Palazzo
2.9.3 Steinmetztechnik
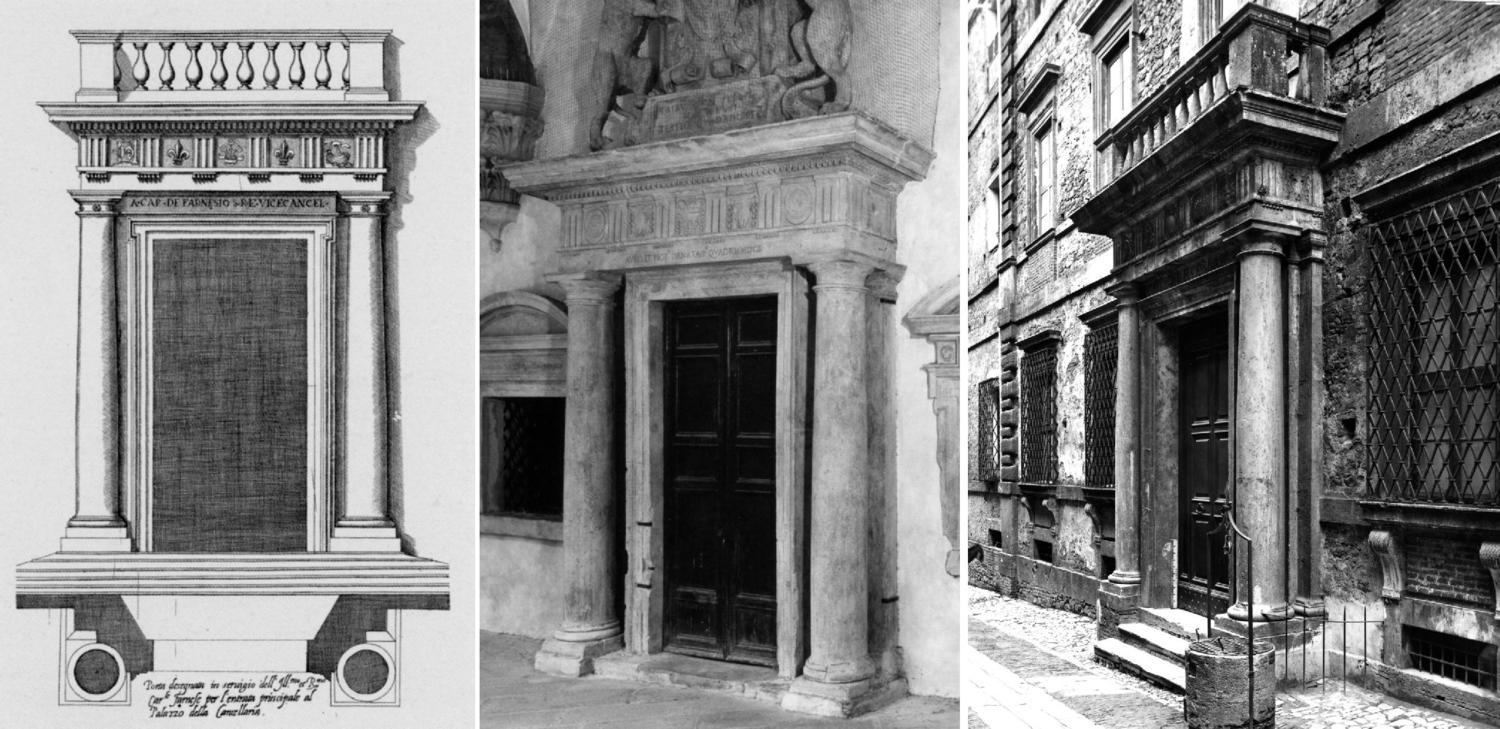
Abb. 2.67: Links: Jacopo Barozzi da
Einen Überblick über die Travertinbau- und -bearbeitungstechnik in

Abb. 2.68: Francesco
Die Steine waren – so berichtet
Vor dem Versatz – so
Eine ausgefeilte Steinschnitttechnik, wie sie sich in der Frühen Neuzeit v. a. in
Ceradini hat im Vorfeld der Restaurierung der Fassade ihren Steinschnitt präzise dokumentiert.748 Mit Hilfe von Abrechnungen, die aber lediglich den oberen Teil der Fassade betreffen,749 konnte Ceradini jeden einzelnen Steinblock identifizieren, seine Einbindetiefe ermitteln und nachvollziehen, wie die Steinblöcke ineinander verkeilt sind. Aus Ceradinis Ausführungen wird deutlich, dass die konstruktive Lösung der vorkragenden Architrave Teil einer ausgefeilten konstruktiven Durchbildung der gesamten Fassade ist. Die Konstruktion der Fassade ist Spiegelbild ihrer Form. Die Fassade übertrifft in Versatzgenauigkeit und technischer Ausführungsqualität insbesondere im Erdgeschoss mit seinem perfekt symmetrischen Steinschnitt den Durchschnitt vergleichbarer Bauten aus dem
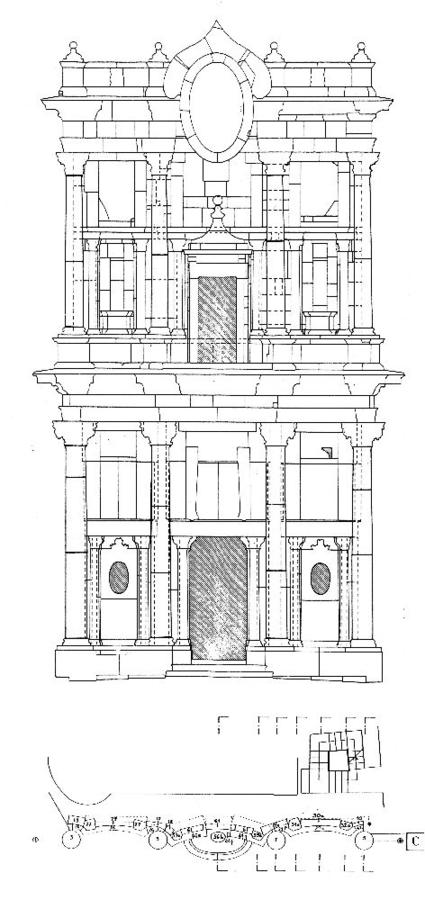
Abb. 2.69: Francesco
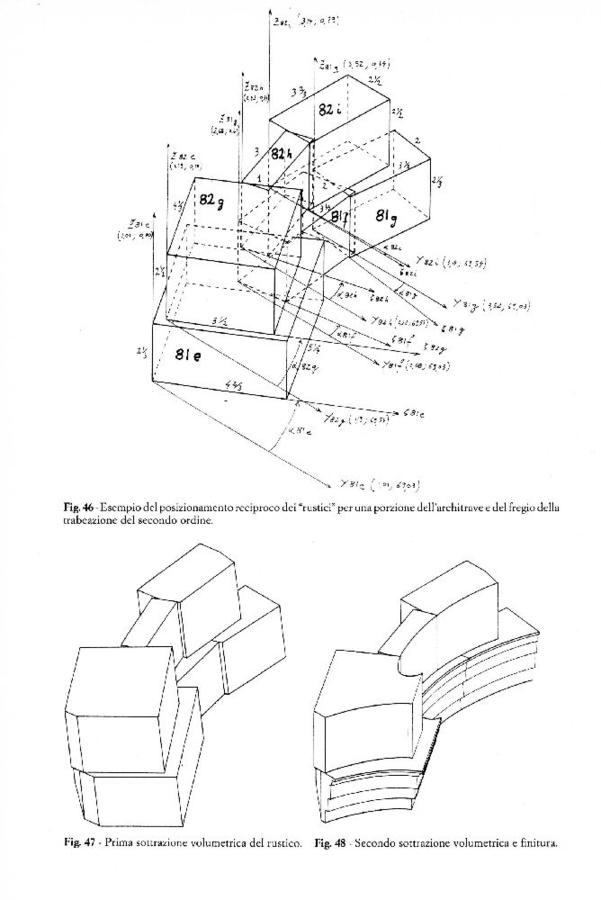
Abb. 2.70: Francesco
Ceradini ist sicher, dass bei der Errichtung der Fassade von San Carlino die Steinblöcke zunächst versetzt wurden und in einem zweiten Schritt die Profile angebracht wurden (Abb. 2.70). Das gehe zwar aus den Schriftquellen nicht hervor, wohl aber aus dem Bauwerk selbst: Denn an einigen Stellen sei die Präzision, mit der die Profilierungen von einem Travertinblock auf den anderen übergehen, höher als die Versatzgenauigkeit der Travertinblöcke.753 Sollte Ceradinis Vermutung stimmen, wäre es interessant, zu ermitteln, wie sich die beiden Verfahrensweisen ,zuerst Profil schlagen – dann Steinblock versetzen‘ und ,zuerst Steinblock versetzen – dann Profil schlagen‘ zueinander verhalten.
In ihrem Fokus zur Kuppel des
2.9.4 Hebezeuge und Baumaschinen
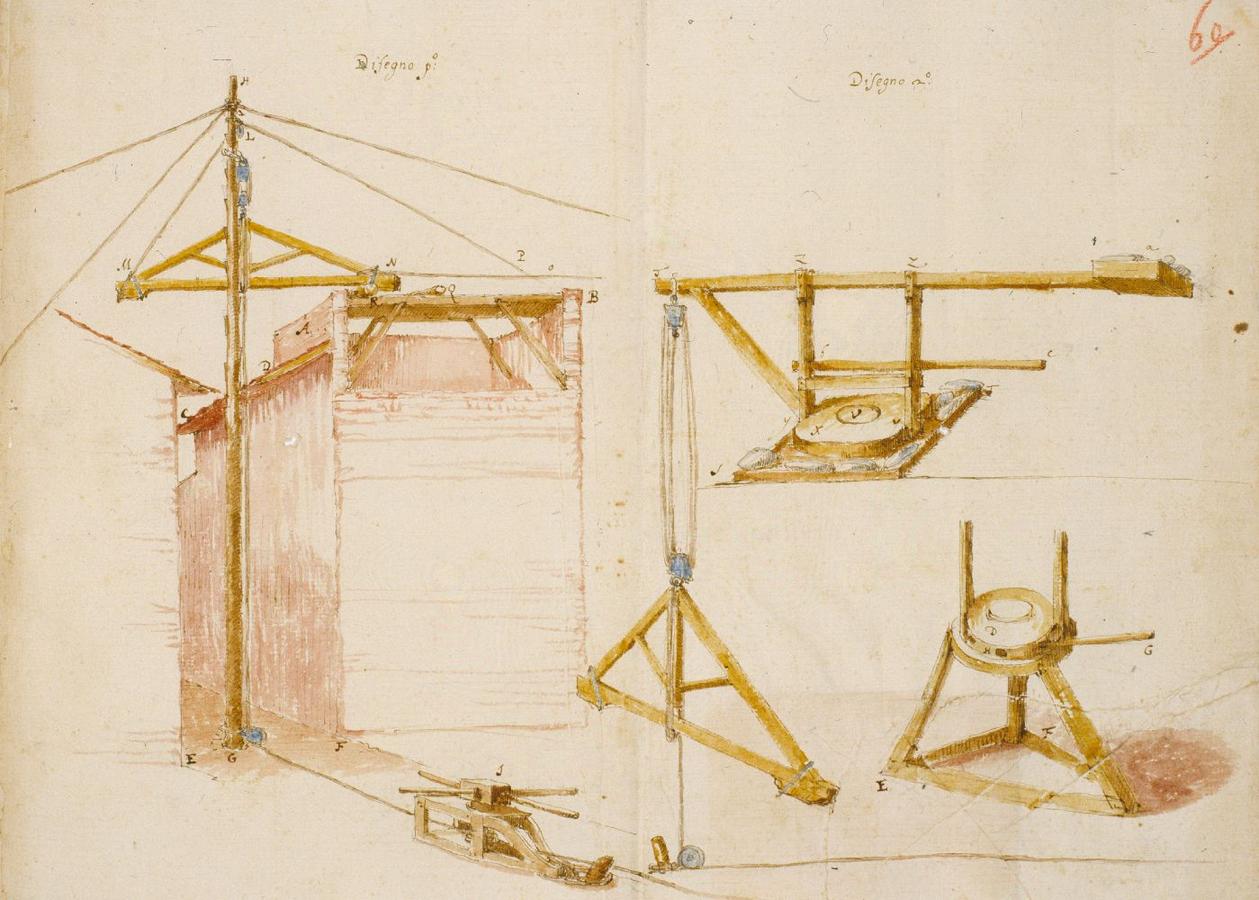
Abb. 2.71: Cosimo
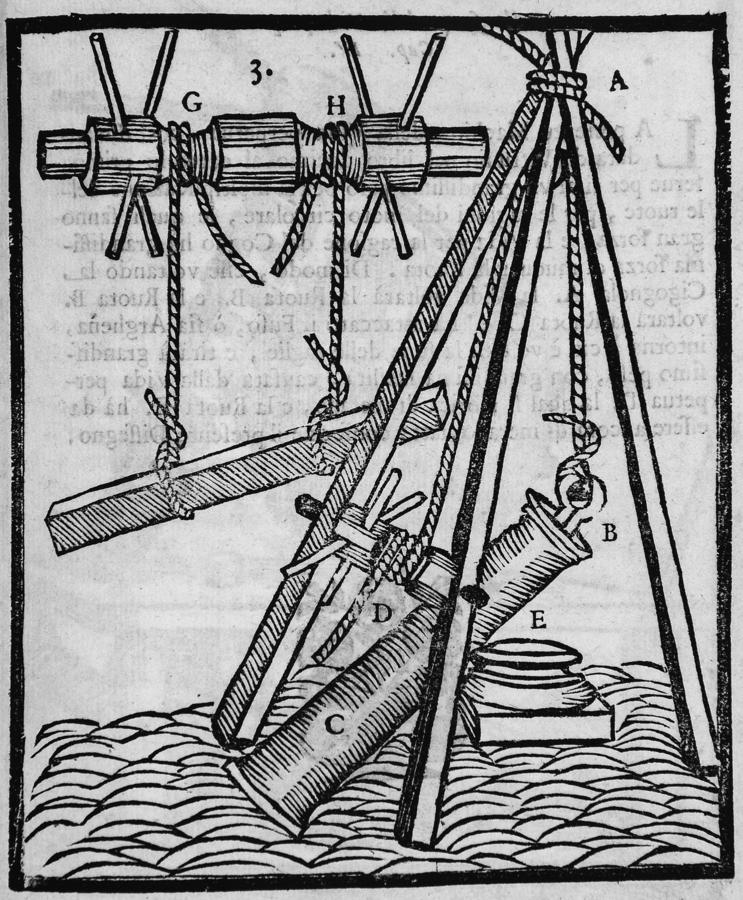
Abb. 2.72: Alessandro
In der Frühen Neuzeit wurden monolithische Säulenschäfte üblicherweise mit Hilfe eines massiven Holzgerüstes (castello) oder unter Einsatz einer capra (s. o.) aufgerichtet. Im Gerüst bzw. am Kran wurde eine Umlenkrolle oder ein Flaschenzug aufgehängt. Darüber wurde ein Seil geführt, an das der an seiner Oberseite mit einem Loch versehene Säulenschaft mit Hilfe eines Wolfes angehängt wurde. Die neuen Säulenschäfte aus pietra serena für San Lorenzo in
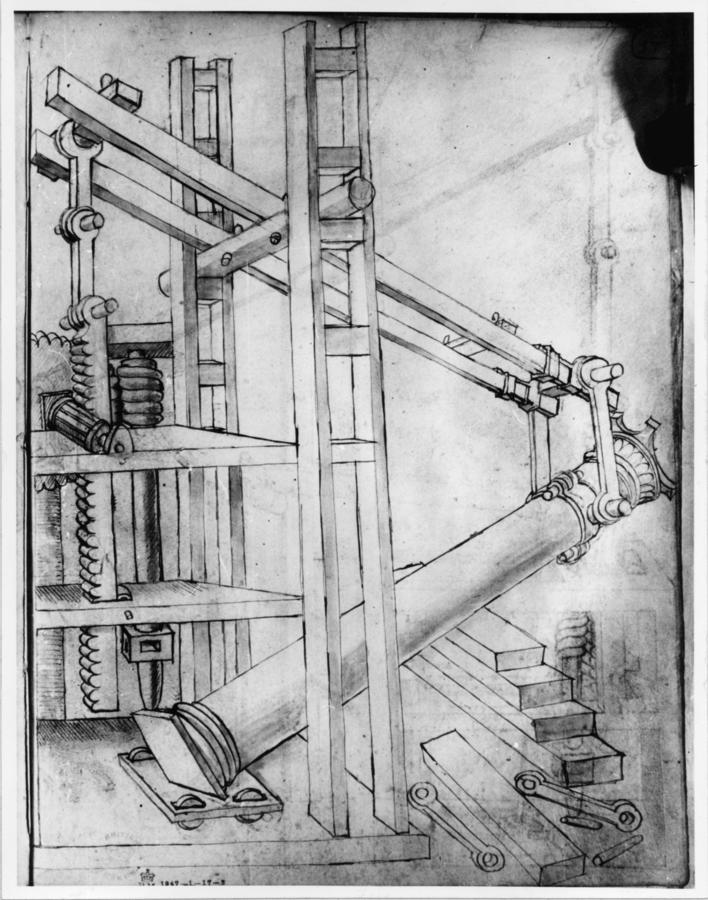
Abb. 2.73: Francesco di Giorgio
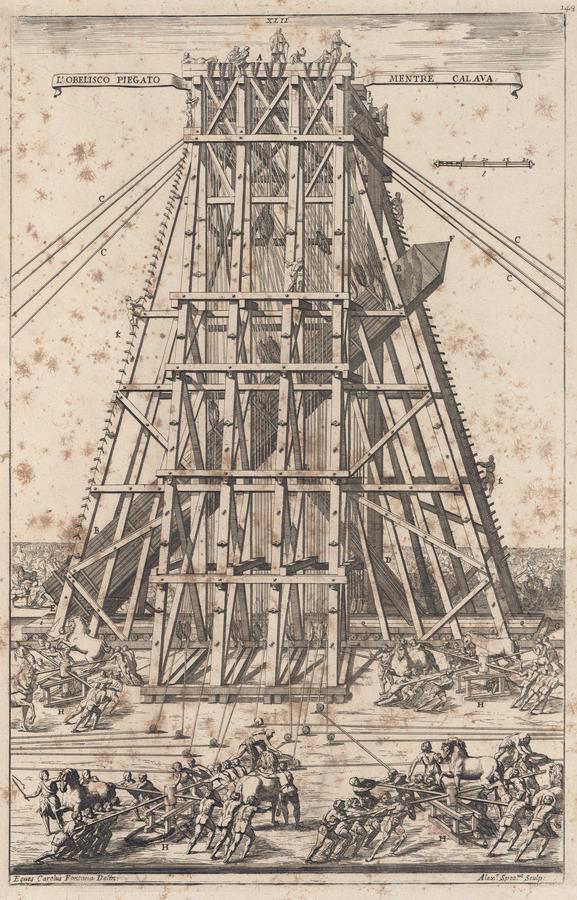
Abb. 2.74: Domenico
Andere Maschinen zum Aufrichten von Säulen, die nicht mit Seilen, sondern mit hölzernen Gewindestangen arbeiteten und die u. a. von Francesco di
Man verfolgte, so vermutet Belli, mit diesen Maschinenentwürfen den Wunsch, eine überlegene antik-römische Maschinentechnologie bzw. zumindest die Vorstellung, dass es eine solche gegeben habe, wieder zu beleben.770 Im 16. Jahrhundert wurden diese Konzepte zunehmend nicht mehr weiter verfolgt; technologische Entwicklung und die oben beschriebene Baupraxis kamen sich wieder näher. Tatsächlich wurden selbst die riesigen Obelisken von Domenico
Für das Versetzen monolithischer Säulenschäfte hat man in der Frühen Neuzeit offenbar dieselbe Technik verwendet wie im antiken
2.9.5 Gewölbe- und Kuppelbau
Während die Kreuzgewölbe (als Kreuzrippengewölbe) auch im Mittelalter durchaus üblich waren, bekamen die Tonnengewölbe, die in den Bauten des Mittelalters allenfalls eine Nebenrolle gespielt hatten, die aber in den antiken Bauten und Ruinen vor Augen standen, in der Renaissance ein ganz neues Gewicht. Römisch-antike Tonnenwölbungen in Triumphbögen oder in der Maxentiusbasilika weisen in aller Regel Kassettierungen auf, die im Mittelalter gänzlich unüblich gewesen waren. Allein im 15. Jahrhundert entstanden Dutzende kassettierte Wölbungen u. a. in

Abb. 2.75: Sant’Andrea,
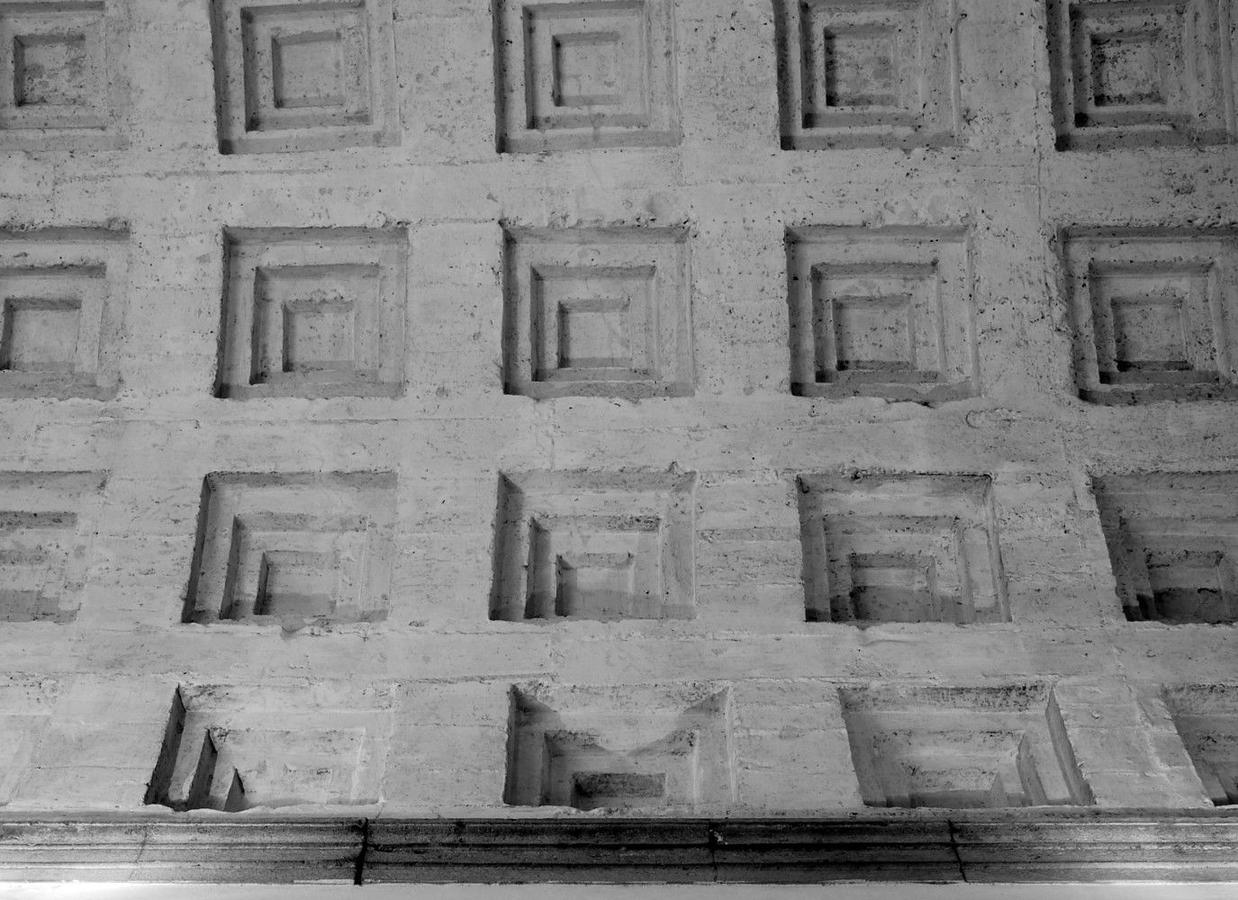
Abb. 2.76: Palazzo

Abb. 2.77: Palazzo
Einfache Klostergewölbe (volta a padiglione), aber vor allem Klostergewölbe mit flachem bzw. nur geringfügig gewölbten Deckenspiegel (volte a schifo,
Lehrgerüste und Lehrbögen waren, wie auch Arbeitsgerüste (siehe oben Abschnitt 2.7), von den Maurern zu erstellen. Der aus Holzbalken gezimmerte Unterbau heißt impalcatura und muss ausreichend robust sein. Die Schale oder Schalung, in die geschüttet wird bzw. auf der gemauert wird, heißt tavolato, besteht aus ca. vier cm dicken Weichholzbrettern (legno dolce). Die Außenseite wird mit dem Beil feinbearbeitet. Die Schale ruht auf gegeneinandergeschlagenen Keilen, so dass sie ohne Schwierigkeiten abgesenkt werden kann. Auch wenn die Lehrgerüste in Traktaten und Zeichnungen öfter abgebildet werden (Abb. 2.78) kommen sie in den Bauabrechnungen kaum vor. Da Gewölbe regelmäßig a tutta roba vergeben wurden (d. h. als Bauaufträge, die schlüsselfertig zu übergeben waren), wurden Details zu den Lehrgerüsten in den Abrechnungen nicht aufgeführt. Wie massiv die
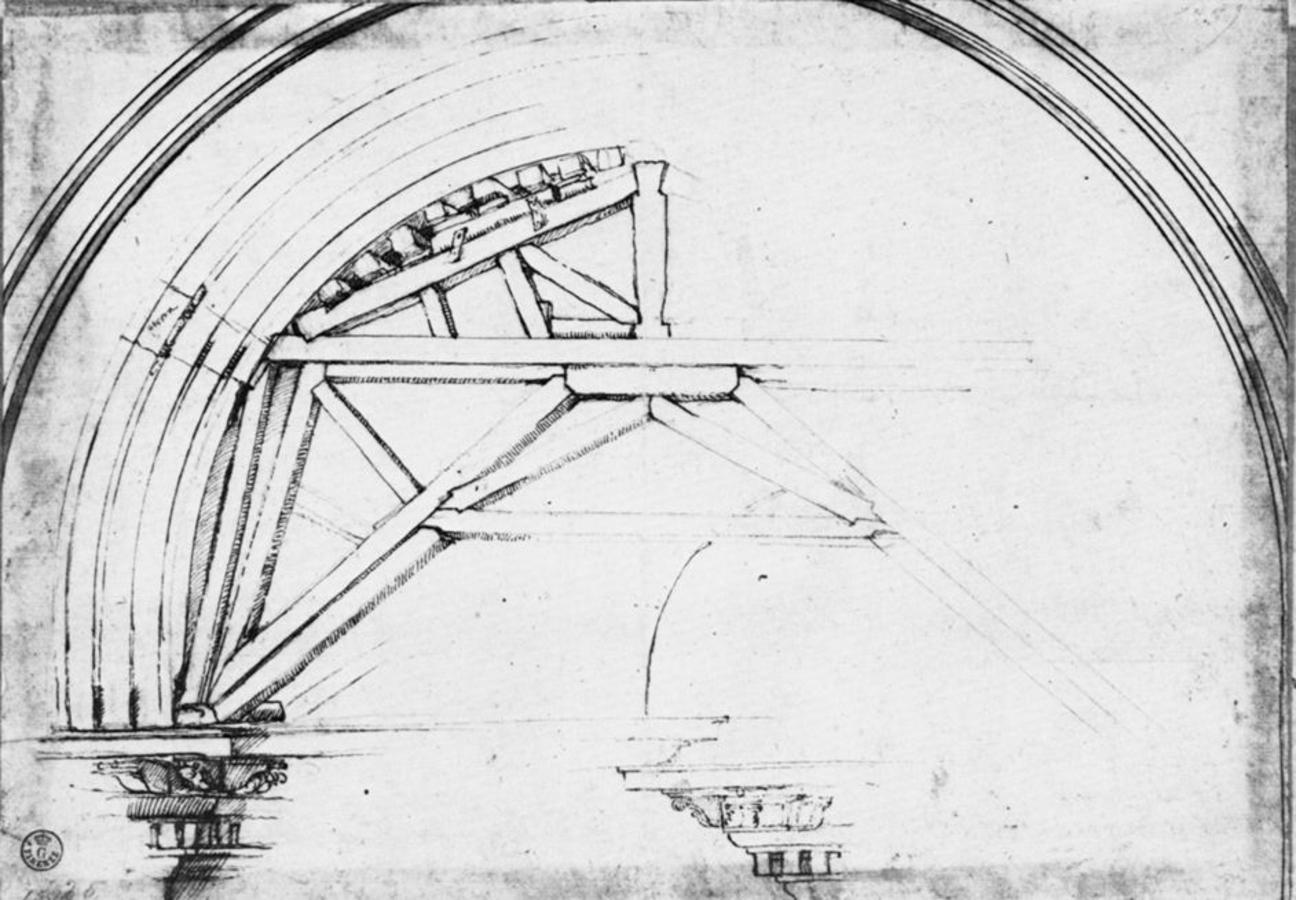
Abb. 2.78: St. Peter,
Ein gut dokumentierter Fall eines
Bei kleineren Wölbungen, wie bei der oben erwähnten volta a schifo im Palazzo Altemps, wurden die Lehrgerüste in vereinfachter Weise errichtet: Eine Art mittig unterstützter, flach geneigter dreieckiger Dachbinder (cavalletto, s. u.) wurde durch die Raummitte gespannt und wurde zu einer Art Zeltdachkonstruktion vervollständigt. Diese bekam dann eine Schalung. Auf die Schalung wurde die Gewölbeform in Ziegelsteinschutt modelliert (pasticcio di scaglie di mattoni), darauf ein Rohrgeflecht verlegt und darauf wiederum das Gewölbe selbst gebaut.789
Die Hängekuppel ist untrennbar mit der geometrischen Form der Halbkugel verbunden und war als Gewölbetypologie Anfang des 15. Jahrhunderts von Filippo
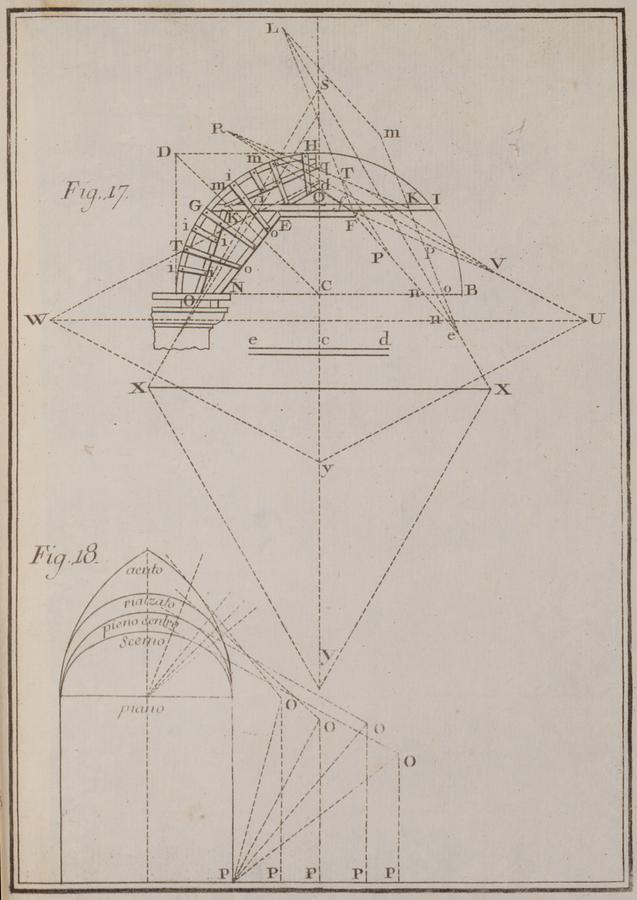
Abb. 2.79: Francesco
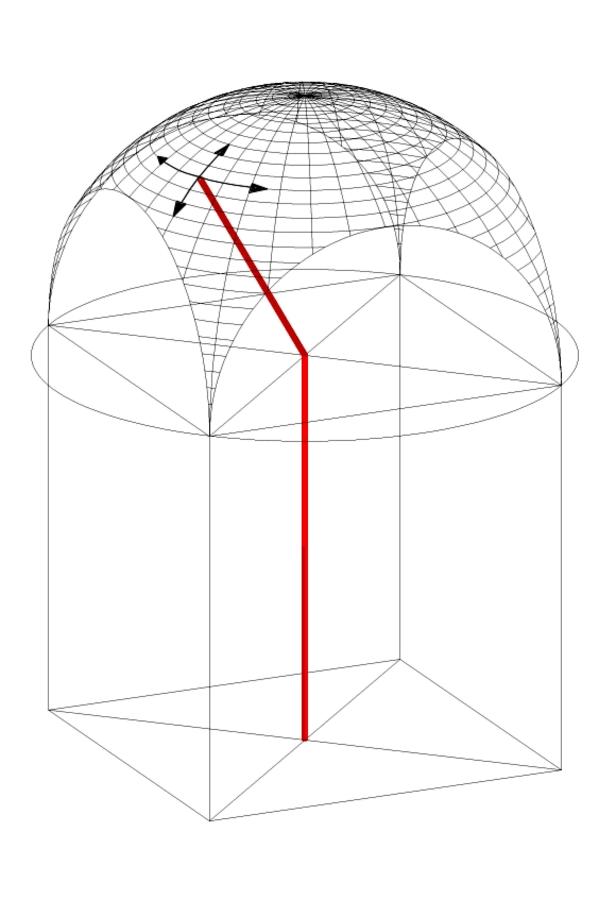
Abb. 2.80: Errichtung einer Hängekuppel, Schema (H. Schlimme).
Wichtigstes Beispiel für eine polygonale Kuppel ist die
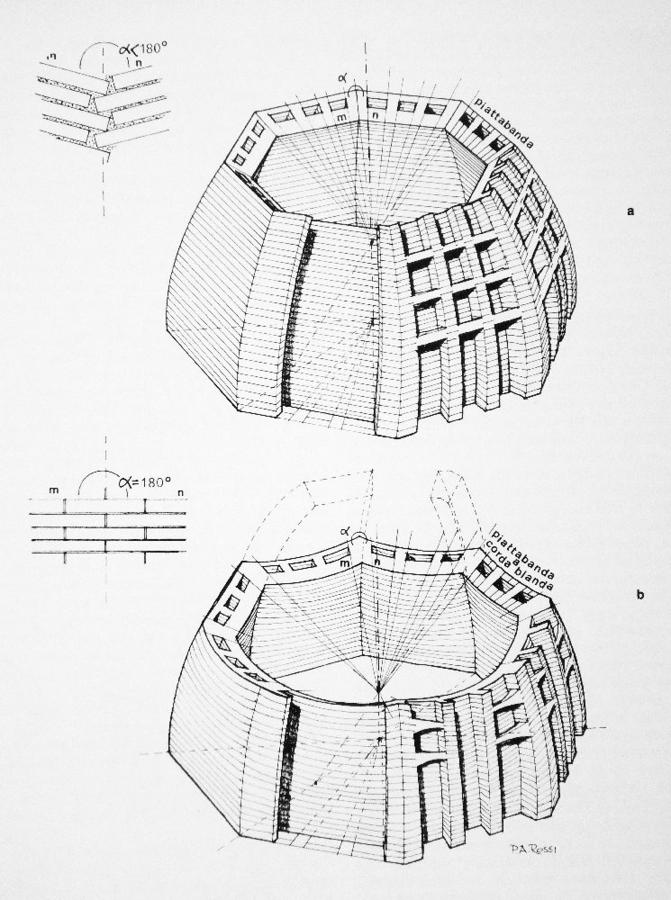
Abb. 2.81: Domkuppel,
Im Gegensatz zur  -Säulen-Paaren, vollständigem Gebälk und Fensteraedikulen voll ausgebildete und ganz aus Travertin hergestellte architektonische Gliederung erhält. Sie ist also ganz auf Außenwirkung angelegt. Damit wird auch die Tambourkuppel, bestehend aus Bögen und Pendentifs (auf Vierungspfeilern), hohem durchfensterten Tambour, Kuppelschale und Laterne kanonisiert. In Rom entstehen sehr viele Tambourkuppeln, allen voran Sant’Andrea della Valle (Carlo
-Säulen-Paaren, vollständigem Gebälk und Fensteraedikulen voll ausgebildete und ganz aus Travertin hergestellte architektonische Gliederung erhält. Sie ist also ganz auf Außenwirkung angelegt. Damit wird auch die Tambourkuppel, bestehend aus Bögen und Pendentifs (auf Vierungspfeilern), hohem durchfensterten Tambour, Kuppelschale und Laterne kanonisiert. In Rom entstehen sehr viele Tambourkuppeln, allen voran Sant’Andrea della Valle (Carlo
Die Gliederung des Äußeren und die Außenwirkung der Peterskuppel sind natürlich lediglich ein Aspekt dieses Bauwerks. Der andere ist die Form der Kuppel, also das Profil. Für eine Kuppel dieser Größe mit 40 m Innendurchmesser standen zwei Vorbilder vor Augen: Zum einen die als Halbkugel ausgebildete Kuppel des Pantheons, deren Horizontalschub u. a. durch den Einbau der Kuppel in einen massiven Mauerwerkszylinder, der als Gegengewicht wirkt, ausgeglichen wird. Das war Vorbild für die in der frühen Renaissance v. a. in
Bei der Peterskuppel gingen die Planungen mehrfach hin und her.796 Der Entwurf des ersten Architekten von St. Peter, Donato

Abb. 2.82: Sant’Andrea della Valle,
Besonders aufschlussreich sind die Peterskuppelentwürfe von Antonio da
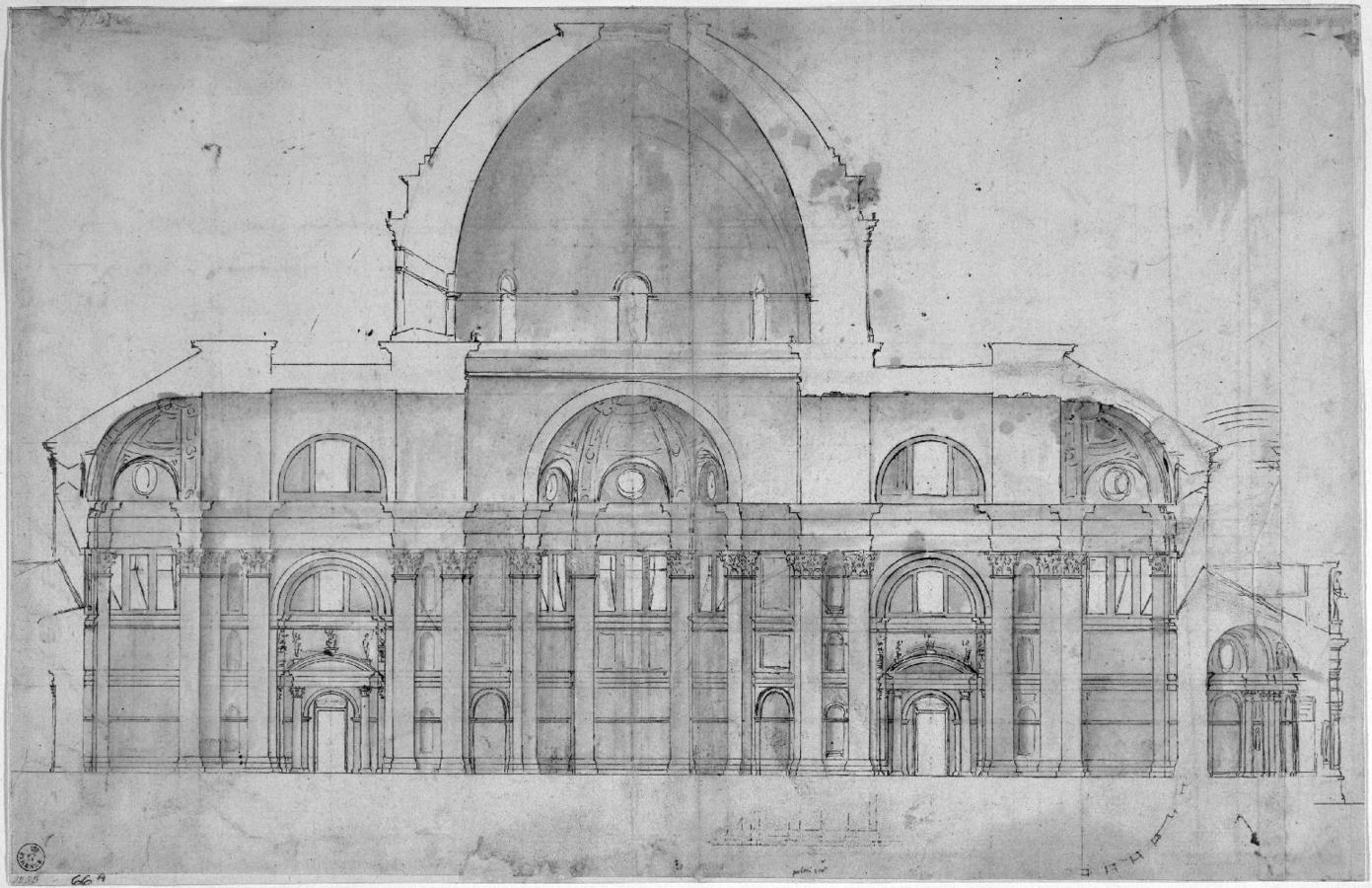
Abb. 2.83: Antonio da
Dieselbe Entwicklung vom Spitzbogenquerschnitt zur kontinuierlich durchlaufenden Querschnittlinie bei Antonio da
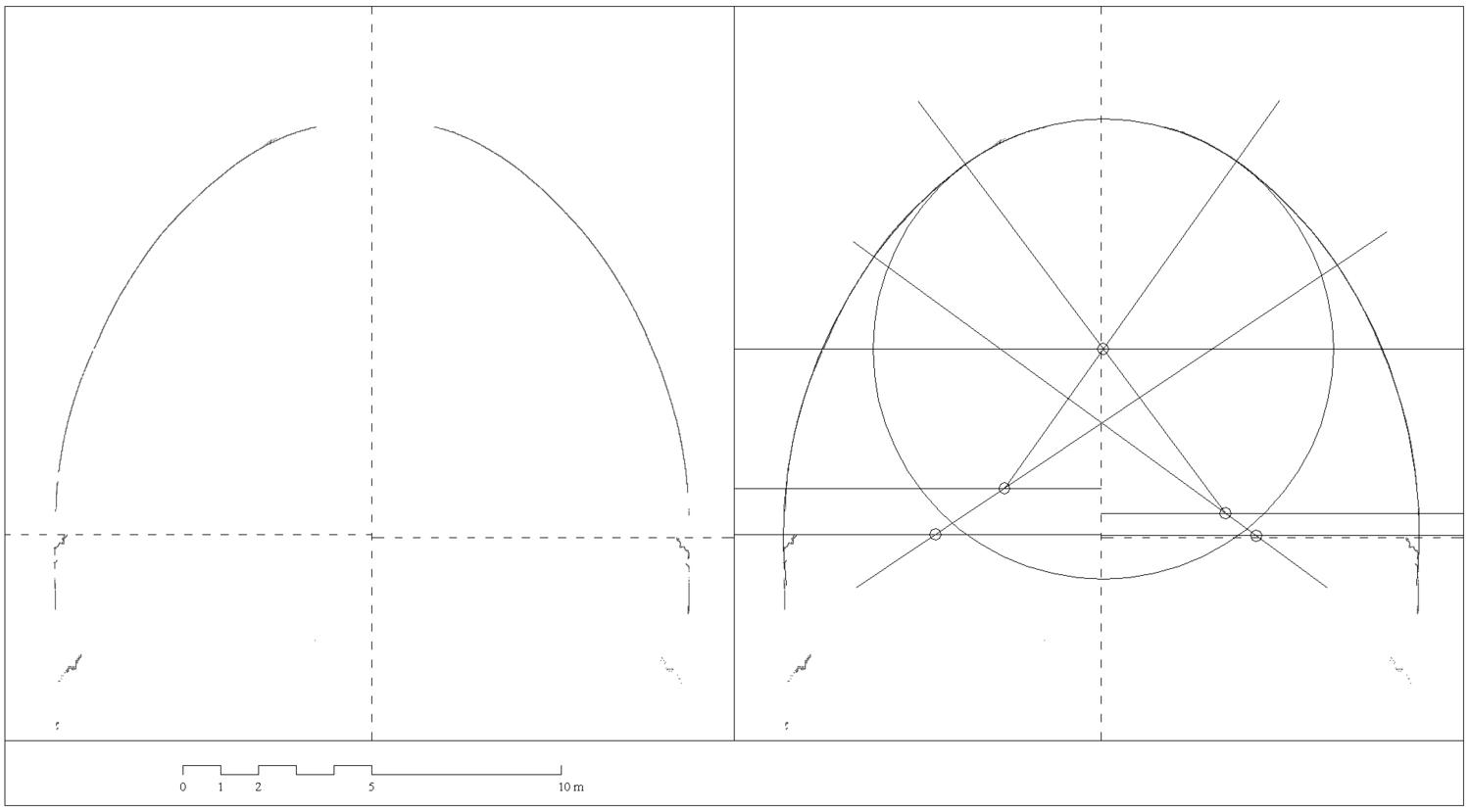
Abb. 2.84: Sant’Andrea della Valle,
Für Sant’Andrea della Valle war in Ermangelung einer genauen Bauaufnahme und auch in den jüngsten Studien immer angenommen worden, dass sie mit Spitzbogenprofil errichtet worden war. Tatsächlich weisen die Kuppeln von Sant’Andrea della Valle und ebenso diejenige von Sant’Agnese in Agone Ovalprofile auf, wie aktuelle Bauaufnahmen zeigen (Abb. 2.84–2.85). Als Architekt der Reverenda Fabbrica di San Pietro hat
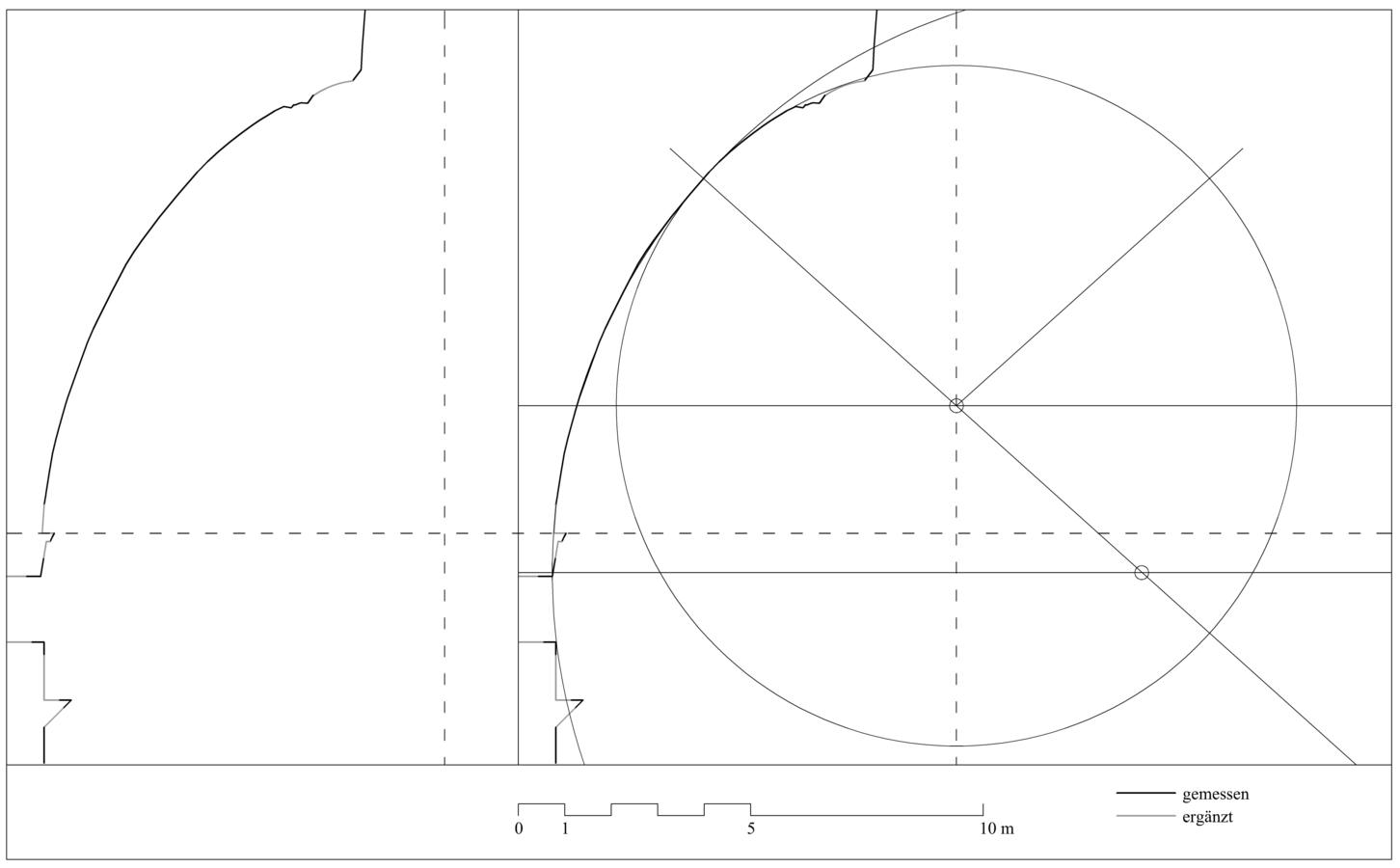
Abb. 2.85: Sant’Agnese in Agone,
Dennoch geriet das Ovalkuppelprofil bald in Vergessenheit. Bereits Carlo
Tambour und Kuppel von Sant’Andrea della Valle wurden vermutlich zum Teil aus tevolozza, zum Teil aus neuen Ziegelsteinen errichtet. Zum Einsatz kam der in
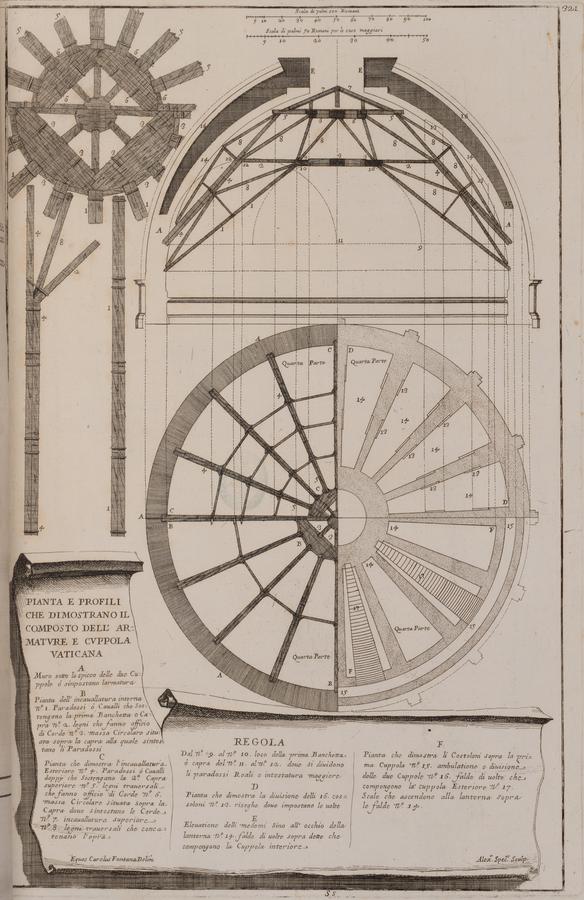
Abb. 2.86: Carlo
Während die
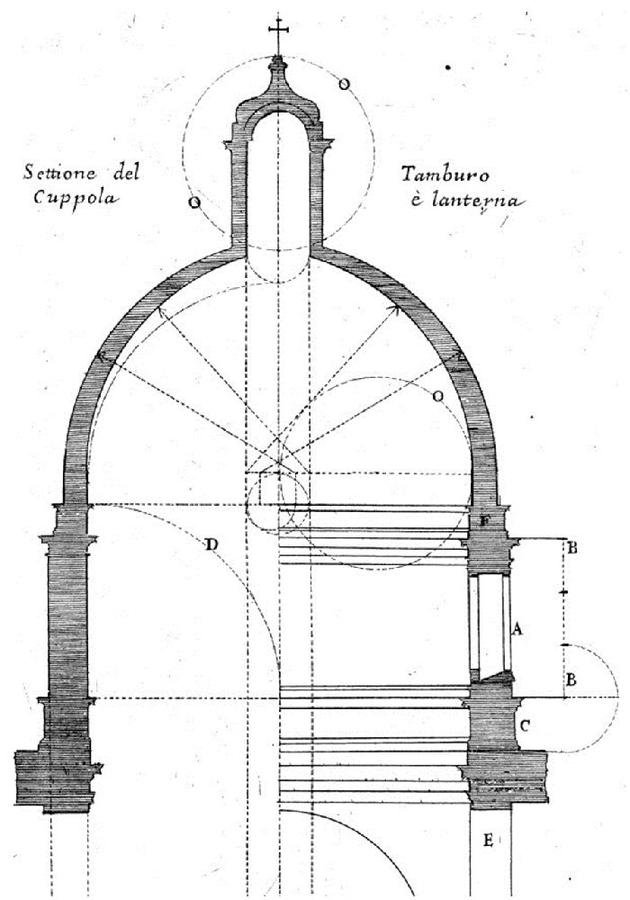
Abb. 2.87: Carlo
Die Innenoberflächen der Kuppelschalen wurden regelmäßig mit himmelsdarstellenden Fresken ausgemalt. Wichtige Beispiele sind Sant’Andrea della Valle (Giovanni
Das Kuppelbauwissen war bis ins späte 17. Jahrhundert weitgehend ungeschrieben geblieben.
2.9.6 Dachstühle aus Holz
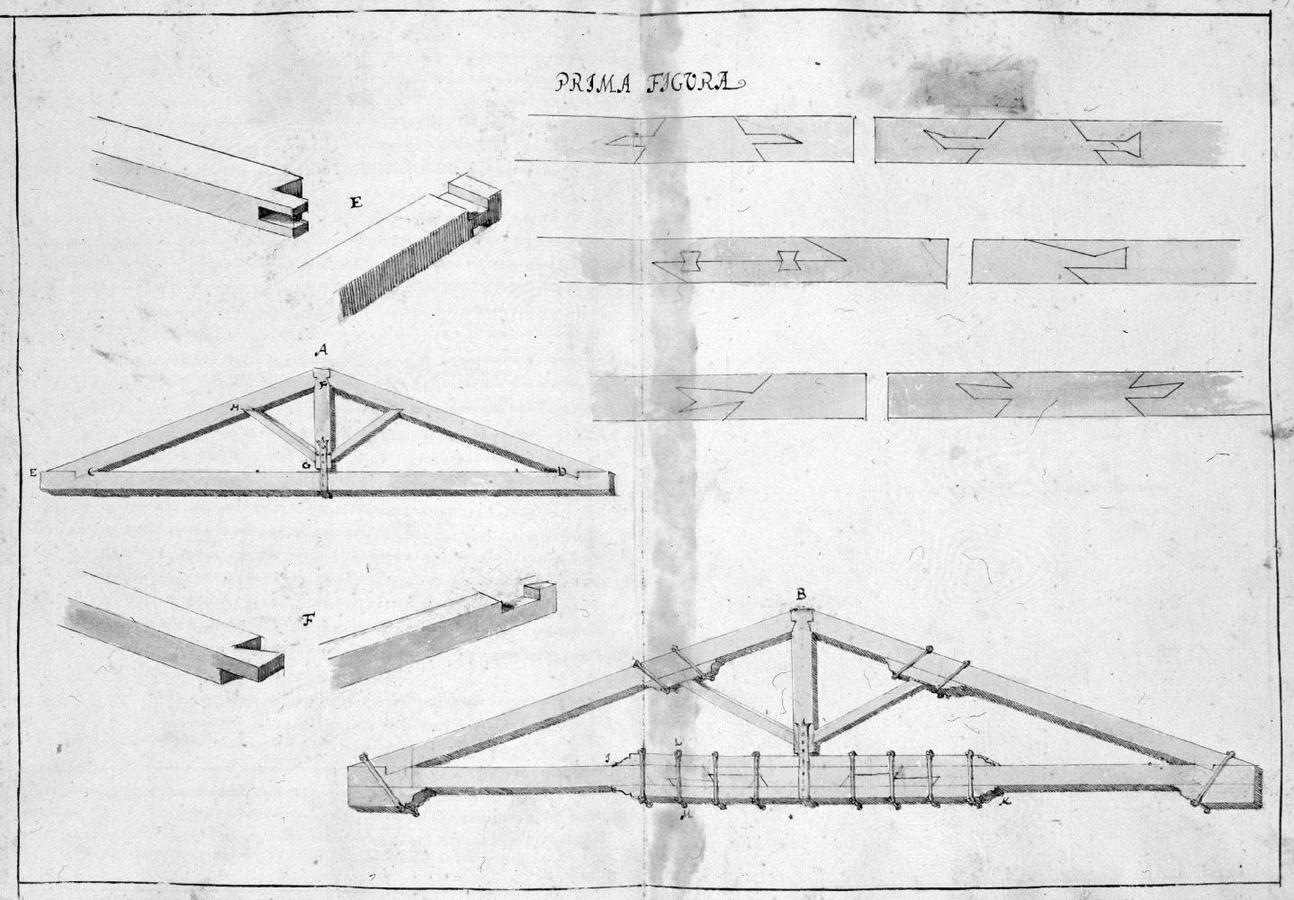
Abb. 2.88: Cosimo
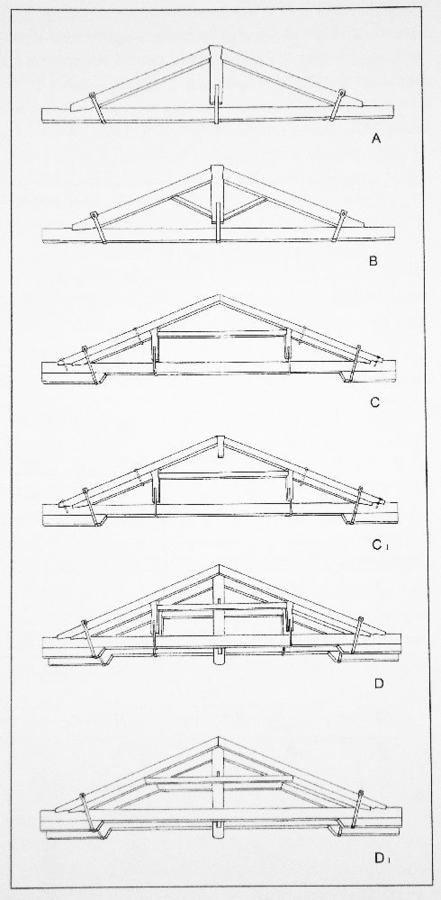
Abb. 2.89: Simona Valeriani, Die Grundtypen der in

Abb. 2.90: Sant’Andrea della Valle,
2.9.7 Mess- und Aufschnürungstechniken
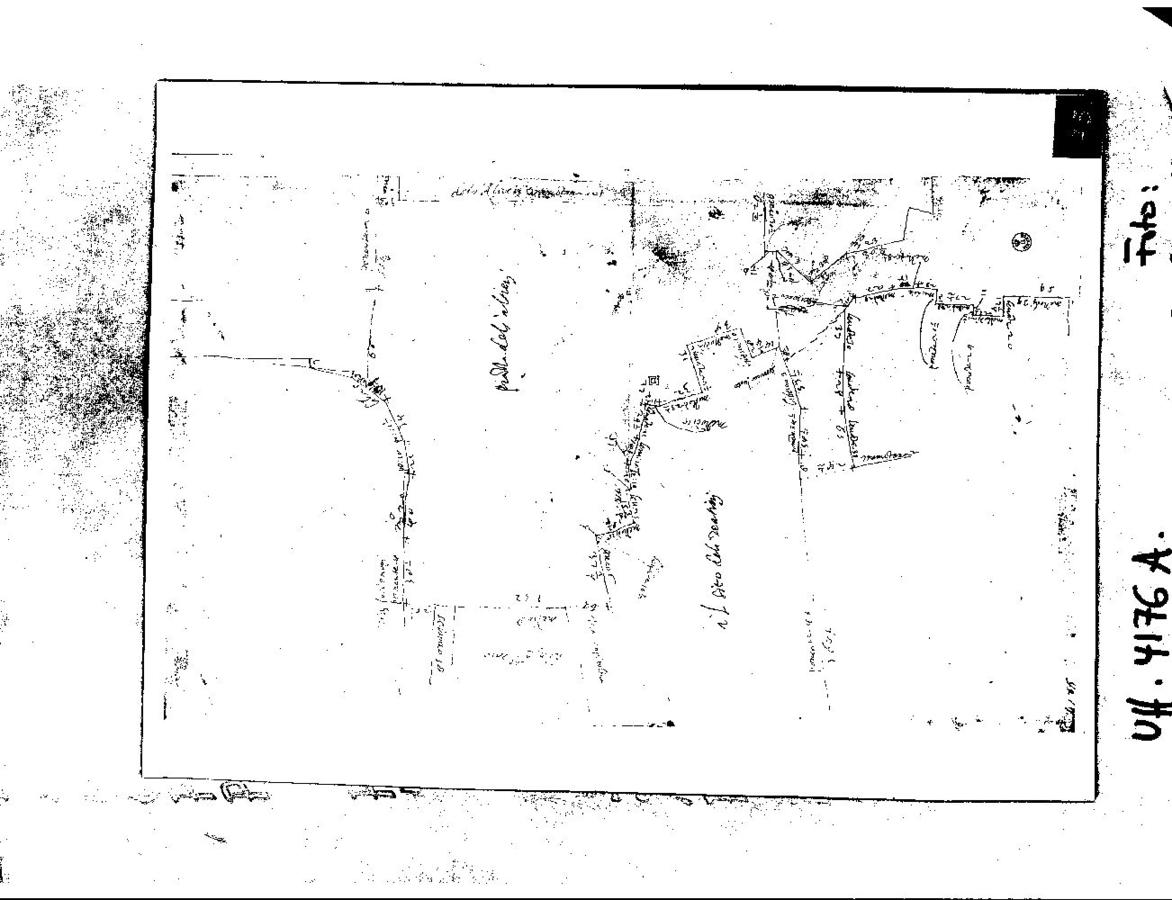
Abb. 2.91: Bartolomeo
Ein weiteres Anwendungsfeld für

Abb. 2.92: Antonio
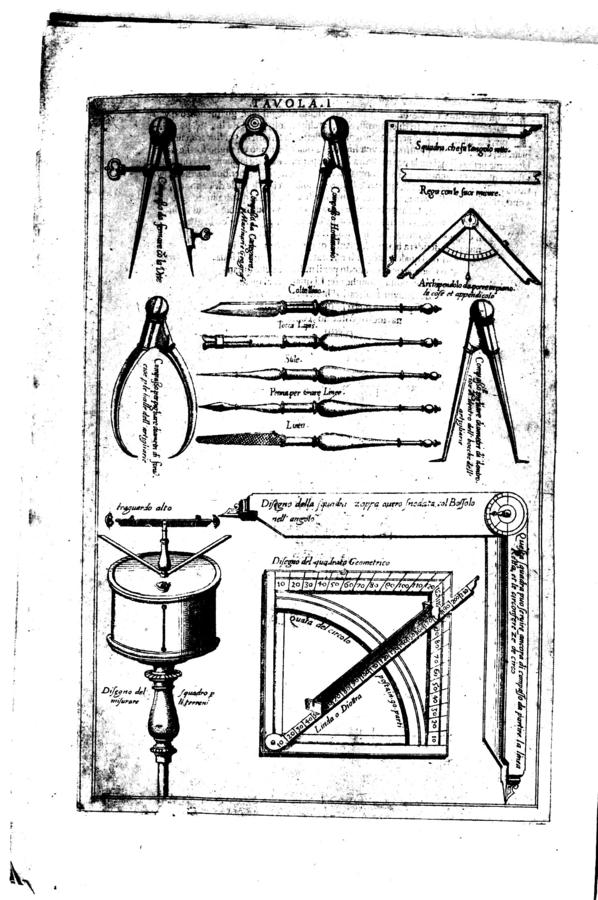
Abb. 2.93: Giovanni
Ein Beispiel für ein
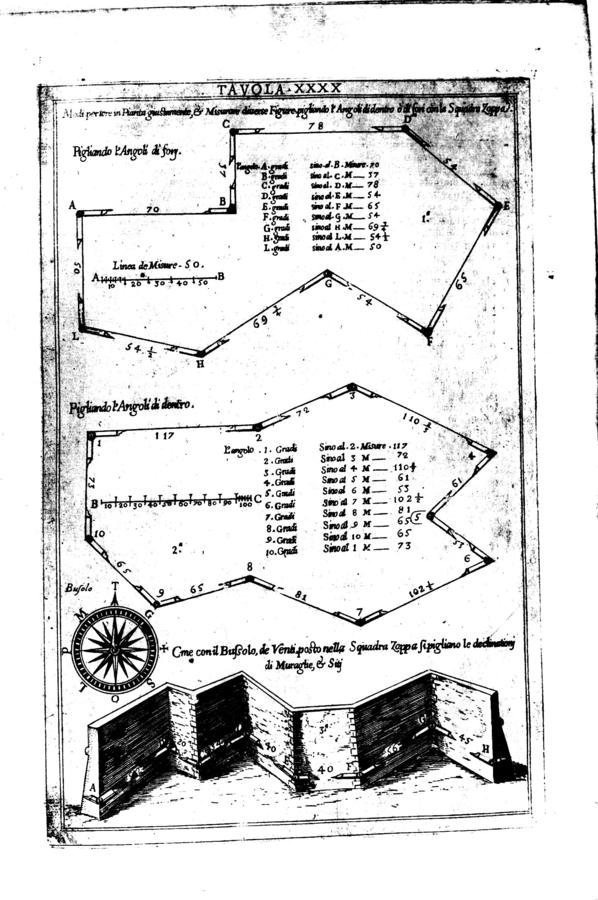
Abb. 2.95: Giovanni
Die Aufnahme bestehender Bauten und Situationen ist über die gezeichneten Ergebnisse zumeist gut dokumentiert. Anders sieht es beim Abstecken zu errichtender Bauten aus. Dort kann in der Regel lediglich auf Schriftquellen zurückgegriffen werden. Diese systematisch zusammenzutragen, wäre ein Desiderat. Zwei Beispiele für solche Quellen seien hier benannt. In der ersten, in das Jahr 1475 datierten Quelle bittet der Marchese Lodovico II.
2.9.8 Statik
2.9.9 Festungsbau
Ausgehend vom
2.10 Bauleute und Bauprozess
In weiten Teilen des Bauwesens ist in der Frühen Neuzeit eine Ausdifferenzierung der Arbeitsteilung bzw. eine Professionalisierung zu beobachten. Im 15. und vor allem im 16. Jahrhundert führten die Dimension einzelner Projekte und der Wunsch gegenreformatorischer Auftraggeber nach rascher Ausführung dazu, Aufträge zu teilen und nach Ausschreibung (auf der Grundlage der bereits erwähnten Massenberechnungen) in Form von schlüsselfertig zu erstellenden Bauabschnitten zu vergeben. Dieser Übergang von einer Bezahlung nach Tagelohn hin zu einer Bezahlung nach Werk brachte Vorteile für Handwerker, die sich in compagnie, also Baugesellschaften/Baufirmen, zusammenschlossen, um die teilweise großen Aufträge schultern zu können. Die compagnie mussten den ganzen Ablauf von der Materialgewinnung bis zur Übergabe beherrschen, hatten aber die Möglichkeit, die Leistung selbst zu erbringen bzw. ganz oder teilweise weiterzuvergeben. Zu den nach dem Niveau des Fachwissens organisierten Hierarchien Meister – Geselle – Lehrling kamen jetzt neue, auf der organisatorisch-logistischen Ebene angesiedelte Hierarchien, nämlich Auftraggeber – Auftragnehmer. Mit der compagnia entstand aber nicht zuletzt auch ein neuer Wissensraum. Die schlüsselfertige Erstellung von Bauteilen dürfte die compagnie angespornt haben, Bautechniken zu verbessern und neue logistische Methoden zu entwickeln, um Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Auch Transportwesen und
Die Trennung von Planung und Realisierung führte zudem zu einer Trennung von Entscheidungskompetenzen. Zum einen gab es Entscheidungen, die beim Entwurf eines Bauwerks vom Architekten getroffen wurden und zum anderen solche, die im Laufe der Realisierung auf der Baustelle gefällt wurden. Dabei zeigt sich, dass den
2.11 Arten des Wissens und ihre Tradierung
2.11.1 Grundlegende Quellen des Wissens
Natürlich sind auf der Baustelle immer wieder ad-hoc Lösungen erforderlich, die man improvisieren musste und nicht mit den Standardbauweisen, also nach Stand der Technik handhaben konnte. Das war etwa erforderlich, wenn übliche Bautypen in größerer Dimension zu errichten waren oder wenn neue Formensprachen oder Bauaufgaben realisiert werden mussten. Wie unten (Abschnitt 2.12.2) anhand von Beispielen ausführlich dargestellt wird, war das regelmäßig Anlass für
Weitere spezifische Quellen des
Auch
2.11.2 Existenzformen des Wissens und ihre Tradierung
Personales Wissen
Auch die Planungspraxis der Architekten ist vielfach personales Wissen, etwa das Wissen darum, wie eine Entwurfsidee im Hinblick auf die Bauausführung zu entwickeln ist, in einer Zeichnung oder in einem Modell darzustellen ist und welche Informationen und Entscheidungen darin zu treffen sind.861 Dieses Wissen eigneten sich die angehenden Architekten in der Frühen Neuzeit ebenfalls on the job an, etwa indem sie für und mit Carlo
Objektiviertes Wissen in Schriften
In die Kategorie „Objektiviertes Wissen in Schriften und Bildern“ gehören in der Frühen Neuzeit Traktate, gedruckte Bücher, Manuskripte, Einzelstiche, Stichpublikationen. Über Schriften wird das Wissen Dritten zugänglich, ohne dass diese die Erfahrungen selbst machen mussten. Dieses Wissen kann auch über räumliche und/oder zeitliche Distanz in anderen Kulturkreisen rezipiert werden. Die Entwicklung des Buchdrucks und der graphischen Vervielfältigungstechniken wie Holzschnitt oder Kupferstich verstärkten diesen Effekt in der Frühen Neuzeit. Große, oftmals öffentlich zugängliche Bibliotheken entstanden ebenso wie der Wunsch, alles vorhandene Wissen in gedruckter Form zusammenzustellen. Die Architekturtraktate und kommentierten
Was gab es für Schriften im
Lehrbücher
Der Leser mag den Eindruck gewinnen, durch die Lektüre des Buches das Entwerfen erlernen zu können. Das ist von
Neben der Theoretisierung von Entwurfsprozessen wurde in den Traktaten vor allem die antike Architektursprache systematisiert. Das Studium der Antike in Nachzeichnungen (Abb. 2.6) war für Architekten geboten, die bei den Auftraggebern, die all’antica leben wollten, Erfolg haben wollten. Diese Studien bauten aufeinander auf, wie Hubertus Günther nachvollzogen hat.866 Sebastiano
Neben diesen Traktaten gab es weitere Architekturpublikationen mit didaktischem Charakter. Im 17. und frühen 18. Jahrhundert wurde insbesondere die neuzeitlich römische Architekturkultur in Publikationen und Vorlagenstichen verbreitet. Beispiele dafür sind Valerien Regnarts Publikation aus dem Jahre 1650, das von Giovanni Giacomo de
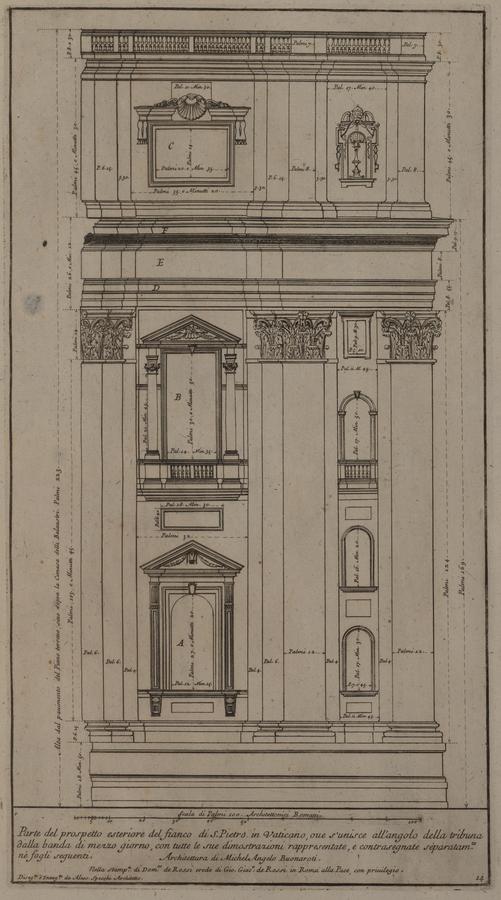
Abb. 2.96:
Die Bibliotheken der Architekten
Objektiviertes Wissen in Bauwerken

Abb. 2.97: Bartolomeo
Institutionalisiertes Wissen
2.12 Wissensentwicklung und Innovation
2.12.1 Das Verhältnis von Theorie und Praxis

Abb. 2.98: Carlo
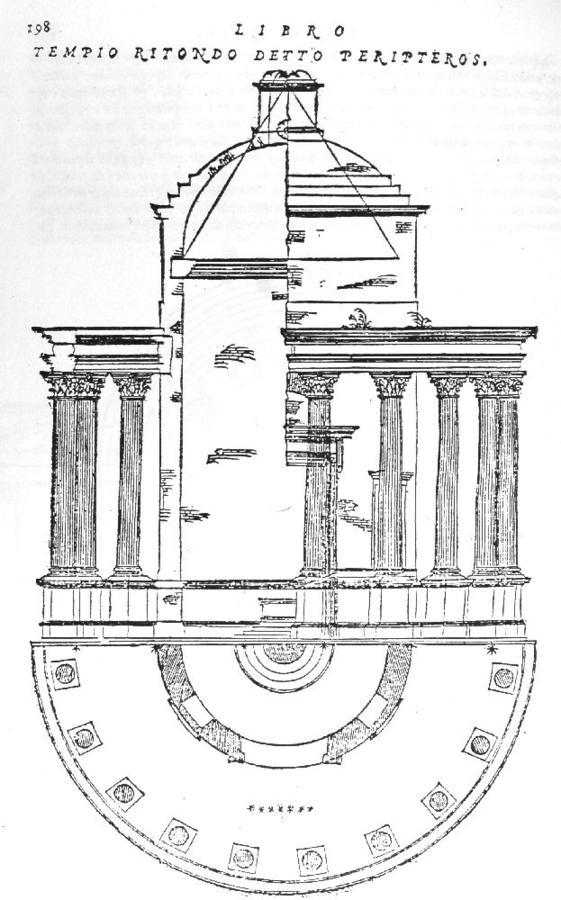
Abb. 2.99: Daniele
Ein Beispiel für die theoretische Erfassung in der Praxis bereits gut kontrollierter Sachverhalte sind Gutachten, Verteidigungsschriften, bei denen Bautechniken erläutert oder verteidigt und dabei oft erstmals schriftlich gefasst wurden. Nicht selten mündeten solche Schriften in Veröffentlichungen.879 Ein Beispiel für solche Verschriftlichungsprozesse sind die Kuppelbauregeln von Carlo
2.12.2 Innovations-Anstöße: Interaktionen von praktischem und theoretischem Wissen
Theoretisches Wissen entsteht, wenn über menschliche Handlungsweisen nachgedacht wird. Theoretisches Wissen kann das Resultat systematischer Reflektion über die römisch-antike Architektur sein, wie sie von der Architekten der Renaissance unternommen wurde, also das Wissen über Formensprache und Bautypologien der römisch-antiken Architektur. In der Regel wird theoretisches Wissen schriftlich oder bildlich dargestellt und dabei abstrahiert und oftmals verallgemeinert. Das macht theoretisches Wissen austauschbar auch ohne dass sich Menschen direkt begegnen, d. h. es lässt sich in andere kulturelle, historische und naturräumlich-geographische Kontexte transferieren, ist insgesamt einfacher zu verbreiten und leichter mobil als praktisches Wissen. Diese Charakteristik wurde durch Buchdruck und graphische Vervielfältigungsverfahren seit dem 15. Jahrhundert verstärkt.
Aus den Definitionen wird deutlich, dass die Verbreitung der Wissenskategorien ,praktisch‘ und ,theoretisch‘ mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten stattfindet – und das sorgt für Reibung. Was bedeutet das für das Bauwesen? Könnte die Interaktion von Wissensbeständen, die unterschiedlichen
Ein gutes Beispiel dafür ist die bereits oben (Abschnitt 2.9.5) erwähnte Kassettierung von Kuppeln und Tonnenwölbungen.883 Sie standen in antiken Bauten und Ruinen besonders eindrucksvoll vor Augen. Über Dokumentationen in Manuskripten und Traktaten verbreitete sich die Formensprache der Kassettierungen schnell in ganz
Ein weiteres Beispiel soll eine Interaktion über eine räumliche Distanz vorstellen. Die Übertragung von in der Frühen Neuzeit in
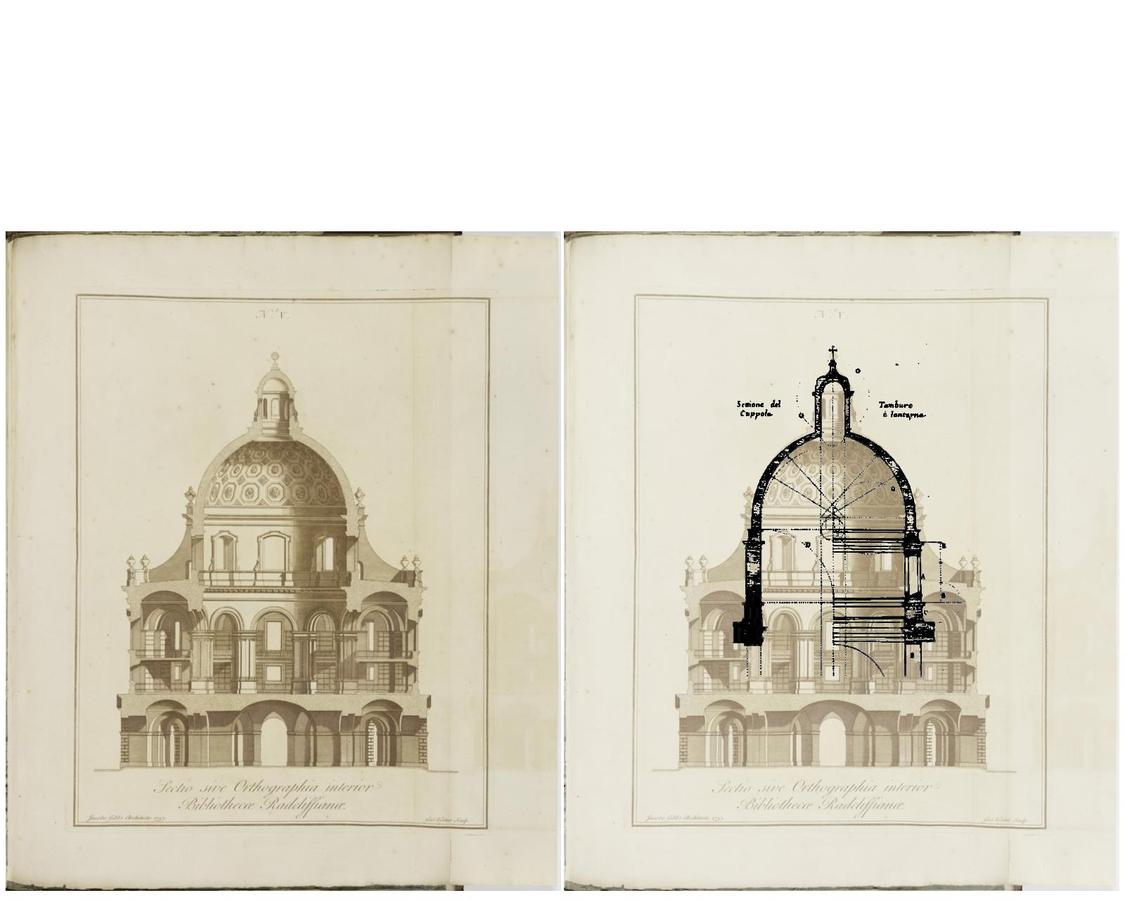
Abb. 2.100: James
James

Abb. 2.101: James
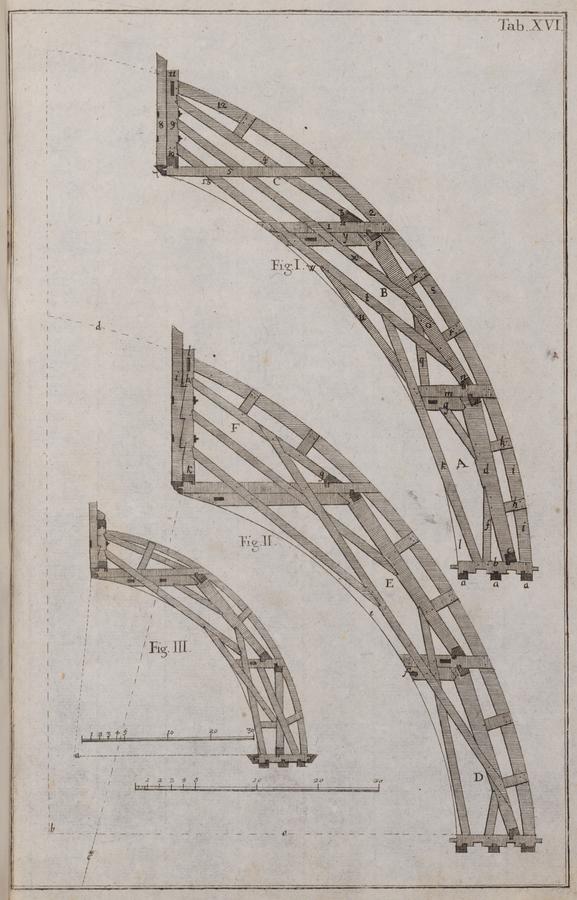
Abb. 2.102: Caspar
Auch für die Kuppeln der Peterskirche (ab 1702) und der Karlskirche (1715–1737) in
Wir haben Beispiele gesehen, bei denen eine Formensprache oder ein Bautyp in andere Epochen und Kulturräume importiert und die lokale Bautechnik adaptiert wurde. Der Import von Formen kann eben rasch über Traktate und Stiche erfolgen, während – wie oben aus den Definitionen deutlich wurde – die Mobilität des praktischen Wissens um die Bauausführung immer den Transfer von Fachleuten erfordert. Es gibt aber auch viele Fälle, wo das Wissen um die Bauausführung in andere Regionen vermittelt wurde. So haben die zahlreichen Bauleute, die aus der
2.12.3 Innovations-Anstöße: Interaktion zwischen Bauwesen und entstehender moderner Naturwissenschaft
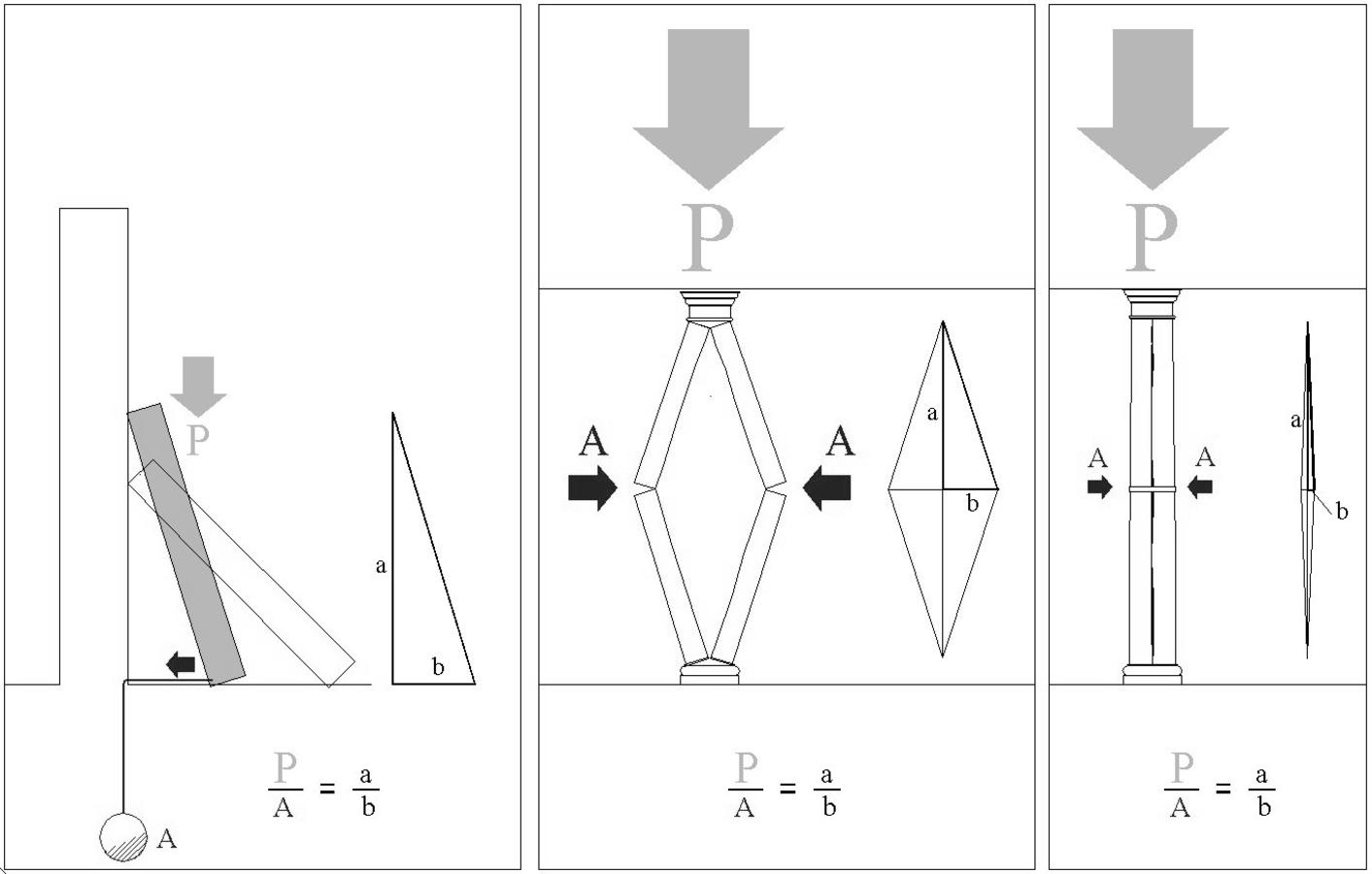
Abb. 2.103: Evangelista
Die Akademie war ein öffentlicher Diskussionszirkel, bei dem Professoren der Mathematik und Naturwissenschaft, Künstler, Architekten, Ingenieure sich außerhalb ihrer Institutionen bewegten. Die Akademie lebte von der Diskussion zwischen Leuten unterschiedlicher Ausbildung. Die anlässlich der Neuerrichtung des Daches von San Giovannino in
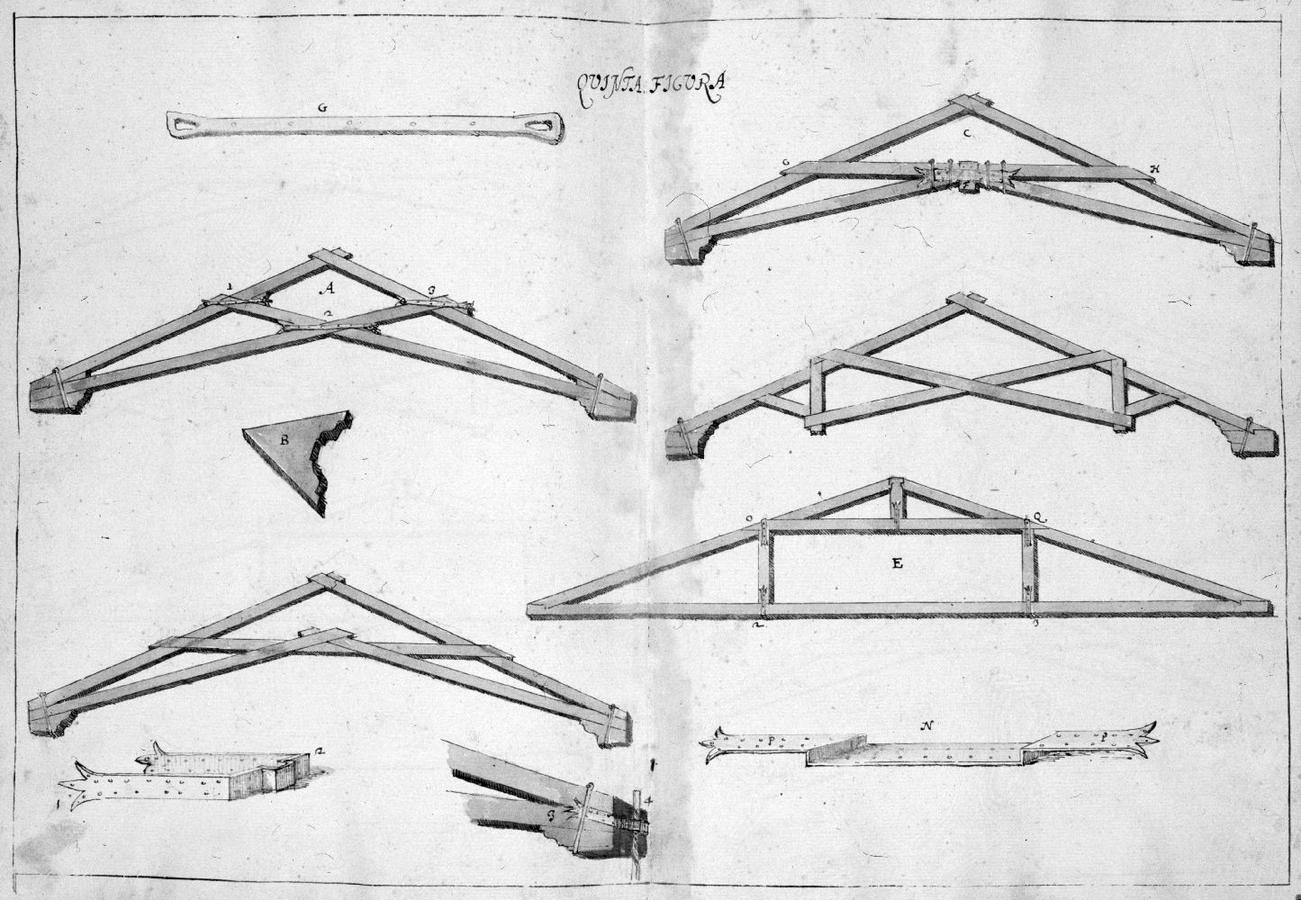
Abb. 2.104: Cosimo
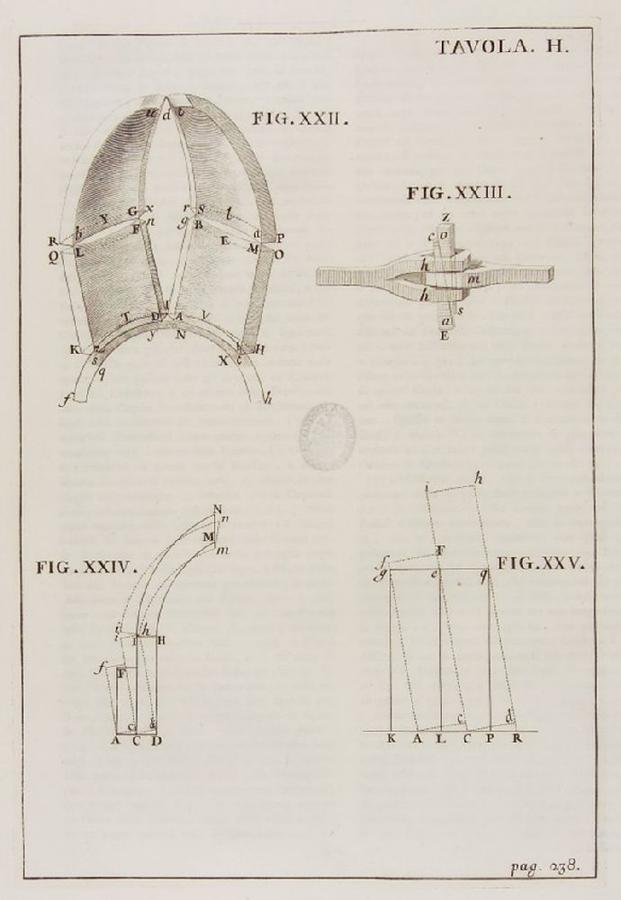
Abb. 2.105: Giovanni
Auch in
Aus dieser empirischen Herangehensweise ergab sich auch eine neue Vorstellung von der Standfestigkeit von Bauten (vgl. Becchi im vorliegenden Band: „Fokus: Architektur und Mechanik“). Besonders aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist eine kurze Abhandlung von Evangelista
Anhand dieser Episode werden wesentliche Aspekte der naturwissenschaftlichen Herangehensweise an das Bauwesen deutlich. Den Handwerkern reicht es in der Regel, dass eine Bautechnik funktioniert.
Philippe de La
Es ist interessant zu beobachten, wie dieses Berechnungsverfahren von den praktischen Bauleuten mit ihrem Erfahrungswissen angegriffen wurde. Im Rahmen der Begutachtung der Schäden an der Peterskuppel in den Jahren 1742/43 waren ca. 20 Gutachten und Gegengutachten entstanden, unter anderem dasjenige des Architekten Lelio
Zwar finden aus heutiger Sicht in den Gutachten der Mathematiker die interessanten Dinge statt, aber damals wurde das durchaus nicht so gesehen.
Bibliographie
Adam, J.-P. (1988). L’arte di costruire presso i Romani. Materiali e tecniche. Mailand: Longanesi.
Adams, N. (2002). L’architettura militare in Italia nella prima metà del Cinquecento. In: Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento Ed. by A. Bruschi. Mailand: Electa 546-561
Addis, B. (2007). Building. 3000 Years of Design Engineering and Construction. London: Phaidon.
Adorni, B. (2002). L’architettura militare in Italia nella prima metà del Cinquecento. In: Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento Ed. by A. Bruschi. Mailand: Electa 546-561
Ait, I., M. Vaquero Piñeiro (2000). Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Leni: uomini díaffari del Rinascimento. Rom: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici.
Alberti, L. B. (nodate). De pictura, 1436. In: Opere volgari Ed. by C. Grayson. Laterza 5-107
- (1485). Leonis Baptistae Alberti Florentini viri clarissimi de Re aedificatoria opus elegantissimum, et quam maxime utile. Florenz: Laurentius.
- (1912). Zehn Bücher über die Baukunst. Wien; Leipzig: Hugo Heller.
- (1966). L’architettura [De re aedificatoria]. Mailand: Il Polifilo.
- (1973). De pictura, 1436. In: Opere volgari Ed. by C. Grayson. Bari: Laterza 5-107
- (1991). Zehn Bücher über die Baukunst. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Altavista, C. (2005). Ricerca del barocco a Genova. Il palazzo di Gerolamo de Marini in un capitolato inedito di Bartolomeo Bianco. Arte Lombarda 2: 54-63
- (2013). La residenza di Andrea Doria a Fassolo. Il cantiere di un palazzo di villa genovese nel Rinascimento. Mailand: Angeli.
Amico, G. B. (1726). Architetto prattico. Palermo: Aiccardo.
- (1750). Architetto prattico. Palermo: Aiccardo.
Anderson, P. (2009). The Archiconfraternita di San Giuseppe and the Università dei Falegnami. The development of professional institutions in early Baroque Rome. In: The Accademia Seminars Ed. by P. M. Lukehart. Seminar papers 2. Washington D.C.: National Gallery of Art 289-323
Antinori, A. (2013). Studio d’Architettura Civile. Gli atlanti di architettura moderna e la diffusione dei modelli romani nell’Europa del Settecento. Rom: Edizioni Quasar.
Aurenhammer, H. (1973). J. B. Fischer von Erlach. London: Allen Lane.
Aveta, A. (1997). Materiali tecniche tradizionali nel Napoletano. Note per il restauro architettonico. Neapel: Arte Tipografica.
Bacon, F. (1620). Francisci de Verulamio Summi Angliae Cancellaris Instauratio Magna. London: Joannes Billius.
Baldi, B. (1621). In mechanica Aristotelis problemata exercitationes. Adiecta succinta narratione de autoris vita et scriptis. Mainz: Typis & sumptibus viduæ I. Albini.
Baldinucci, F. (1681). Vocabolario toscano dell’arte del disegno nel quale si esplicano i propri termini e voci, non solo della pittura, scultura, & architettura, ma ancora di altre arti a quelle subordinate, e che abbiano per fondamento il disegno. Florenz: Santi Franchi.
Barbaro, D. (1556). I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio, tradutti et commentati da Monsignor Barbaro. Venedig: Marcolini.
- (1567). I dieci libri dell’architettura / di M. Vitruvio. Venedig: F. De Franceschi & G. Chrieger.
Bardeschi Ciulich, L. (1977). Documenti inediti su Michelangelo e l’incarico di San Pietro. Rinascimento N.S. 17: 235-275
Barocchi, P. (1962). Trattati d’Arte del Cinquecento. Fra Manierismo Controriforma. Bari: Laterza.
- (1971). Scritti d’Arte del Cinquecento. Mailand: Ricciardi.
Barucci, C. (1997). Aspetti delle tecniche costruttive nelle ricostruzioni siciliane e calabrese tra XVII e XVIII secolo. In: Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane, Atti del convegno Ed. by A. Casamento, E. Guidoni. Storia dell’Urbanistica: Sicilia, 2.1997. Rom: Edizioni Kappa 42-49
Barzman, K. E. (1985) The Università, Compagnia, ed Accademia del Disegno. Dissertation. Johns Hopkins University
- (2000). The Florentine Academy and the Early Modern State. The Discipline of Disegno. Cambridge: Cambridge University Press.
Bascapè, M. (1989). Confraternite e società a Lodi tra Quattro e Cinquecento. In: I Piazza da Lodi. Una tradizione di pittori nel Cinquecento (Ausstellungskatalog Lodi 1989) Ed. by G. C. Sciolla. Mailand: Electa 75-83
Becchi, A., F. Foce (2002). Degli archi e delle volte. Arte del costruire tra meccanica e stereotomia. Venedig: Marsilio.
Becchi, A., H. Rousteau-Chambon, H. RC. (2013). Philippe de la Hire 1640–1718. Entre architecture et sciences. Paris: Picard.
Becchi, A. (2004). Q. XVI. Leonardo, Galileo e il caso Baldi: Magonza, 26 Marzo 1621. Venedig: Marsilio.
- (2011). Cantieri d’inchiostro. Meccanica teorica e meccanica chirurgica nella seconda metà del Cinquecento. In: Studi su Domenico Fontana Ed. by G. Curcio, N. Navone, N. N.. Mendrisio: Mendrisio Academy Press, Silvana Editoriale 91-103
Becker, F. (2002). Costruire Venezia. Cinquecento anni di tecnica edilizia in laguna. Case a schiera. Übersetzt und eingeleitet von Silvio Strano. Rom: Argos.
Bedon, A. (1996). Giovan Antonio Rusconi: Illustratore di Vitruvio, artista, ingegnere, architetto. Vicenza: Centro Internazionale di Architettura Andrea Palladio.
Belli, G. (1991). Colonne, obelischi, piramidi. Le macchine per lo spostamento dei grandi pesi. In: Prima di Leonardo: cultura delle macchine e Siena nel Rinascimento Ed. by P. Galluzzi. Mailand: Electa 147-166
- (2008). Notes sur le transport et le soulèvement des colonnes dans l’architecture des XVe et XVIe siècles. In: La colonne. Nouvelle histoire de la construction Ed. by R. Gargiani. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes 90-115
Bellini, F. (2001). Lo stucco. Con note alle tecniche di Vitruvio, Vasari e Giocondo Albertolli. In: Delle tecniche di finitura superficiale = Rassegna di Architettura e Urbanistica 103/104 Ed. by V. De Feo, M. G. D’Amelio. 91-103
- (2004). Le cupole di Borromini: la „scienza“ costruttiva in età barocca. Mailand: Electa.
- (2011). La basilica di San Pietro. Da Michelangelo a Della Porta. Rom: Argos.
Bellori, G. P. (1672). Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni. Rom: Mascardi.
Belluzzi, A. (1993). Giuliano da Sangallo e la chiesa della Madonna dell’Umiltà a Pistoia. Florenz: Alinea.
Belluzzi, A., G. Belli (2003). Il ponte a Santa Trinita. Florenz: Edizione Polistampa.
Bencivenni, M. (2001). Il disegno e la formazione degli architetti fiorentini fra ’500 e ’600: il ruolo dell’Accademia delle Arti del Disegno. In: Disegno – rysunek u źrodeł sztuki nowożytnej: materiały sesji naukowej w Toruniu 26 – 27 X 2000 Ed. by T. J. Zuchowski. Thorn: Wydawn. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 149-159
Benedetti, S. (1992). L’officina architettonica di Antonio da Sangallo il Giovanne. La cupola per il S. Pietro di Roma. Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura N.S. 15/20.1990/1992: 485-504
- (1994a). Il modello per il San Pietro. In: Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura Ed. by H. A. Millon, V. Magnago Lampugnani. Mailand: Electa 632-633
- (1994b). Oltre l’antico e il gotico. Palladio 14: 157-166
- (1995). Sangallos Modell für St. Peter. In: Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo Ed. by B. Evers. 110-115
- (2006). La facciata del S. Pietro in Vaticano: strategie del comprendere e del restaurare. MdiR monumentidiroma 1/2: 11-27
- (2009). Il grande modello per il San Pietro in Vaticano. Antonio da Sangallo il giovane. Rom: Ganemi.
Benelli, F. (2004). Il palazzo del Podestà a Bologna nel Quattrocento. Storia e architettura. In: Committenti, cantieri, architetti 1400-1600. Nuovi Antichi Ed. by R. Schofield. Mailand: Electa 67-119
Benevolo, L. (1993a). La città nella storia d’Europa. Rom: Laterza.
- (1993b). Fixierte Unendlichkeit. Die Erfindung der Perspektive in der Architektur. Frankfurt a. M., New York: Campus Verlag.
Bentivoglio, E. (1987). Vestigia romane nella Porta del Popolo integrate nell’ornamentazione di Nanni di Baccio Bigio. In: Saggi in onore di Guglielmo de Angelis d’Ossat Ed. by S. Benedetti, G. Miarelli Mariani. Rom: Multigrafica Editrice 261-272
- (1994a). Due Libri di Patenti dei ‚Maestri delle Strade’ di Roma degli anni 1641-45 e 1646-1654. I mss. n. Quaderni del Dipartimento patrimonio architettonico e urbanistico. Storia cultura. Progetto 7: 9-40
- (1994b). Due Libri di Patenti dei ‚Maestri delle Strade‘ di Roma degli anni 1641-45 e 1646-1654. I mss. n. Quaderni del Dipartimento patrimonio architettonico e urbanistico. Storia cultura. Progetto 8: 11-62
Benvenuto, E. (1991). An Introduction to the History of Structural Mechanics. New York, Berlin: Springer.
Bernardi, P., M. Vaquero Piñeiro (2007). I cantieri edili: idea e realtà. In: Il Rinascimento Italiano e l’Europa, Bd. 3: Produzione e tecniche Ed. by P. Braunstein, L. Molà. Vicenza: Fondazione Cassamarca 511-531
Bertoldi, M., M. C. Marinozzi, M.C. M., Scolari M. C. (1983). Le tecniche edilizie e le lavorazioni più notevoli nel cantiere romano della prima metà del Seicento. Ricerche di storia dell’arte 20: 77-124
Black, J. (2001). Gli statuti comunali e lo stato territoriale Fiorentino. Il contributo dei giuristi. In: Lo stato territoriale Fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, Tagungsbericht (San Miniato, 7.-8. Juni 1996) Ospedaletto (Pisa): Pacini 23-46
Blondel, F. (1675/1683). Cours d’architecture enseigné dans l’Académie Royale d’Architecture. Paris: Lambert Roulland.
Blondel, J.-F. (1771). Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution & construction des bâtiments contenant les leçons données en 1750, & les années suivantes, par J.-F. Blondel , Architecte, dans son École des Arts. Paris: Desaint.
- (1772). Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution & construction des bâtiments contenant les leçons données en 1750, & les années suivantes, par J.-F. Blondel , Architecte, dans son École des Arts. Paris: Desaint.
Boato, A., D. Pittaluga (2003). Un impegnativo intervento secentesco di sottomurazione nel monastero di Santa Maria delle Grazie a Genova. Archeologia dell’architettura 7.2002: 99-134
Böckmann, B. (2004). Zahl, Maß und Maßbeziehung in Leon Battista Albertis Kirche San Sebastiano zu Mantua. Hildesheim: Olms.
Bonaccorso, G. (1998). I luoghi dell’architettura: lo studio professionale di Carlo Fontana. In: Roma, le case, la città Ed. by E. Debenedetti. Studi sul Settecento Romano 14. Rom: Multigrafica Editrice
- (2008). L’architetto e le collaborazioni letterarie: Carlo Fontana, Francesco Posterla e Carlo Vespignani. In: Studi sui Fontana. Una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco Ed. by M. Fagiolo, G. Bonaccorso. Rom: Gangemi 141-170
Bonavia, M. (1997). Volte. Tecniche costruttive e riparazioni. In: Manuale del recupero del Comune di Roma Ed. by F. Giovanetti. Rom: Tipografia del Genio Civile 141-155
Borromini, F. (1720). Opera del Caval. Francesco Boromino cavata da suoi originali. Rom.
- (1725). Opera del Caval. Francesco Boromino cavata da suoi originali. Rom.
Boscarino, S. (1997). Sicilia barocca. Architettura e città 1610-1760. Rom: Officina Edizioni.
Bösel, R., F. Camerota (2004). Orazio Grassi. Architetto e matematico gesuita; un album conservato nell’Archivio della Pontificia Università Gregoriana a Roma. Rom: Argos.
Bosman, L. (2004). The Power of Tradition. Spolia in the Architecture of St. Peter’s in the Vatican. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Bottari, S. (1822-1825). Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura. Mailand.
Boucheron, P. (1998). Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan (XIVe-XVe siècles). Rom: École française de Rome.
Bredekamp, H. (1993). Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte. Berlin: Wagenbach.
- (2000a). Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte. Berlin: Wagenbach.
- (2000b). Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstörung. Bau und Abbau von Bramante bis Bernini. Berlin: Wagenbach.
- (2008). Zwei Souveräne. Paul III. und Michelangelo; das motu proprio vom Oktober 1549. In: Sankt Peter in Rom 1506–2006 München: Hirmer 147-157
Brodini, A. (2005). Michelangelo e la volta della cappella del re di Francia in San Pietro. Annali di architettura 17: 115-126
Broise, H. (1989). Les maisons d’habitation à Rome aux XVe et XVIe siècles: Les leçons de la documentation graphique. In: D’une ville à l’autre. Structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle) Ed. by J.-C. Vigueur. Rom: École française de Rome 609-629
Brown, C. M. (1971). Luca Fancelli in Mantua. Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz XVI(2): 153-166
Bruschi, A. (1987). Problemi del S. Pietro bramantesco. In: Saggi in onore di Guglielmo de Angelis d’Ossat Ed. by S. Benedetti, G. M. Mariani. Quaderni dell’Istituto di storia dell’architettura N. S. 1-10 (1983-87). Rom: Multigrafica 273-292
- (1988). Problemi di materiali e di colori delle facciate con ordini architettonici nella Roma Rinascimentale e Barocca. Bollettino d’Arte 47: 117-122
Bührig, C., E. Kieven, E. K., Renn E. (2006). Towards an Epistemic History of Architecture. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 7-12
Bullet, P. (1691). L’Architecture pratique, qui comprend le détail du toisé, & du devis des ouvrages de massonnerie, charpenterie, menuiserie, etc.. Paris: E. Michallet.
Burioni, M. (2004). Die Architektur. Kunst, Handwerk oder Technik? Giorgio Vasari, Vincenzo Borghini und die Ordnung der Künste an der Accademia del Disegno im frühabsolutistischen Herzogtum Florenz. In: Technik in der frühen Neuzeit. Schrittmacher der europäischen Moderne Ed. by G. Engel. Zeitsprünge 8. Frankfurt a. M.: Klostermann 389-408
Burns, H. (2010). Castelli travestiti? Ville e residenze di campagna nel Rinascimento italiano. In: Luoghi, spazi, architetture Ed. by D. Calabi, E. Svalduz. Il Rinascimento italiano e l’Europa 6. Vicenza: Colla 465-545
- (2012). La villa italiana del Rinascimento. Forme e funzioni delle residenze di campagna, del castello alla villa palladiana. Costabissara (Vicenza): Colla.
Butters, S. B. (1996). The Triumph of Vulcan: Sculptor’s Tools, Porphyry, and the Prince in Ducal Florence. Florenz: Olschki.
Calabi, D. (2000). Edilizia pubblica e edilizia privata a Verona tra Quattro e Cinquecento: alcuni quesiti circa le decisioni, i committenti, la struttura del cantiere. In: Edilizia privata nella Verona rinascimentale Ed. by P. Lanaro, P. Marini, P. M.. Mailand: Electa 186-192
Calzona, A. (2002). Ludovico II Gonzaga principe ‚intendentissimo nello edificare“. In: Il Principe Architetto Ed. by A. Calzona, F. P. Fiore, F.P. F.. Florenz: Olschki 257-277
Calzona, A., L. Volpi Ghirardini (1994). Il San Sebastiano di Leon Battista Alberti. Florenz: Olschki.
Camerota, F. (2000). Il compasso di Fabrizio Mordente. Per la storia del compasso di proporzione. Florenz: Olschki.
- (2006a). Architecture as mathematical science: the case of ‚Architectura Obliqua‘. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 51-60
- (2006b). La prospettiva del Rinascimento. Arte, architettura, scienza. Mailand: Electa.
Campagna, M. M. (2003). Antonio Marchesi da Settignano e la chiesa di S. Maria del Massaccio a Spoleto. Opus 7: 217-228
Cantatore, F. (1997). La chiesa di San Pietro in Montorio a Roma: ricerche ed ipotesi intorno alla fabbrica tra XV e XVI secolo. Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura 24.1994: 3-34
Capecchi, D., C. Tocci (2011, 47). Le perizie sulla cupola vaticana di le Seur, Jacquier e Boscovich. Palladio N. S. 24: 43-58
Capra, A. (1678). La nuova architettura familiare. Divisa in cinque libri corrispondenti a’ cinque ordini, cioè toscano, dorico, ionico, corintio, e composito. Bologna: Monti.
Carbone, P. (1986). Il cantiere settecentesco: ruoli, burocrazia ed organizzazione del lavoro. Studi piemontesi 15: 335-357
Carofano, P. (1994). I primi anni dell’Accademia fiorentina del Disegno. In: Disegno italiano antico: artisti e opere dal Quattrocento al Settecento Ed. by M. Di Giampaolo. Mailand: Fenice 2000 30-39
Carpeggiani, P., A. M. Lorenzoni (1998). Carteggio di Luca Fancelli con Ludovico Federico e Francesco Gonzaga Marchesi di Mantova. Mantua: Arcari.
Carpino, S. (1997). Misure, quote e scale nei disegni del Rinascimento. Il disegno di architettura 7: 65-75
Carrara, E. (2000). Vasari e Borghini sul ritratto. Gli appunti pliniani della Selva di Notizie. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 44: 243-291
- (2006). Vincenzo Borghini, Lelio Torelli e l’Accademia del Disegno di Firenze. Alcune considerazioni. Annali di critica d’arte 2: 545-568
- (2008). La nascita dell’Accademia del Disegno di Firenze. Il ruolo di Borghini, Torelli e Vasari. In: Les Académies dans l’Europe humaniste. Idéaux et pratiques Ed. by M. Deramaix, P. Galand-Hallyn. Genf: Droz 129-162
Castiglione, B. (1733). Opere volgari, e latine del Conte Baldessar Castiglione. Novellamente raccolte, ordinate, ricorrette, ed illustrate, …. Padua: Comino.
Cataneo, P. (1554). I quattro primi libri di architettura. Venedig: in casa de’ figliuoli di Aldo [Manuzio].
- (1567). L’architettura. Venedig: Aldus [Manutius].
Cellauro, L., G. Richaud (2008). Il viaggio in Italia di Desgodets (1676–1677) e il codice di disegni dell’Institut de France. In: Antoine Desgodets: les édifices antiques de Rome. Edizione in facsimile dell’inedito manoscritto 2718 dell’Institut de France con trascrizioni e apparati scientifici e riproduzione delle tavole del volume edito nel 1682 Ed. by L. Cellauro, G. Richaud. Rom: De Luca Editori d’Arte 15-31
Ceradini, V. (1993). Analisi stereotomica per lo studio della stabilità della facciata di San Carlino alle quattro Fontane. In: S. Carlino alle Quattro Fontane. Il restauro della facciata. Note di cantiere Ed. by N. M. Gammino. Rom: C.T.R. 49-60
Cerchiai, A., C. Quiriconi (1976). Relazioni e rapporti all’Ufficio dei Capitani di Parte Guelfa. p. 1: principato di Francesco I dei Medici. In: Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I Ed. by G. Spini. Florenz: Olschki 185-257
Cerretelli, C. (2005). Da oscura prigione a tempio di luce. La costruzione di Santa Maria delle Carceri a Prato. In: Santa Maria delle Carceri a Prato. Miracoli e devozione in un santuario toscano del Rinascimento Ed. by A. Benvenuti. Florenz: Mandragora 45-95
Chantelou, P. F. de (1981). Journal de Voyage du Cavalier Bernin en France. Aix en Provence: Pandora Editions.
Cherubini, L. C. (2003). Restauri in Palazzo Farnese a Roma. In: Vignola e i Farnese Ed. by C. L. Frommel, M. Ricci, M. R.. Mailand: Electa 60-72
Chiappafreddo, P. (2007 (2008)). Le professioni e le maestranze impiegate nel cantiere rinascimentale. Analisi del libro paga della fabbrica di San Giovanni in Laterano del 1597–1601. Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée 119: 269-274
Cipriani, A. (2000). L’Accademia di San Luca e i concorsi di architettura. Rom: De Luca.
- (2009). Die Accademia di San Luca in Rom. In: Entwerfen. Architektenausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Geschichte – Theorie – Praxis Ed. by R. Johannes. Hamburg: Junius 344-358
Cirielli, E. (1987). Conti, capitolati e libretti di misura e stima come fonte di conoscenza dei rapporti e delle tecniche del cantiere barocco. In: Esperienze di storia dell’architettura e di restauro Ed. by G. Spagnesi. Rom: Istituto della Enciclopedia Italiana 427-433
Colbert, J. B. (1979). Instructions, lettres et mémoires de Colbert. Nendeln: Kraus.
Como, M. (2010). Statica delle costruzioni storiche in muratura. Archi, volte, cupole, architetture monumentali, edifici sotto carichi verticali e sotto sisma. Rom: Aracne.
Comoli, V., R. Roccia (1991). Le città possibili nell’urbanistica di Torino. Turin: Salone del Libro.
Comoli Mandracci, V. (1992). Una città-capitale, cantiere del barocco, nella stagione dell’assolutismo. In: Luganensium Artistarum Universitas. L’archivio e i luoghi della Compagnia di Sant’Anna tra Lugano e Torino Ed. by V. Comoli Mandracci. Lugano: Casagrande 1-20
- (1999). Torino paradigma per i modelli urbanistici e architettonici delle capitali nel Seicento e nel Settecento in Europa. In: I trionfi del Barocco. Architettura in Europa 1600–1750 Ed. by H. A. Millon. Mailand: Bompiani 349-369
Comoli Mandracci, V., C. Roggero Bardelli, C. R. (1990). Turin. Die Erfindung einer barocken Hauptstadt des Absolutismus. In: „Klar und lichtvoll wie eine Regel“: Planstädte der Neuzeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert Ed. by M. Maaß, K. W. Berger. Karlsruhe: Braun 133-142
Comoli Mandracci, V., C. Roggero Bardelli (1984). Fabbriche e giardini nel sistema territoriale delle residenze Sabaude. In: Il giardino come labirinto della storia Centro Studi di Storia e Arte dei Giardini. Palermo: Centro di studi di storia e arte dei giardini 184-189
Comoli, V., R. Roccia (2001). Progettare la città. L’urbanistica di Torino tra storia e scelte alternative. Turin: Città, Archivio storico.
Conforti, C. (1994/1995). Gli Uffizi: progetto e cantiere della Fabbrica dei XIII Magistrati. Rassegna di Architettura e Urbanistica 84/85: 38-46
- (1997). Lo specchio del cielo. Forme significati tecniche e funzioni della cupola dal Pantheon al Novecento. Mailand: Electa.
- (2001). Architetti, committenti, cantieri. In: Storia dell’architettura italiana. Il secondo Cinquecento Ed. by C. Conforti, R. J. Tuttle. Mailand: Electa 9-21
- (2002). Il cantiere di Michelangelo al ponte Santa Maria a Roma (1548-1549). In: I ponti delle capitali d’Europa dal Corno d’oro alla Senna Ed. by D. Calabi, C. Conforti. Mailand: Electa 75-87
- (2008). Modelli d’architettura. In: Magnificenze Vaticane. Tesori inediti dalla Fabbrica di San Pietro Ed. by A. M. Pergolizzi. Rom: De Luca 81-84
Conforti, C., A. Hopkins (2002). Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell’architettura rinascimentale e barocca. Rom: Nuova Argos.
Contardi, B. (1991). I modelli nel sistema della progettazione architettonica a Roma tra 1680 e 1750. In: In urbe architectus Ed. by B. Contardi, G. Curcio. Rom: Àrgos 9-22
Contardi, B., G. Curcio (1991). In urbe architectus. Modelli, disegni, misure. La professione dell’architetto, Roma 1680-1750. Rom: Àrgos.
Conti, G. (1993). Il calcestruzzo nella trattatistica Rinascimentale. In: Calcestruzzi antichi e moderni. Storia. Cultura. Tecnologia Ed. by G. Biscontin, D. Mietto. Padua: Libreria Progetto 41-50
Cooper, T. E. (1994). I modani. In: Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura Ed. by H. A. Millon, V. Magnago Lampugnani. Mailand: Bompiani 494-500
Coppa, A. (2002). L’architettura della difesa nella trattatistica: da Vitruvio all’età umanistica. In: Architettura fortificata: un problema interpretativo e operativo, Istituto Italiano dei Castelli Ed. by F. Manenti Valli. Castella 78. Rom: Istituto Italiano dei Castelli 67-87
Corazzi, R., G. Conti (2011). Il segreto della Cupola del Brunelleschi a Firenze. Florenz: Pontecorboli.
Cosatti, L. (1743). Riflessioni di Lelio Cosatti patrizio sanese sopra il sistema dei tre RR. PP. mattematici e suo parere circa il patimento, e risarcimento della gran cupola di S. Pietro..
Coscarella, C. (2004). I cantieri di Carlo Borromeo amministratore della diocesi milanese. Note dai libri mastri della Mensa arcivescovile. Arte Lombarda 140: 79-88
Cottone, A. (1987). Materiali e tecniche costruttive ne „L’Architetto Prattico“ di Giovanni Biagio Amico. In: Giovanni Biagio Amico (1684-1754): teologo, architetto, trattatista. Atti delle giornate di studio Storia, architettura, saggi 6. Rom: Multigrafica Editrice 81-86
Crouzet-Pavan, É. (2003). Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale. Rom: École française de Rome.
Cupelloni, L. (1996). Antichi cantieri moderni. Concezione, sapere tecnico, costruzione da Iktìnos a Brunelleschi. Rom: Gangemi.
Curcio, F. (1990). Capitolati di cantiere e restauro a Vicenza tra ’700 e ’800. In: Il prato della valle e le opere in pietra calcarea collocate all’aperto. Esperienze e Metodologie di Conservazione in Area Veneta Padua: Libreria Progetto 219-226
Curcio, G. (1999). La casa studio di Carlo Maderno. In: Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane Ed. by M. Kahn-Rossi, M. Franciolli. Mailand: Skira 287-292
- (2000). La professione dell’architetto: disegni, cantieri, manuali. In: Storia dell’architettura italiana. Il Settecento Ed. by G. Curcio, E. Kieven. Mailand: Electa 50-69
- (2003). Del Trasporto dell’Obelisco Vaticano, e sua Erezione. In: Il Tempio Vaticano 1694. Carlo Fontana Ed. by G. Curcio. Mailand: Electa CLXX-CLXXXVII
Curcio, G., M. R. Nobile, M.R. N. (2010). I libri e l’ingegno. Studi sulla biblioteca dell’architetto XV-XX secolo. Palermo: Edizioni Caracol.
Cusanus, N. (1937). Idiota de staticis experimentis. Leipzig: Meiner.
Daly Davis, M. (1989). Zum Codex Coburgensis. Frühe Archäologie und Humanismus im Kreis des Marcello Cervini. In: Antikenzeichnung und Antikenstudium in Renaissance und Frühbarock Ed. by R. Harprath, H. Wrede. Mainz: Philipp von Zabern 185-199
- (1994). Archäologie der Antike. Aus den Beständen der Herzog-August-Bibliothek. 1500-1700. Wiesbaden: Harrassowitz.
D’Amelio, M. G. (2001). I cantieri di Francesco Borromini a Roma. Impianto, organizzazione e approvvigionamento dei materiali. In: Contributi sul Barocco romano Ed. by R. M. Strollo. Rom: Aracne 47-65
- (2002a). Acque e macchine idrauliche nell’edilizia a Roma tra Cinquecento e Seicento. In: Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell’architettura rinascimentale e barocca Ed. by C. Conforti, A. Hopkins. Rom: Nuova Argos 141-157
- (2002b). Il ruolo della Reverenda Fabbrica di San Pietro nei cantieri romani tra Rinascimento e Barocco. Römische historische Mitteilungen 44: 393-424
- (2003a). I Farnese e la Compagnia Ignaziana: le modificazioni alla cupola del Gesù di Roma per la decorazione secentesca. In: Vignola e i Farnese Ed. by C. L. Frommel, M. Ricci, M. R.. Mailand: Electa 84-98
- (2003b). The Construction Techniques and Methods for Organizing Labor Used for Bernini’s Colonnade in St. Peter’s, Rome. In: Proceedings of the First International Congress of Construction History Madrid: Instituto Juan de Herrera, Escuela técnica superior de arquitectura 693-703
- (2006). Building Materials, Tools and Machinery Belonging to the Reverenda Fabbrica di San Pietro, Used for Building Rome from the Late 16th to the Late 19th Century. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 125-136
Dandelet, T. J. (2008). Financing New Saint Peter’s. 1506–1700. In: Sankt Peter in Rom 1506–2006 Ed. by G. Satzinger, S. Schütze. München: Hirmer 41-48
Danti, V. (1567). Il primo libro del Trattato delle perfette proporzioni di tutte le cose che imitare, e ritrarre si possano con l’arte del disegno. Florenz.
Davies, P. (1995). The Early History of S. Maria delle Carceri in Prato. Journal of the Society of Architectural Historians 54: 326-335
- (2004). Santa Maria del Calcinaio a Cortona come architettura di pellegrinaggio. In: Francesco di Giorgio alla corte di Federico da Montefeltro Ed. by F. P. Fiore. Florenz: Olschki 679-706
- (2008). A re-reading of Antonio Labacco’s drawing of San Sebastiano in Mantua. In: Leon Battista Alberti Ed. by J. Poeschke, C. Syndikus. Münster: Rhema 299-314
de Bruyn, G. (1996). Die Diktatur der Philanthropen: Entwicklung der Stadtplanung aus dem utopischen Denken. Braunschweig: Vieweg.
De Carlo, G. (1966). Urbino: La Storia di Una Città e il Piano della sua Evoluzione Urbanistica (Urbino: The History of a City and Plans for its Development). Padua: Marsilio.
Defabiani, V. (2002). Il progetto del territorio. L’intorno di Stupinigi e i rilevamenti del Settecento. In: I pioppi di Juvarra: dalla riserva di caccia di Stupinigi al nuovo parco Ed. by M. Barosio, M. Trisciuglio. N.S., A. 56, n.1. Atti e rassegna tecnica, N.S., A. 56, n.1.. Turin: CELID 39-46
De Feo, V., C. Conforti, C. C. (1994/1995). Architettura e Costruzione = Rassegna di Architettura e Urbanistica 84/85..
Degni, P. (2007). La ‚Fabrica‘ di San Carlino alle Quattro Fontane: Gli anni del restauro..
Della Torre, S. (1992). Il mestiere di costruire. Documenti per una storia del cantiere. Il caso di Como. Como: Nodo libri.
- (1996). Storia delle tecniche murarie e tutela del costrutio. Esperienze e questioni di metodo. Mailand: Guerini.
de l’Orme, P. (1561). Nouvelles Inventions pour bien bastir et à petits fraiz. Paris: F. Morel.
del Piazzo, M. (1968). Ragguagli Borrominiani. Mostra documentaria. Rom: Ministerio dell’Interno.
de Marchi, F. (1599). Della Architettura militare libri tre. Brescia: Comino Presegni: ad instanza di Gasparo dall’Oglio.
de Quincy, Q., A. Chrysostome (1985). Dizionario storico di architettura. Le voci teoriche. Venedig: Marsilio.
De Rossi, D. (1702). Studio di Architettura Civile. Rom.
- (1711). Studio di Architettura Civile. Rom.
- (1721). Studio di Architettura Civile. Rom.
Descartes, R. (1988). Œuvres philosophiques. Paris: Garnier.
De Seta, C., L. Di Mauro (2002). Palermo. Bari: Editori Laterza.
Di Pasquale, G. (2008). The drum lifting machine of Heron of Aleandria. In: La colonne. Nouvelle histoire de la construction Ed. by R. Gargiani. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes 32-41
Di Pasquale, S. (1996). L’arte del costruire. Tra conoscenza e scienza. Venedig: Marsilio.
- (2002). Brunelleschi. La costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore. Venedig: Marsilio.
Di Somma, A. (1641). Historico racconto de li terremoti della Calabria dell’anno 1638. Neapel: Camillo Cavallo. 66f. Di Somma, Agatio (1641). Historico racconto de li terremoti della Calabria dell’anno 1638. Neapel: Camillo Cavallo. 66f. Di Somma, Agatio (1641). Historico racconto de li terremoti della Calabria dell’anno 1638. Neapel: Camillo Cavallo.
Di Teodoro, F. P. (1994). Raffaello, Baldassar Castiglione e la lettera a Leone X. Bologna: Nuova Alfa Editoriale.
- (2003). Raffaello, Baldassar Castiglione e la lettera a Leone X. Con l’aggiunta di due saggi Raffaelleschi. San Giorgio di Piano: Minerva Edizioni.
Dittscheid, H.-C. (1996). Form versus Materie. Zum Spoliengebrauch in den römischen Bauten und Projekten Donato Bramantes. In: Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance Ed. by J. Poeschke. München: Hirmer 277-307
Dobler, R.-M. (2009). Die Juristenkapellen Rivaldi, Cerri und Antamoro. Form, Funktion und Intention römischer Familienkapellen im Sei- und Settecento. München: Hirmer.
Döring-Williams, M., H. Schlimme (2011). Aufnahme und Analyse sphärischer Oberflächen: Die Kuppel von Sant’Andrea della Valle in Rom. In: Erfassen, Modellieren, Visualisieren. Von Handaufmass bis High Tech III. 3D in der historischen Bauforschung Ed. by K. Heine, K. Rheidt, K. R., Henze K.. Darmstadt: Philipp von Zabern 211-224
Dreßen, A. (2008). Pavimenti decorati del Quattrocento in Italia. Venedig: Marsilio.
Dufour, L. (1981). La reconstruction religieuse de la sicile après le séisme de 1693. Une approche des rapports entre histoire urbaine et vie religieuse. Mélanges de l’école française de Rome. Moyen Age, Temps Modernes 93: 525-557
Dufour, L., H. Raymond (1987). La riedificazione di Avola, Noto e Lentini. „Fra’ Angelo Italia, maestro architetto“. In: Il Barocco in Sicilia tra conoscenza e conservazione Ed. by M. Fagiolo, L. Trigilia. Syrakus: Ediprint 11-34
- (1990). Dalle baracche al barocco. La ricostruzione di Noto – il caso e la necessità. Syrakus: Lombardi.
- (1993). 1693 Val di Noto. La rinascita dopo il desastro. Catania: D. Sanfilippo Editore.
Dürer, A. (1525). Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt. Nürnberg: Hieronymus Andreae.
- (1527). Etliche underricht zu Befestigung der Stett, Schloß, und Flecken. Nürnberg.
Eckert, A. (2000). Die Rustika in Florenz. Mittelalterliche Mauerwerks- und Steinbearbeitungstechniken in der Toskana. Braubach: Deutsche Burgenvereinigung.
Esposito, D. (2001). La tinteggiatura a calce. In: Delle tecniche di finitura superficiale = Rassegna di Architettura e Urbanistica 103/104 Ed. by V. De Feo, M. G. D’Amelio. 7-17
Evers, B. (1995). Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo. München: Prestel.
Fabbri, L. (2003). La ‚Gabella di Santa Maria del Fiore‘. Il finanziamento pubblico della cattedrale di Firenze. In: Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale Ed. by E. Crouzet-Pavan. Collection de l’École franςaise de Rome 302. Rom: École française de Rome 195-244
Fabri, O. (1598). L’uso della squadra mobile con la quale per teoria et pratica si misura geometricamente ogni distanza, altezza e profondità, s’impara a perticare, livellare et pigliare in disegno le città, paesi e province, ecc.. Venedig: Francesco Barilleti.
Fabriczy, C. von (1907). Brunelleschiana. Urkunden und Forschungen zur Biographie des Meisters. Jahrbuch der Königlich Preußischen Kunstsammlungen 28(Beiheft): 1-84
Fagiolo, M. (2004). Tra Versailles, Madrid e Caserta: modelli borbonici per una idea di reggia-città-parco. In: Arti a confronto. Studi in onore di Anna Maria Matteucci Ed. by D. Lenzi. Bologna: Editrice Compositori 247-255
Falda, G. B. (1685). Romanorum fontinalia, sive Nitidissimorum perenniumque, intra & extra, urbem Romam, fontium vera, varia, & accurata delineatio..
- (1691). Le fontane di Roma nelle piazze e luoghi publici della città con li loro prospetti come sono al presente. Rom: Giovanni Giacomo de Rossi.
- (1699). Nuovo Teatro delle Fabbriche, et Edificii, in Prospettiva di Roma Moderna. Rom: Giovanni Giacomo Rossi.
Farr, J. R. (2000). Artisans in Europe 1300–1914. Cambridge: Cambridge University Press.
Fensterbusch, C. (1991). Vitruv. Zehn Bücher über Architektur. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Fichera, F. (1934). G.B. Vaccarini e l’architettura del Settecento in Sicilia. Rom: Reale Accademia d’Italia.
Fiengo, G., L. Guerriero (2003). Atlante delle techniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte, i protocolli della ricerca. L’indagine documentaria. Neapel: Arte Tipografica Editrice.
Fieni, L. (2000). Calci Lombarde. Produzione e mercati dal 1641 al 1805. Florenz: All’Insegna del Giglio.
Filarete, A. A. detto Il (1972). Trattato di architettura. Mailand: Il Polifilo.
Fiorani, D. (2001). Il cocciopesto e il battuto di lapillo. In: Delle tecniche di finitura superficiale = Rassegna di Architettura e Urbanistica 103/104 Ed. by V. De Feo, M. G. D’Amelio. 40-48
Fiorani, D., D. Esposito (2005). Tecniche costruttive dell’edilizia storica. Conoscere per conservare. Rom: Viella.
Folkerts, M., E. Knobloch, E. K. (2001). Mass, Zahl und Gewicht. Mathematik als Schlüssel zu Weltverständnis und Weltbeherrschung. Wiesbaden: Harassowitz.
Fontana, C. (1694). Templum Vaticanum et ipsius origo. Rom: Buagni.
Fontana, D. (1590). Della Trasportatione dell’Obelisco Vaticano (…). Roma: Domenico Basa.
Formenti, C. (1893). La pratica del fabbricare. Mailand: Hoepli.
Förtsch, R. (1993). Archäologischer Kommentar zu den Villenbriefen des jüngeren Plinius. Mainz: Philipp von Zabern.
Francia, E. (1977). 1506-1606: Storia della costruzione del Nuovo San Pietro. Rom: DeLuca.
Freigang, C. (2004). Göttliche Ordnung und nationale Zeitgemäßheit. Die Querelle des Anciens et des Modernes in der deutschen Architekturtheorie um 1700. In: Kulturelle Orientierung um 1700: Traditionen, Programme, konzeptionelle Vielfalt Ed. by S. Heudecker, D. Niefanger, D. N.. Tübingen: Niemeyer 122-142
Frey, K. (1910). Zur Baugeschichte des St. Peter. Mitteilungen aus der Reverendissima Fabbrica di S. Pietro. Jahrbuch der Königlich Preußischen Kunstsammlungen 31, Beiheft: 1-95
Friedman, T. (1984). James Gibbs. New Haven: Yale University Press.
Frommel, C. L. (1976). Die Peterskirche unter Papst Julius II. im Licht neuer Dokumente. Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16: 57-136
- (1983). Francesco del Borgo, Architekt Pius’ II. und Pauls II. – I. Der Petersplatz und weitere römische Bauten Pius’ II. Piccolomini. Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 20: 106-154
- (1984). San Pietro. Storia della sua costruzione. In: Raffaello architetto Ed. by C. L. Frommel, S. Ray, S. R.. Mailand: Electa 241-310
- (1991). Il cantiere di S. Pietro prima di Michelangelo. In: Les Chantiers de la Renaissance Ed. by J. Guillaume. Paris: Picard 175-183
- (1994). The drawings of Antonio da Sangallo the Younger. History, evolution, method, function: introduction. In: The Architectural Drawings of Antonio da Sangallo the Younger and his Circle Ed. by C. L. Frommel. Cambridge, Mass.: MIT Press 1-60
- (2005). Chiese sepolcrali e cori-mausolei nell’architettura del Rinascimento italiano. In: Demeures d’éternité: églises et chapelles funéraires aux XVe et XVIe siècles Ed. by J. Guillaume. Paris: Picard 73-98
Frommel, C. L., N. Adams (2000). The drawings of Antonio da Sangallo the Younger. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Frontino, S. G. (1997). Gli acquedotti di Roma. Lecce: Argo.
Gagliardi, I. (2005). I miracoli della Madonna delle Carceri in due codici della Biblioteca Roncioniana di Prato. In: Santa Maria delle Carceri a Prato. Miracoli e devozione in un santuario toscano del Rinascimento Ed. by A. Benvenuti. Florenz: Mandragora 97-153
Galilei (1606). Le operazioni del compasso geometrico e militare. Padua: in casa dell’autore, per Pietro Marinelli.
- (1638). Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuoue scienze attenenti alla mecanica & i mouimenti locali. Leiden: Elsevir.
Gallerani, A. M., B. Guidi (1976). Relazioni e rapporti all’Ufficio dei Capitani di Parte Guelfa. Teil 2: principato di Ferdinando I. In: Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I Ed. by G. Spini. Florenz: Olschki 259-329
Galliani, G. V., G. Franco (2001). Una tecnologia per l’architettura costruita. Forme, strutture e materiali nell’edilizia genovese e ligure. Florenz: Alinea.
Galluzzi, P. (1977). Le colonne ‚fesse‘ degli Uffizi e gli ‚screpoli‘ della cupola: il contributo di Vincenzo Viviani al dibattito sulla stabilità della cupola del Brunelleschi (1694–1697). Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze
- (2005). Machinae Pictae. Immagine e idea della macchina negli artisti-ingegneri del Rinascimento. In: Machina. XI Colloquio Internazionale Ed. by M. Veneziani. Florenz: Olschki 241-272
Gammino, N. M. (1993). S. Carlino alle Quattro Fontane. Il restauro della facciata. Note di cantiere. Rom: C.T.R..
Gargiani, R. (2003a). Princìpi e costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento. Bari: Laterza.
- (2003b). Vers une construction parfaite. Machines et calcul de résistance des matériaux. Matières 6: 99-115
- (2008). La Colonne: Nouvelle Histoire de la Construction. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
- (2012). L’architrave, le plancher, la plate-forme: nouvelle histoire de la construction. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
Garofalo, E. (2010). Le arti del costruire. Corporazioni edili, mestieri e regole nel Mediterraneo aragonese (XV-XVI secolo). Palermo: Caracol.
Gibbs, J. (1737). Bibliotheca Radcliffiana. Oxford: For the Radcliffe Trustees.
- (1747). Bibliotheca Radcliviana. London: Printed for the Author.
Giorgi, A., S. Moscadelli (2001). Quod omnes cerei ad opus deveniant. Il finanziamento dell’opera del Duomo di Siena nei secoli XIII e XIV. Nuova Rivista Storica 85: 489-584
Giovanetti, F. (1997). Manuale del recupero del Comune di Roma. Rom: Tipografia del Genio Civile.
Giuffrè, A. (1988). Monumenti e terremoti. Aspetti statici del restauro. Rom: Multigrafica Editrice.
Giuffrè, M. (1997). La ricostruzione tra preesistenze e nuovi progetti. In: Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane Ed. by A. Casamento, E. Guidoni. Storia dell’Urbanistica: Sicilia 2. Rom: Edizioni Kappa 84-91
Giusto, R. M. (2003). Architettura tra Tardobarocco e Neoclassicismo. Il ruolo dell’Accademia di San Luca nel Settecento. Neapel: Edizioni Scientifiche Italiane.
Gnoli, R. (1988). Marmora Romana. Rom: Edizioni dell’Elefante.
Goldthwaite, R. A. (1980). The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Grassi, L., M. Pepe (1994). Dizionario dei termini artistici. Mailand: TEA.
Gritella, G. (1987). Stupinigi. Dal progetto di Juvarra alle premesse neoclassiche. Modena: Panini.
Grote, A. (1959). Studien zur Geschichte der Opera di Santa Reparata zu Florenz im vierzehnten Jahrhundert. München: Prestel.
Guarini, G. (1686). San Lorenzo in Turin. In: Dissegni di architettura civile ed ecclesiastica Ed. by G. Guarini. Turin: Domenico Paulino
- (1737). Architettura civile. Turin: Mairesse.
- (1968). Architettura civile. Mailand: Edizioni il Polifilo.
Guasti, C. (1857). La Cupola di Santa Maria del Fiore, illustrata con i documenti dell’archivio dell’Opera secolare. Florenz: Barbèra, Bianchi & Co..
- (1887). Santa Maria del Fiore. La costruzione della chiesa e del campanile secondo i documenti tratti dall’Archivio dell’Opera Secolare e da quello di Stato. Florenz: Tipografia Ricci.
Guidoboni, E. (1987). „Delli rimedi contra terremoti per la sicurezza degli edifici“: la casa antisismica di Pirro Ligorio (sec. XVI). In: Tecnica e società nell’Italia dei secoli XII-XVI Ed. by Centro Italiano Studi di Storia e d’Arte. Pistoia: Centro italiano di studi di storia e d’arte 215-228
- (1999). Les conséquences des tremblements de terre sur les villes en Italie. In: Stadtzerstörung und Wiederaufbau, Bd. 1: Zerstörungen durch Erdbeben, Feuer und Wasser Ed. by M. Körner. Bern: Verlag Paul Haupt 43-66
Guidoni, E., A. Marino, A. M. (1987). I „Libri dei conti’“ di Domenico Fontana. Riepilogo generale delle spese e Libro I, „Storia della città“. Storia della Città 40. L’Urbanistica nell’età di Sisto V: 45-77
Guidoni, E., S. Ricci, S. R. (2003). I tre centri della Valle dell’Arno. In: Arnolfo di Cambio urbanista Ed. by E. Guidoni. Civitates: Urbanistica, archeologia, architettura delle città medievali 8. Rom: Bonsignori 31-38
Guidoni, E. (2003). Arnolfo di Cambio urbanista. Rom: Bonsignori.
Guillaume, J. (1991). Les chantiers de la Renaissance: actes des colloques tenus à Tours en 1983-1984. Paris: Picard.
Günther, H. (1988). Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance. Tübingen: Wasmuth.
- (1997). „Als wäre die Peterskirche mutwillig in Flammen gesetzt“. Zeitgenössische Kommentare zum Neubau der Peterskirche und ihre Maßstäbe. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst 3. Folge 48: 67-112
- (2002). Gli studi antiquari per l’„Accademia della Virtù“. In: Jacopo Barozzi da Vignola Ed. by R. J. Tuttle, B. Adorni, B. A., Frommel B.. Mailand: Electa 126-128
Hager, H. (1991). Il modello di Girolamo Fontana per la cattedrale di S. Pietro a Frascati. In: In urbe architectus. Modelli, disegni, misure ; la professione dell’architetto, Roma 1680 - 1750 Ed. by B. Contardi, G. Curcio. Rom: Àrgos 41-49
- (1993). Carlo Fontana. Pupil, partner, principal, preceptor. Studies in the history of art (National Gallery of Art, Washington) 38: 123-155
- (1997). Clemente XI, il museo dei modelli della Reverenda Fabbrica di S. Pietro e l’origine del museo architettonico. Rivista storica del Lazio 5: 137-183
- (1998). Carlo Fontana. Utilissimo trattato dell’acque correnti. Rom: Enel.
- (2000a). L’Accademia di San Luca e i concorsi di architettura. In: Aequa Potestas. Le Arti in gara a Roma nel Settecento Ed. by A. Cipriani. Rom: De Luca 117-124
- (2000b). Le Accademie di Architettura. In: Storia dell’Architettura italiana. Il Settecento Ed. by G. Curcio, E. Kieven. Mailand: Electa 20-49
- (2003). Carlo Fontana. In: Storia dell’architettura italiana. Il Seicento Ed. by A. Scotti Tosini. Mailand: Electa 238-261
Haines, M. (1985). The Builders of Santa Maria del Fiore: an Episode of 1475 and an Essay towards its Context. In: Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth Ed. by A. Morrogh, F. Superbi Gioffredi, F. S.G., Morselli F.. Florenz: Giunti Barbèra 89-115
- (1989). Brunelleschi and Bureaucracy. The Tradition of Public Patronage at the Florentine Cathedral. I Tatti Studies: Essays in the Renaissance 3: 89-125
- (1994). Firenze e il finanziamento della cattedrale e del campanile. In: Alla riscoperta di Piazza del Duomo in Firenze – 3. Il Campanile di Giotto Ed. by T. Verdon. Florenz: Centro Di 71-83
- (2002). La grande impresa civica di Santa Maria del Fiore. Nuova Rivista Storica 86: 19-48
Haines, M., L. Riccetti (1996). Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino all’inizio dell’Età Moderna. Florenz: Olschki.
Halleux, R. (2002). Le conoscienze tecniche e la scienza dal XII al XV secolo. In: Storia delle Scienza. Bd. 4: Medioevo e Rinascimento Rom: Istituto della Enciclopedia Italiana 504-518
Heyman, J. (1972). Coulomb’s Memoir on Statics: An Essay in the History of Civil Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1998). Hooke’s Cubico-Paraboical Conoid. Notes and records of the Royal Society of London 52(1): 39-50
Hibbard, H. (1971). Carlo Maderno and Roman Architecture. 1580–1630. London: Zwemmer.
- (2001). Carlo Maderno. Mailand: Electa.
Holzer, S. M., B. Köck (2008). Meisterwerke barocker Bautechnik. Kuppeln, Gewölbe und Kirchendachwerke in Südbayern. Regensburg: Schnell und Steiner.
Hoppe, S. (2003). Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580-1770. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- (2009). Die Barockzeit. In: Entwerfen. Architektenausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Geschichte – Theorie – Praxis Ed. by R. Johannes. Hamburg: Junius 769-783
Hoppe, S., D. Hohrath (2006). Festungsbau. In: Enzyklopädie der Neuzeit Ed. by F. Jaeger. Stuttgart: Metzler 948-959
Hubert, H. W. (1992). Bramante, Peruzzi, Serlio und die Peterskuppel. Zeitschrift für Kunstgeschichte 55: 353-371
Huerta, S. (2004). Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometria y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica. Madrid: Inst. Juan de Herrera.
Ippolito, L., C. Peroni (1997). La cupola di Santa Maria del Fiore. Rom: Nuova Italia Scientifica.
Jack Ward, M. A. (1972) The Accademia del Disegno in Sixteenth Century Florence. The Study of an Artist’s Institution. phdthesis. University of Chicago
Jack, M. A. (1976). The Accademia del Disegno in Late Renaissance Florence. Sixteenth Century Journal 7(2): 3-20
Jöchner, C. (2003). Der Außenhalt der Stadt. Topographie und politisches Territorium in Turin. In: Politische Räume. Stadt und Land in der Frühneuzeit Berlin: Akademie Verlag 67-89
Jung, W. (2004). Il delinearsi del conflitto. La progettazione del nuovo San Pietro antecendente la posa della prima pietra. Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura N.S. 43: 33-50
Kemp, W. (1974). Disegno. Beiträge zur Geschichte des Begriffs zwischen 1547 und 1607. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 19: 219-240
Kent, F. W. (2004). Lorenzo de’ Medici and the Art of Magnificence. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Kessel, L. (1995). Festarchitektur in Turin zwischen 1713 und 1773: Repräsentationsformen in einem jungen Königtum. München: scaneg.
Kieven, E. (1987). Rome in 1732: Alessandro Galilei, Nicola Salvi, Ferdinando Fuga. In: Light on the eternal city. Observations and discoveries in the art and architecture of Rome Ed. by H. Hager, S. S. Munshower. University Park: Pennsylvania State University Press 255-276
- (1988). Ferdinando Fuga e l’architettura romana del Settecento. I disegni di architettura dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe: Il Settecento. Rom: Multigrafica Editrice.
- (1991). Architettura del Settecento a Roma nei disegni della Raccolta Grafica Comunale. Rom: Carte segrete.
- (1993). Von Bernini bis Piranesi. Römische Architekturzeichnungen des Barock. Stuttgart: Hatje.
- (1999). Mostrar l’inventione’. Il ruolo degli architetti romani nel barocco. Disegno e modello. In: I trionfi del barocco Ed. by H. A. Millon. Mailand: Bompiani 173-205
- (2000a). Ferdinando Fuga (1699-1781). In: Il Settecento, Storia dell’architettura italiana Ed. by G. Curcio, E. Kieven. Mailand: Electa 540-555
- (2000b). La cultura architettonica. In: Il Settecento, Storia dell’architettura italiana Ed. by G. Curcio, E. Kieven. Mailand: Electa XXXIX-LXI
- (2000c). Lo stato della Chiesa. Roma tra il 1730 e il 1758. In: Il Settecento, Storia dell’architettura italiana Ed. by E. Curcio. Mailand: Electa 184-209
- (2002–2014). Lineamenta, Forschungsdatenbank für Architekturzeichnungen. Rom.
Klapisch-Zuber, C. (1969). Les maîtres du marbre: Carrare, 1300–1600. Paris: S.E.V.P.E.N..
Klein, U., W. Lefèvre (2007). Materials in Eighteenth-Century Science: A Historical Ontology. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Knobloch, E. (2001a). Instrumente. In: Maß, Zahl, Gewicht. Mathematik als Schlüssel zu Weltverständnis und Weltbeherrschung Ed. by M. Folkerts, E. Knobloch, E. K.. Wiesbaden: Harrassowitz 151-185
- (2001b). Praktische Geometrie. In: Maß, Zahl, Gewicht. Mathematik als Schlüssel zu Weltverständnis und Weltbeherrschung Ed. by M. Folkerts, E. Knobloch, E. K.. Wiesbaden: Harrassowitz 121-150
Körner, M. (1999a). Stadtzerstörung und Wiederaufbau, Bd. 1: Zerstörungen durch Erdbeben, Feuer und Wasser. Bern: Verlag Paul Haupt.
- (1999b). Stadtzerstörung und Wiederaufbau: Thema, Forschungsstand, Fragestellungen und Zwischenbilanz. In: Stadtzerstörung und Wiederaufbau Ed. by M. Körner. Bern: Verlag Paul Haupt 7-42
Krau, I. (2006). Utopie und Ideal – in Stadtutopie und Idealstadt. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur Ed. by W. Nerdinger. Salzburg: Pustet 75-82
Kraus, F., C. Thoenes (1991/1992). Bramantes Entwurf für die Kuppel von St. Peter. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 27/28: 183-200
Krause, K. (1996). Die Maison de plaisance. Landhäuser in der Ile-de-France (1660-1730). München: Deutscher Kunstverlag.
Krautheimer, R., T. Krautheimer-Hess (1982). Lorenzo Ghiberti. Princeton: Princeton University Press.
Kreul, A. (2006). Johann Bernhard Fischer von Erlach. Regie der Relation. Salzburg: Pustet.
Kruft, H.-W. (1985). Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck.
- (1991). Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Studienausgabe. München: C.H. Beck.
Kulawik, B. (2002) Die Zeichnungen im Codex Destailleur D (HDZ 4151) der Kunstbibliothek Berlin - Preußischer Kulturbesitz zum letzten Projekt Antonio da Sangallos des Jüngeren für den Neubau von St. Peter in Rom. phdthesis.
Kurrer, K.-E. (2002). Geschichte der Baustatik. Berlin: Ernst.
- (2008). The History of the Theory of Structures. From Arch Analysis to Computational Mechanics. Berlin: Ernst und Sohn.
La Duca, R. (1975). Cartografia generale della città di Palermo e antiche carte della Sicilia. Neapel: Edizioni Scientifiche Italiane.
La Hire, P. (1695). Traité de mécanique, où l’on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des Arts, et les proprietés des corps pesants lesquelles ont eu plus grand usage dans la Physique. Paris: Imprimerie Royale.
- (1730). Traité de mécanique, où l’on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des Arts. Mémoires de l’Académie Royale des Sciences 9: 1-331
- (1731). Sur la construction des vôutes dans les edifices. In: Mémoires de l’Académie Royale des Sciences 1712 Paris 69-77
Lamberini, D. (1991). Il cantiere delle fortificazioni nella Toscana del Cinquecento. In: Les chantiers de la Renaissance Ed. by J. Guillaume. Paris 227-235
- (1995). Bartolomeo Ammannati: Tecniche ingegneristiche e macchine da cantiere. In: Bartolomeo Ammannati. Scultore e Architetto. 1511-1592 Ed. by N. Rosselli Del Turco, F. Salvi. Florenz 349-356
- (1998/1999). All’ombra della cupola: tradizione e innovazione nei cantieri fiorentini quattro e cinquecenteschi. Annali di architettura 10/11: 276-287
- (2005/2006). Inventori di macchine e privilegi cinque-seicenteschi dall’Archivio fiorentino delle Riformagioni. Journal de la Renaissance
Lanconelli, A., I. Ait (2002). Maestranze e cantieri edili a Roma e nel Lazio. Lavoro, Tecniche, Materiali nei secoli XIII-XV. Manziana: Vecchiarelli.
Lasagni, I. (2008). Chiese, conventi e monasteri in Crema e nel suo territorio dall’inizio del dominio veneto alla fondazione della diocesi. Repertorio di enti ecclesiastici tra XV e XVI secolo. Mailand: UNICOPLI.
Le Seur, T., F. Jacquier, F. J. (1743). Parere de i tre mattematici sopra i danni, che si trovano nella cupola di S. Pietro …. Rom.
Lefèvre, W. (2004). Picturing Machines. 1400–1700. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Lemonnier, H. (1911). Procès-verbaux de l’Académie Royale d’Architecture 1671–1793. Paris: A. Colin.
- (1922). Procès-verbaux de l’Académie Royale d’Architecture 1671–1793. Paris: A. Colin.
Lentzen, M. (1995). Die humanistische Akademiebewegung des Quattrocento und die ‚Accademia Platonica‘ in Florenz. Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 19: 58-78
Lepik, A. (1994). Das Architekturmodell in Italien 1335-1550. Worms: Werner.
- (1995). Das Architekturmodell der frühen Renaissance. Die Erfindung eines Mediums. In: Architekturmodelle der Renaissance Ed. by B. Evers. München: Prestel 10-20
Licastro, Deborah (2003). Il cantiere del Palazzo Comunale di Osimo. Note sulla realizzazione della `Cortina a matton rotato. Opus 7: 347-364
Lingohr, M. (2006). Architectus. Ein virtus-Begriff der frühen Neuzeit?. In: Die Virtus des Künstlers in der italienischen Renaissance Ed. by J. Poeschke, T. Weigel, T. W.. Münster 13-30
Lomazzo, G. P. (1585). Trattato dell’Arte della Pittura, Scoltura et Architettura. Mailand: Pontio.
- (1973–1975). Scritti sulle Arti. Florenz: Marchi e Bertolli.
Lorenz, H. (1992). Johann Bernhard Fischer von Erlach. Zürich: Verlag für Architektur.
- (2002). L’Italie et les débuts de la maturité baroque en Europe centrale. In: Les soleils du baroque. Rencontre de Porto 1993 Ed. by É. Pommier. Paris 91-113
Lorini, B. (1592). Delle fortificazioni libri cinque. Venedig.
Lotz, W. (1956). Das Raumbild in der italienischen Architekturzeichnung der Renaissance. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 7.1953-56: 193-226
Madonna, M. L. (2008). Introduzione al metodo di rilevamento di Desgodets: un’opera di Scienza e di Stato. In: Antoine Desgodets: les édifices antiques de Rome, edizione in facsimile dell’inedito manoscritto 2718 dell’Institut de France con trascrizioni e apparati scientifici e riproduzione delle tavole del volume edito nel 1682 Ed. by L. Cellauro, G. Richaud. Rom: De Luca Editori d’Arte 9-14
Mainstone, R. J. (1969-1970). Brunelleschi’s Dome of S. Maria del Fiore and some Related Structures..
- (1977). Brunelleschi’s Dome. Architectural Review 165: 157-166
- (2009). Brunelleschi’s Dome Revisited. Construction History 24: 19-30
Comoli Mandracci, V. (1989). La proiezione del potere nella costruzione del territorio. In: Filippo Juvarra a Torino. Nuovi progetti per la città Ed. by A. Griseri, G. Romano. Turin: Cassa di risparmio di Torino 53-74
Manetti, A. (1970). The Life of Brunelleschi. University Park: Penn State University Press.
- (1976). Vita di Filippo Brunelleschi, preceduta da La novella del grasso. Mailand: Edizioni Il Polifilo.
Manfredi, T. (2008). La costruzione dell’architetto. Maderno, Borromini, i Fontana e la formazione degli architetti ticinesi a Roma. Rom: Argos.
Marconi, N. (1999). Uso delle macchine da costruzione e ‚crisi‘ della capacità operativa nel XVIII secolo: il fallimento del trasporto della colonna di Antonino Pio a Roma. Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura 33: 43-54
- (2001). I cantieri di Francesco Borromini a Roma. Apparati, macchine da costruzione e strutture provvisionali. In: Contributi sul Barocco romano Ed. by R. M. Strollo. Rom 101-116
- (2002). Teorie e macchine idrauliche nei cantieri edili tra Rinascimento e Barocco. In: Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell’architettura rinascimentale e barocca Ed. by C. Conforti, A. Hopkins. Rom: Nuova Argos 279-293
- (2003). The baroque Roman building yard: Technology and building machines in the Reverenda Fabbrica of St. Peter’s (16th – 18th centuries). In: Proceedings of the First International Congress on Construction History Ed. by S. Huerta. Madrid: Istituto Juan de Herrera 1357-1367
- (2004). Edificando Roma Barocca. Macchine, apparati, maestranze e cantieri tra XVI e XVIII secolo. Città di Castello: Edimond.
- (2006). Tradition and Technological Innovation on Roman Building Sites from the 16th to the 18th Century: Construction Machines, Building Practice and the Diffusion of Technical Knowledge. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 137-52
- (2007/2008). „Che nessuno ardisca impedir i carri, bufali, garzoni e fattori“. Organizzazione del cantiere e della manodopera a Roma in età barocca. Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée 119: 363-373
- (2008). L’eredità tecnica di Domenico Fontana e la Fabbrica di San Pietro: tecnologie e procedure per la movimentazione dei grandi monoliti tra ’500 e ’800. In: Studi sui Fontana una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco Ed. by M. Fagiolo, G. Bonaccorso. Rom: Gangemi 45-56
Marías, F. (1999). Dalla „città ideale“ alle città reali: prospettive, topografie, modelli, vedute. In: I trionfi del Barocco: architettura in Europa 1600–1750 Ed. by H. A. Millon. Turin 219-239
Mariotte, E. (1686). Traité du mouvement des eaux et autres coprs fluides divisé en V parties. Paris: E. Michallet.
Martinelli, A. G. (1996). Operatori e materili als cantiere della cattdrale di Como tra cinque e seicento. Rivista Archeologica dell’Antica Provincia e Diocesi di Como 178: 169-189
Martines, G. (1999). Macchine da cantiere per il sollevamento dei pesi nell’antichità, nel Medioevo, nei secoli XV e XVI. Annali di architettura 10/11: 261-275
Martini, F. di G. (1841). Trattato di architettura civile e militare, di Francesco di Giorgio Martini, Architetto senese del secolo XV, ora per la prima volta pubblicato per cura del Cavaliere Cesare Saluzzo con dissertazioni e note per servire alla storia militare italiana. Turin: Tipografia Chirio e Mina.
Masi, G. (1788). Teoria e pratica di architettura civile. Per istruzione della gioventù specialmente romana. Rom: Fulgoni.
Masini, R. (2010). Michelangelo e il Ponte a Santa Trinità: dal restauro alle ipotesi compositive. Progetto Restauro 55: 2-8
Matracchi, P. (1991). La Chiesa di S. Maria delle Grazie al Calcinaio presso Cortona e l’opera di Francesco di Giorgio. Cortona: Calosci.
Maurer, G. (2004). Michelangelo – die Architekturzeichnungen. Entwurfsprozeß und Planungspraxis. Regensburg: Schnell und Steiner.
Mazzamuto, A. (1987). Il progettare secondo „L’Architetto Prattico“ e la pratica progettuale di Giovanni Biagio Amico. In: Giovanni Biagio Amico (1684–1754). Teologo Architetto Trattatista Rom: Multigrafica Editrice 117-131
- (2003). Giovanni Biagio Amico, architetto e trattatista del Settecento. Palermo: Flaccovio.
Michelangelo Buonarroti (1965–1983). Il carteggio di Michelangelo. Florenz: Sansoni.
Milizia, F. (1781). Principi di architettura civile. Venedig: Presso Giambatista Pasquali.
- (1972). Principi di architettura civile. Mailand: Mazzotta.
Millon, H. A. (1995). Italienische Architekturmodelle im 16. Jahrhundert. In: Architekturmodelle der Renaissance Ed. by B. Evers. 21-27
Millon, H. A., V. Magnago Lampugnani (1994). The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo: the representation of architecture. Mailand: Rizzoli.
Millon, H. A., C. H. Smyth (1976). Michelangelo and St. Peter’s. Observations on the interior of the apses, a model of the apse vault, and related drawings. Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16: 137-206
Mongitore, A. (1727). Palermo, ammonito, penitente e grato, nel formidabil terremoto del primo settembre 1726. Palermo: Angelo Felicella ed Antonino Gramignani.
Montalto, L. (1958). Il drammatico licenziamento di Francesco Borromini dalla fabbrica di Sant’Agnese in Agone. Palladio 8: 139-188
Moore, D. A. R. (1996). Notes on the use of spolia in Roman architecture from Bramante to Bernini. In: Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer Ed. by C. L. Striker. Mainz: Philipp von Zabern 119-122
Morselli, P., G. Corti (1982). La chiesa di Santa Maria delle Carceri in Prato. Contributo di Lorenzo de’ Medici e Giuliano da Sangallo alla progettazione. Florenz.
Muffel, N. (1876). Beschreibung der Stadt Rom. Tübingen: Litterarischer Verein.
Musschenbroek, P. (1729). Physicæ experimentales, et geometricæ, de magnete, tuborum capillarium vitreorumque speculorum attractione, magnitudine terræ, cohærentia corporum firmorum dissertationes: ut et Ephemerides meteorlogicæ ultrajectinæ.. Leiden: Samuel Luchtmans.
Musso, G., G. Copperi (1885). Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati. Turin: G. Paravia.
Napoli, T. M. (1688). Utriusque Architecturae Compendium. Rom: Ioannes Baptista Molo.
Nerdinger, W. (2006). Ideale Städte – Ideale Gemeinschaften. Platon, Filarete, Morus, Doni, Stiblin, Campanella, Ledoux, Goethe, Morris. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur Ed. by W. Nerdinger. Salzburg 268-291
Nessi, S. (1992). Nuovi documenti sulle arti a Spoleto. Architettura e scultura tra Romanico e Barocco. Spoleto: Arti Grafiche Panetto e Petrelli.
Nicolai, N. M. (1829). Sulla presidenza delle strade ed acque e sua giurisdizione economica: contenente il testo delle relative leggi, regolamenti, istruzioni, e dettaglj di esecuzione ec. con indice de’ capitoli, e delle materie. Rom: Stamperia della Rev. Camera Apostolica.
Niebaum, J. (2001/2002). Bramante und der Neubau von St. Peter: Die Planungen vor dem ‚Ausführungsprojekt‘. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 34: 87-184
- (2008). Zur Planungs- und Baugeschichte der Peterskirche zwischen 1506 und 1513. In: Sankt Peter in Rom 1506–2006 Ed. by G. Satzinger, S. Schütze. München: Hirmer 49-82
- (2013). Die Peterskirche als Baustelle – Studien zur Organisation der Fabbrica di San Pietro (1506 –1547). In: Kirche als Baustelle. Große Sakralbauten des Mittelalters Ed. by K. Schröck, B. Klein, B. K.. Köln: Böhlau-Verlag 60-72
Nifosì, Paolo (1988). Scicli. Una via tardobarocca. Modica: La grafica.
Niglio, O. (2007). Dall’ingegneria empirica verso l’ingegneria della scienza. La perizia dei tre matematici per la cupola di San Pietro (1742). Padua: Il Prato.
Nobile, M. R. (1996). Rosario Gagliardi architetto: Composizione, linguaggio, tecnica. In: Rosario Gagliardi e l’Architettura Barocca in Italia e in Europa Annali del Barocco in Sicilia 3. 82-89
- (1997). Il dibattito sulla facciata delle chiese madri. In: Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane Ed. by A. Casamento, E. Guidoni. Storia dell’Urbanistica: Sicilia 2. Rom: Edizioni Kappa 92-100
- (2002). Un altro rinascimento: architettura, maestranze e cantieri in Sicilia, 1458-1558. Benevent: Hevelius.
- (2004). Cupole e calotte „finte“ nel XVIII secolo. In: Fernando Sanfelice: Napoli e l’Europa Ed. by A. Gambardella. Neapel: Edizioni Scientifiche Italiane 151-161
Ochsendorf, J. (2002) Collapse of masonry structures. phdthesis. University of Cambridge
Oechslin, W. (1993). Il mito della città ideale. In: Principii e forme della città Ed. by L. Benevolo. Mailand: Scheiwiller 417-456
- (2011). Architekturmodell. „idea materialis“. In: Die Medien der Architektur Ed. by W. Sonne. Berlin: Deutscher Kunstverlag 131-155
Orazi, A. M. (1982). Jacopo Barozzi da Vignola: 1528-1550; apprendistato di un architetto bolognese. Rom: Bulzoni.
Pacioli, L. (1509). Divina proportione: opera a tutti glingegni perspicaci e curiosi necessaria. Venedig: Paganius Paganinus.
Pagliara, P. N. (1986). Vitruvio da testo a canone. In: Memoria dell’antico nell’arte italiana. Dalla tradizione all’archeologia Ed. by S. Settis. Turin 5-85
- (1998/1999). Antico e medioevo in alcune tecniche costruttive del XV e XVI secolo, in particolare a Roma. Annali di Architettura 10/11: 233-260
- (2002). Materiali, tecniche e strutture in architetture del primo Cinquecento. In: Storia dell’Architettura Italiana. Il primo Cinquecento Ed. by A. Bruschi. Mailand: Electa 522-545
Palladio, A. (1570). I quattro libri dell’architettura di Andrea Palladio. Venedig: Domenico de’ Franceschi.
- (1980). I quattro libri dell’architettura. Mailand: Edizioni Il Polifilo.
Pallottino, E. (1999). Stucchi in esterno: la nuova scabrosità delle superfici nell’architettura del Seicento romano; precedenti di una tecnica borrominiana tra Como, Genova e Roma.. In: Il giovane Borromini Ed. by M. Kahn-Rossi, M. Franciolli. Mailand: Skira 315-321
Palmas, C. (1990). Appunti sulle fonti per lo studio del cantiere della Basilica di Superga. In: La Basilica di Superga. Restauri 1989-1990 Ed. by C. Palmas. Turin 57-61
Pane, R. (1985). La Lettera d Raffaello a Leone X. Napoli Nobilissima 24: 6-18
Pansini, G. (1989). Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa; 1580–1595. Florenz: Olschki.
Parent, A. (1730). Des résistances des poûtres par rapport à leurs longeurs ou portées, & à leurs dimensions & situations; & des poûtres de plus grande résistance, indépendamment de tout système physique. In: Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, année 1708 Paris: Compagnie des libraires 17-31
Pasini, P. G. (1985). Architettura e cantiere nel settecento, ganzes Heft der Zeitschrift. Romagna Arte e Storia
Passanti, M. (2002). La Palazzina di Caccia di Stupinigi. In: I pioppi di Juvarra: dalla riserva di caccia di Stupinigi al nuovo parco Ed. by M. Barosio, M. Trisciuglio. Atti e rassegna tecnica, N.S. 56. Turin 88-96
Pastor, L. von (1955–61). Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Freiburg: Herder.
Patrizi-Forti, F. (1968). Delle memorie storiche di Norcia. Bologna: Forni.
Paulus, N. (1922/23). Geschichte des Ablasses im Mittelalter. Paderborn.
Payne, A. (2012). The Telescope and the Compass. Teofilo Gallaccini and the Dialogue between Architecture and Science in the Age of Galileo. Florenz: Olschki.
Pentrella, R. (1984). Fabbriche Romane del primo ’500. Cinque secoli di restauri. Rom: Pantheon.
Pepper, S. (2007). Ville idéale – ville ex nihilo – ville militaire. In: Vauban, bâtisseur du Roi-Soleil Ed. by I. Warmoes. Paris 226-233
Pergaeus, A. (1537). Apollonii Pergei mathematique excelentissimi Opera per doctissimum philosophum Joannem Baptistam …. Venedig: Bindonus.
Pérouse de Montclos, J.-M. (2001). L’architecture à la française du milieu du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Paris: Picard.
Perrault, C. (1683). Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la methode des anciens. Paris: Coignard.
- (1684). Les dix livres d’Architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en François, avec des Notes & des Figures. Paris: Coignard.
Pevsner, N. (1973). Academies of Art. Past and Present. New York: Da Capo Press.
Pfisterer, U. (2003). Metzler-Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, Begriffe. Stuttgart: Metzler.
Piana, M. (1987). Le tecniche costruttive nella Venezia del Cinquecento. In: Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento Ed. by A. Manno. Venedig: Istituto veneto di scienze lettere ed arti 375-385
Piccarreta, M. (2002). I palazzi di Vignola in Umbria: attribuzioni tra cronache e documenti. In: Le fabbriche di Jacopo Barozzi da Vignola. I restauri e le trasformazioni Mailand: Electa 53-57
Pifferi, F. (1595). Monicometro instromento da misurar con la vista stando fermo. Siena: Bonetti.
Pinto, J. A. (1991a). Il modello della cappella Pallavicini Rospigliosi. In: In urbe architectus. Modelli, disegni, misure; la professione dell’architetto, Roma 1680–1750 Ed. by B. Contardi, G. Curcio. Rom: Àrgos 50-57
- (1991b). Il modello della Fontana di Trevi. In: In urbe architectus. Modelli, disegni, misure; la professione dell’architetto, Roma 1680–1750 Ed. by B. Contardi, G. Curcio. Rom: Àrgos 70-75
- (1991c). Il modello della Sagrestia vaticana. In: In urbe architectus. Modelli, disegni, misure; la professione dell’architetto, Roma 1680–1750 Ed. by B. Contardi, G. Curcio. Rom: Àrgos 58-69
Piva, P. (1988). L’„altro“ Giulio Romano: il Duomo di Mantova, la chiesa di Polirone e la dialettica col Medioevo. Quistello: Ceschi.
Plinius der Jüngere (1976). Epistularum libri decem. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Poleni, G. (1748). Memorie istoriche della gran cupola del Tempio Vaticano e de’ danni di essa, e de’ ristoramenti loro, divise in libri cinque. Padua: Stamperia del Seminario.
Pomodoro, G. (1599). Geometria prattica tratta dagl’Elementi d’Euclide ed altri Auttori da Giovanni Pomo doro [sic!]Venetiano Mathematico eccellentissimo descritta et dichiarata da Giovanni Scala Mathematico. Rom: Stefano de’ Paulini.
- (1624). La geometria prattica di Gio. Pomodoro Venetiano cavata da gl’elementi d’Euclide e d’altri famosi Autori. Rom: Giovanni Angelo Ruffinelli.
Portoghesi, P. (1971). Roma del Rinascimento. Mailand: Electa.
- (2001). Storia di San Carlino alle Quattro Fontane. Rom: Newton & Compton.
Prager, F. D., G. Scaglia (1970). Brunelleschi: Studies of his Tecnology and Inventions. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Privitera, F. (1695). Dolorosa tragedia rappresentata nel Regno di Sicilia nella citta di Catania…. Catania: Paolo Bisagni.
Procacci, G. (2006). Storia degli italiani. Rom: Laterza.
Pugliano, A. (1994). Arte muraria e terremoto a Palermo. In: L’architettura restaurata. Duplicazioni, copie, restauri Ed. by P. Marconi. Ricerche di storia dell’arte 52. Rom: La Nuova Italia Scientifica 29-57
Ray, S. (1987). L’esperienza architettonica di Raffaello. Oltre ‚El Paragone de li Antichi‘. In: Studi su Raffaello Ed. by M. Sambuco Hamond, M. L. Strocchi. Urbino: QuattroVenti 213-227
Re, E. (1920). Maestri di Strada. Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 43: 5-102
Regnartius, V. (1650). Praecipua urbis Romanae templa. 1641–1642. Rom: Francesco Collignon.
Renn, J., M. Valleriani (2001). Galileo and the Challenge of the Arsenal. Nuncius 16(2): 481-503
Ricci, M. (2007). Storia dell’architettura come storia delle tecniche costruttive. Esperienze rinascimentali a confronto. Venedig: Marsilio.
Robotti, C. (2005). Girolamo Cataneo, Francesco de Marchi, Carlo Theti: teorici e progettisti dell’arte nuova di fortificare. In: Luci tra le rocce, colloqui internazionali „Castelli e città fortificate“; storia, recupero, valorizzazione, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile Ed. by F. Ribera. Florenz: Alinea 299-311
Roggero Bardelli, C. (1989). Da Garove a Juvarra: progetti per la città. In: Filippo Juvarra a Torino. Nuovi progetti per la città Ed. by A. Griseri, G. Romano. Turin: Cassa di risparmio di Torino 75-130
Romano, B. C. (1595). Proteo Militare. Neapel: Gio. Iacomo Carlino, & Antonio Pace.
Rossi, P. A. (1982). Le cupole del Brunelleschi: capire per conservare. Bologna: Calderini.
Rousteau-Chambon, H. (2008). Desgodets et les édifices antiques. In: Les édifices antiques de Rome / dessinés et mesurés très exactement par Antoine Desgodets, architecte. Fac-similé de l’éd. de Jean-Baptiste Coignard, imprimeur du Roi, Paris, 1682 Ed. by P. Gros, H. Rousteau-Chambon. Paris: Picard 13-30
Rowland, I. D. (2003). Vitruvius. Ten Books on Architecture. The Corsini Incunabulum. With the annotations and autograph drawings of Giovanni Battista da Sangallo. Rom: Edizioni dell’Elefante.
Rusconi, G. A. (1590). Della architettura di Gio. Antonio Rusconi. Venedig: Gioliti.
- (1660). I dieci libri d’architettura secondo i precetti de Vetruvio. Venedig: Nicolini.
Saalman, H. (1980). Filippo Brunelleschi. The Cupola of Santa Maria del Fiore. London: Zwemmer.
Sabatino, L. (2005). Lapicidi e marangoni in un cantiere rinascimentale. La Sacrestia della Basilica di Santa Giustina in Padova. Saonara: Il Prato.
Sakarovitch, J. (1998). Épures d’architecture: de la coupe des pierres à la géométrie descriptive: XVIe-XIXe siècles. Basel: Birkhäuser.
- (2002). Architettura e struttura fra tradizione e scienza della costruzione. In: Storia della Scienza Ed. by S. Petruccioli. Rom 495-505
Salvagni, I. (2008). . In: La forma del pensiero: Filippo Juvarra. La costruzione del ricordo attraverso la celebrazione della memoria Ed. by C. Ruggero. Rom: Campisano 33-53
Salvi, D. (2005). Il cantiere di palazzetto Turci, altri cantieri romani del Rinascimento e la tradizione costruttiva medievale nella pianura padana. In: Aspetti dell’abitare e del costruire a Roma e in Lombardia tra XV e XIX secolo Ed. by A. Rossari, A. Scotti. Mailand: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 125-145
Samperi, R. (2006). Nr. 78. In: Leon Battista Alberti e l’architettura Ed. by M. Bulgarelli. Cinisello Balsamo: Silvana
Sanpaolesi, P. (1964). La casa fiorentina di Bartolomeo Scala. In: Studien zur toskanischen Kunst Ed. by W. Lotz, L. L. Möller. 275-288
Sardi, P. (1618). La corona imperiale dell’architettura militare. Venedig: Barezzo Barezzi.
Satzinger, G. (1996). Spolien in der römischen Architektur des Quattrocento. In: Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance Ed. by J. Poeschke. München: Hirmer 249-276
- (2003/2004). Michelangelos Cappella Sforza. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 35: 327-414
- (2005). Die Baugeschichte von Neu-St. Peter. In: Barock im Vatikan. 1572–1676 Ed. by Kunst- Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH. Leipzig: Seemann 45-74
- (2009). Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore. In: Michelangelo. Architetto a Roma Ed. by M. Mussolin, C. Altavista. Cinisello Balsamo: Silvana Editoriale 214-225
Scaccia Scarafoni, C. (1927). L’antico statuto dei ‚Magistri Stratarum‘ e altri documenti relativi a quella magistratura. Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 50: 239-308
Scamozzi, V. (1615). L’idea della architettura universale. Venedig: Giorgio Valentino.
- (1959). Taccuino di viaggio da Parigi a Venezia (14 marzo – 11 maggio 1600). Venedig: Istituto per la collab. culturale.
- (1982). L’Idea della Architettura Universale. Sala Bolognese: Arnaldo Forni Editore.
Scavizzi, C. P. (1983). Edilizia nei secoli XVII e XVIII a Roma. Ricerca per una storia delle tecniche. Rom: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio studi.
- (1991). Navigazione e regolazione fluviale nello Stato della Chiesa fra XVI e XVIII secolo (Il caso del Tevere). Rom: Edilstampa.
Schelbert, G. (2011). ‚[...] de la quale inventione il prudente Architetto si potra molto valere in diversi accidenti`. Beobachtungen zum Gebälk der Säulenordnungen in der Renaissance- und Barockarchitektur. In: Ordnung und Wandel in der römischen Architektur der Frühen Neuzeit. Kunsthistorische Studien zu Ehren von Christof Thoenes Ed. by H. Schlimme, L. Sickel. München: Hirmer 87-103
Schiaparelli, L. (1902). Alcuni documenti dei ‚Magistri aedificorum urbis‘ (secoli XIII e XIV). Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 25: 5-60
Schlimme, H. (1999a). Die Kirchenfassade in Rom. „Reliefierte Kirchenfronten“ 1475–1765. Petersberg: Imhof.
- (1999b). La facciata della chiesa del Gesù di Giacomo della Porta: linguaggio architettonico, proporzionamento, scenografia. Palladio 24: 23-36
- (2002a). Francesco Borrominis Entwurf ‚Az. Rom 187‘ und die Anfänge von San Carlo alle Quattro Fontane. In: Koldewey-Gesellschaft. Bericht über die 41. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 31. Mai bis 4. Juni 2000 in Berlin Bonn: Habelt 95-102
- (2002b). Sant’Antonio Abbate. In: Jacopo Barozzi da Vignola Ed. by R. J. Tuttle, B. Adorni, B. A., Frommel B.. Mailand: Electa 270-271
- (2006a). Between architecture, science and technology: the Accademia della Vachia in Florence, 1661–1662. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 61-96
- (2006b). The Accademia della Vachia. Critical, commented edition of the unpublished manuscript Fondo Nazionale II_46, Biblioteca Nazionale Centrale, Florence. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 155-263
- (2006c). Construction Knowledge in Comparison: Architects, Mathematicians and Natural Philosophers Discuss the Damage to St. Peter’s Dome in 1743. In: Proceedings of the 2nd International Congress on Construction History Ed. by M. Dunkeld, J. Campbell, J. C., Louw J., L. J., H. Louw, H. L.. Cambridge: Construction History Society 2853-2867
- (2006d). Giovanni Amico commenta i danni della cupola di S. Pietro in Vaticano. Lexicon. Storie e architettura in Sicilia 3: 57-61
- (2006e). Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture. Mailand: Electa.
- (2009). Die frühe ‚Accademia et Compagnia dell’Arte del Disegno’ in Florenz und die Architekturausbildung. In: Entwerfen. Architektenausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 20. Jahrhunderts Ed. by R. Johannes. Hamburg: Junius 326-343
- (2010). Formensprache und Bauausführung in Italien im 15.–16. Jahrhundert am Beispiel der Cappella Sforza von Michelangelo und dem Bau kassettierter Wölbungen. In: Koldewey-Gesellschaft. Bericht über die 45. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung Dresden: Thelem 51-67
- (2011a). L’architettura di Vignola fra progetto e costruzione. Divisione del lavoro e processi di decisione nellíedilizia del Cinquecento. In: Studi su Jacopo Barozzi da Vignola Ed. by A. M. Affanni, P. Portoghesi. Rom: Gangemi 379-396
- (2011b). Santa Margherita in Montefiascone. Carlo Fontana und das Wissen um den Kuppelbau. In: Ordnung und Wandel in der römischen Architektur der Frühen Neuzeit. Kunsthistorische Studien zu Ehren von Christof Thoenes Ed. by H. Schlimme, L. Sickel. 121-149
- (2012). Francesco Borromini: Architraves courbes et votes plates. In: L’architrave, le plancher, la plate-forme: nouvelle histoire de la construction Ed. by R. Gargiani. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes
Schlimme, H., D. Holste (2006). 30. Draining a lake. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 228-231
Schneider, R. (1978). Der erste Entwurf des Gartenpalais Althan von J. B. Fischer von Erlach. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 32: 94-98
Schofield, R. (1989). Giovanni Antonio Amadeo. Documents. Como: Ed. New Press.
- (2004). Antico e nuovo in architettura. In: Committenti, cantieri, architetti 1400-1600. Nuovi Antichi Ed. by R. Schofield. Mailand: Electa 7-14
Schröck, K., B. Klein, B. K. (2013). Kirche als Baustelle. Große Sakralbauten des Mittelalters. Köln: Böhlau-Verlag.
Schulte, A. (1904). Die Fugger in Rom 1495–1523 mit Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzwesens jener Zeit. Leipzig: Duncker und Humblot.
Schütze, S. (2007). Sant’Andrea della Valle. In: Rom. Meisterwerke der Baukunst von der Antike bis heute. Festgabe für Elisabeth Kieven Ed. by C. Strunck. Petersberg: Imhof 320-326
Schwager, K., H. Schlimme (2002). La chiesa del Gesù di Roma. In: Jacopo Barozzi da Vignola Ed. by R. J. Tuttle, B. Adorni, B. A., Frommel B.. Mailand: Electa 272-299
Scott, S. C. (2000). Schede. In: Aequa potestas: le arti in gara a Roma nel Settecento Ed. by A. Cipriani. Rom: De Luca
Sedlmayr, H. (1976). Johann Bernhard Fischer von Erlach. Wien: Herold.
Sella, P. (2002). Il cardinale Bibbiena e la Fabbrica di San Pietro: „Libro dell’entrata ed uscita“. In: Revirescunt chartae codices documenta textus: miscellanea in honorem Fr. Caesaris Cenci OFM Ed. by A. Cacciotti, P. Sella. Medioevo 5. Rom: Antonianum 503-553
Serlio, S. (1537). Regole Generali di Architettura di Sebastiano Serlio Bolognese sopra le cinque maniere Thoscano, Dorico …. Venedig: F. Marcolini da Forli.
- (1540). Il terzo libro di Sebastiano Serlio … : nel qual si figurano, e descrivono le antiquita di Roma, e le altre che sono in Italia, e fuori d’Italia. Venedig: Francesco Marcolino da Forli.
- (1545). Il primo libro d’architettura. Paris.
- (1584). Tutte l’opere d’architettura di Sebastiano Serlio bolognese: dove si trattano in disegno, quelle cose, che sono più necessarie all’architetto…. Venedig: Francesco de’ Franceschi.
- (1619). I sette libri dell’architettura. Venedig: Giacomo de’ Franceschi.
- (1994). Architettura civile. Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritti di Monaco e Vienna. Mailand: Edizioni Il Polifilo.
Shearman, J. (1977). Raphael, Rome, and the Codex Escurialensis. Master Drawings 15(2): 107-146
- (2003). Raphael in Early Modern Sources (1483–1602). New Haven: Yale University Press.
Specklin (Speckle), D. (1589). Architectura von Vestungen, wie die zu unseren zeiten mögen erbawen werden, an Stätten Schlössern, und Clussen zu Wasser, Land.... Straßburg: B. Jobin.
Stober, K. (1991). Klar und lichtvoll wie eine Regel. Planstädte der Neuzeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Eine Ausstellung im Karlsruher Schloß beschäftigte sich mit der Stadtgeschichte von Turin. Studi piemontesi 20(fasc. 1): 99-107
Tabarrini, M. (2006). Sul cantiere barocco. In: Roma barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona Ed. by M. Fagiolo, P. Portoghesi. 256-265
Taccola, M. di J. detto Il (1969). Liber tertius De ingeneis ac edifitiis non usitatis. Commented facsimile of Palatino 766 in the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Mailand: Edizioni il Polifilo.
Tadgell, C. (1980). Claude Perrault, François Le Vau and the Louvre Colonnade. The Burlington Magazine
Tartaglia, N. (1537). La Nova Scientia. Venedig: Stephano da Sabio.
Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis (1682). Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis. Amsterdam: Blaeu.
Thoenes, C. (1968). Bemerkungen zur St. Peter-Fassade Michelangelos. In: Munuscula discipulorum Ed. by T. Buddensieg, M. Winner. Berlin: Hessling 331-341
- (1994). San Pietro 1534–36. I progetti di Antonio da Sangallo il Giovane per il papa Paolo III. In: Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura Ed. by H. A. Millon, V. Magnago Lampugnani. Mailand: Electa 635-638
- (1995). St. Peter 1534–1546. Sangallos Holzmodell und seine Vorstufen. In: Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo Ed. by B. Evers. München: Prestel 101-109
- (1996). Antonio da Sangallos Peterskuppel. In: Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer Ed. by C. L. Striker. Mainz: Philipp von Zabern
- (1997). ‚Il Primo Tempio del Mondo‘ – Raffael, St. Peter und das Geld. In: Radical Art History. Internationale Anthologie, Subject: O. K. Werckmeister Ed. by W. Kersten. Zürich
- (1998). Il modello ligneo per San Pietro ed il metodo progettuale di Antonio da Sangallo il Giovane. Annali di architettura 9.1997: 186-199
- (2000). St. Peter’s, 1534–1546. In: The Architectural Drawings of Antonio da Sangallo the Younger and his Circle Ed. by C. L. Frommel, N. Adams. Cambridge, Mass.: MIT Press 33-43
- (2002). Opus incertum. Italienische Studien aus drei Jahrzehnten. München.
- (2006). Michelangelos St. Peter. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 37: 57-83
Thoenes, C., P. Roccasecca (2002). Vignola teorico. In: Jacopo Barozzi da Vignola Ed. by R. J. Tuttle, B. Adorni, B. A., Frommel B.. Mailand: Electa 88-99
Tobriner, S. (1983). La Casa Baraccata: Earthquake-resistant Construction in 18th-Century Calabria. Journal of the Society of Architectural Historians 42: 131-138
- (1985). Angelo Italia and the post-earthquake reconstruction of Avola in 1693. In: Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina Ed. by M. Giuffrè, M. La Motta. Palermo 73-86
- (1989). La genesi di Noto. Una città siciliana del Settecento. Bari: Edizioni Dedalo.
- (1997). Safety and the reconstruction after the Sicilian earthquake of 1693, the 18th-century context. In: Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane Ed. by A. Casamento, E. Guidoni. Storia dell’Urbanistica: Sicilia 2. Rom: Edizioni Kappa 26-41
Toker, F. (1978). Florence cathedral: the design stage. The art bulletin 60: 214-231
- (1983). Arnolfo’s S. Maria del Fiore: A Working Hypothesis. Journal of the Society of Architectural Historians 42: 101-120
Tönnesmann, A. (2006). Erzählte Idealstädte von Filarete bis Ledoux. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur Ed. by W. Nerdinger. Salzburg: Pustet 57-69
Tragbar, K. (2006). De Hedeficiis Communibus Murandis … Notes on the Beginning of Building Regulations in Medieval Tuscany. In: Proceedings of the 2nd International Congress on Construction History Ed. by M. Dunkeld, J. Campbell, J. C., Louw J., L. J., H. Louw, H. L.. Cambridge: Construction History Society 3117-3131
Triglia, L. (1997). Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Alcune riflessioni sullo stato degli studi e sul ruolo delle „varianti“ locali. In: Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane Ed. by A. Casamento, E. Guidoni. Rom: Edizioni Kappa 56-64
Tuena, F. M. (1989). I marmi commessi nel tardo Rinascimento romano. In: Marmi antichi Ed. by G. Borghini. Rom: Leonardo – De Luca 81-97
Tuttle, R. J. (1976). A new attribution to Vignola: a Doric Portal of 1547 in the Palazzo Comunale in Bologna. Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16: 207-220
Valeriani, S. (2003). Historic carpentry in Rome. In: Proceedings of the First International Congress on Construction History Ed. by S. Huerta. Madrid: Istituto Juan de Herrera 2023-2034
- (2005). S. Cecilia in Trastevere und die Geschichte der römischen Dachwerke. Architectura 35(no. 1): 32-46
- (2006). Kirchendächer in Rom: Beiträge zu Zimmermannskunst und Kirchenbau von der Spätantike bis zur Barockzeit = Capriate ecclesiae: contributi di archeologia dell’architettura per la storia delle chiese di Roma. Petersberg: Imhof.
Valleriani, M. (2010). Galileo Engineer. New York: Springer.
Vaquero Piñeiro, M. (2008). „Ad usanza di cave“. Società per l’estrazione di pietre e materiali antichi a Roma in età moderna. In: Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso Ed. by J.-F. Bernard, P. Bernardi, P. B.. Rom: École Française de Rome 523-529
- (2010). Il cantiere „italiano“ nelle città dell’Europa barocca e neoclassica fra rinnovamento e tradizione. In: Mastri d’arte del lago di Lugano alla corte dei Borboni di Spagna Ed. by C. Agliati. Bellinzona: Edizioni dello Stato del Cantone Ticino 103-121
Vasari, G. (1550). Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani […]. Florenz: Lorenzo Torrentino.
- (1878–1885). Le Vite de’piu eccellenti pittori, scultori ed architettori, scritte da Giorgio Vasari. Florenz: Sansoni.
Vasari, G. d. J. (1970). Piante di Chiese [palazzi e ville] di Toscana e d’Italia disegnate dal Cav.re Giorgio Vasari. In: La città ideale. Giorgio Vasari Ed. by V. Stefanelli Tacconi. Rom: Officina Edizioni
Vasic Vatovec, C. (1979). Luca Fancelli, architetto. Epistolario gonzaghesco. Florenz: Uniedit.
Veggiani, A. (1985). I materiali da costruzione nei cantieri settecenteschi della Romagna. Romagna arte e storia 5: 173-184
Verdi, O. (1991). Da Ufficiali Capitolini a Commissari Apostolici: I Maestri delle Strade e degli Edifici di Roma tra XIII e XVI secolo. In: Il Campidoglio e Sisto V Ed. by L. Spezzaferro, M. E. Tittoni. Rom: Edizioni Carte Segrete 54-62
- (1997). Maestri di edifici e di strade a Roma nel secolo XV. Rom: Roma nel Rinascimento.
- (2009). In presentia mei notarii. Piante e disegni nei protocolli dei Notai Capitolini (1605–1875). Rom: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi.
Vérin, H. (1982). Entrepreneurs. Entreprise. Histoire d’une idée. Paris: Presses universitaires de France.
Vesco, M. (2010). Un cantiere barocco a Palermo. Il palazzo di Diego Aragona e Tagliavia, duca di Terranova (1640–1642). Lexicon 10/11: 98-102
Vicioso, J. (1998). Carlo Maderno e le maestranze ticinesi a Roma. Il cantiere di S. Giovanni de’ Fiorentini. Palladio 22: 85-109
Vignola, J. B. da (1562). Regola delle cinque ordini d’Architettura. Rom.
- (1583). Le due regole della prospettiva pratica. Rom: Francesco Zannetti.
Villani, M. (2008). La più nobil parte. L’architettura delle cupole a Roma, 1580–1670. Rom: Gangemi.
Vinardi, M. G. (1989). Le tecniche del cantiere del primo seicento in Piemonte. In: L’architettura a Roma e in Italia (1580–1621) Rom: Centro di studi per la storia dell’architettura 129-137
Vitruvio Pollione, M. (2005). L’architettura / Tradotta e commentata dal Marchese Berardo Galiani. Pref. di A. Pierattini. Rom: Dedalo.
Vitruvius (1486). De architectura libri decem. Roma: G. Herolt.
- (1997). De architectura. Turin: Einaudi.
Vivenzio, G. (1783). Istoria et teoria de tremuoti …. Neapel: nella stamperia regale.
Wallace, W. E. (1994). Michelangelo at San Lorenzo: the genius as entrepreneur. Cambridge: Cambridge University Press.
Walter, C. (1769). Zimmerkunst, oder Anweisung, wie allerley Arten von deutschen und welschen Thurnhauben ... nicht nur zu entwerfen, sondern auch mit Holz zu verbinden ... nach ihrer äusserlichen Gestalt zu verfertigen sind. Augsburg: Veith.
Waźbiński, Z. (1987). L’Accademia Medicea del Disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea e istituzione..
Witthinrich, J. (2006). Stadtutopien und Planstädte. Eine Strukturanalyse. In: Architektur wie sie im Buche steht. Fiktive Bauten und Städte in der Literatur Ed. by W. Nerdinger. Salzburg: Pustet 83-88
Wolff Metternich, F. Graf, C. Thoenes (1987). Die frühen St.-Peter-Entwürfe 1505–1514. Tübingen: Wasmuth.
Wolff, C. (1715). Elementa architecturae civilis. In: Elementa Matheseos Universae Ed. by C. Wolff. Halle 931-1002
Wotton, H. (1969). Henry: The Elements of Architecture, Collected by Henry Wotton from the Best Authors and Examples. Farnborough, Hants: Gregg.
Wurm, H. (1984). Baldassarre Peruzzi. Architekturzeichnungen. Tübingen: Wasmuth.
Yeomans, D. T. (1992). The Trussed Roof: its history and development. Aldershot: Scolar press.
Zabaglia, N. (1743). Castelli e ponti di maestro Niccola Zabaglia. Rom: Pagliarini.
Zanchettin, V. (2003/2004). Via di Ripetta e la genesi del Tridente. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 35: 209-286
- (2006a). Building accounts as architectural drawings. Borromini’s construction practice and the role of Francesco Righi. In: Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture Ed. by H. Schlimme. Mailand: Electa 113-24
- (2006b). Un disegno sconosciuto di Michelangelo per l’architrave del tamburo della cupola di San Pietro in Vaticano. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 37: 9-55
- (2011). Tamburo e cupola di San Pietro nella concezione di Antonio da Sangallo il Giovane. In: Ordnung und Wandel in der römischen Architektur der Frühen Neuzeit. Kunsthistorische Studien zu Ehren von Christof Thoenes Ed. by H. Schlimme, L. Sickel. München: Hirmer 69-85
Zangheri, L. (1977). Avvertimenti e discorsi di Bartolomeo Vanni, Ingegnere Mediceo (1662–1732). Florenz: Uniedit.
- (2000). Gli accademici del disegno. Florenz: Olschki.
Zänker, J. (1971). Die Wallfahrtskirche Santa Maria della Consolazione in Todi, Phil. Diss. Univ.. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.
Zolla, A. (2003). Castel San Giovanni (San Giovanni Valdarno). In: Arnolfo di Cambio urbanista Ed. by E. Guidoni. Civitates: Urbanistica, archeologia, architettura delle città medievali 8. Rom: Bonsignori 39-58
Fußnoten
Hermann Schlimme erstellte folgende Textteile: Abschnitt 2.1: „Die Frühe Neuzeit in Italien“ (vollständig); Abschnitt 2.2 „Bauverwaltung“, einleitender Absatz und Unterabschnitt „Städtische Statuten und Bauvorschriften“, „Capitolati, cottimo und andere bauspezifische Organisationsformen“, „Die Capitani di Parte Guelfa und die Ufficiali di Torre“ und „Maestri delle Strade, Rom“; Abschnitt 2.3 „Bauplanung und Entwurf: Grundsätzliches“ (vollständig); Abschnitt 2.4 „Architekten: Vorbild ‚Antike‘ und institutionelles Umfeld“, Unterabschnitt „Erforschung der Antike als Selbstausbildung der Architekten im 15. und frühen 16. Jahrhundert“, „Entwurfsleitendes Motiv ‚Antike‘“, „Die Accademia del Disegno“; Abschnitt 2.5 „Planung und Wissen um Umweltbedingungen“, einleitender Absatz; Abschnitt 2.6 „Planungs- und Entwurfstechniken“, einleitender Absatz und Unterabschnitt „Zeichnungen“ und „Modelle“; Abschnitt 2.7 „Logistik“ (vollständig); Abschnitt 2.8 „Materialwissen“ (vollständig); Abschnitt 2.9 „Bautechniken“ (vollständig); Abschnitt 2.10 „Bauleute und Bauprozess“ (vollständig); Abschnitt 2.11 „Arten des Wissens und ihre Tradierung“ (vollständig), Abschnitt 2.12 „Wissensentwicklung und Innovation“ (vollständig). Dagmar Holste erstellte folgende Textteile: Abschnitt 2.4 „Bauplanung/ Entwurf: Qualifikation für den Entwurf und entwurfsleitende Motive“, Unterabschnitt „Die Querelle des Anciens et des Modernes“ und „Die Accademia di San Luca“; Abschnitt 2.5 „Planung und Wissen um Umweltbedingungen“, beide Unterabschnitt „Wissen über den Bau in Erdbebengebieten am Beispiel von Sizilien und Kalabrien“ und „Bauen unter Berücksichtigung von Klimafaktoren“; Abschnitt 2.6 „Planungs- und Entwurfstechniken“, Unterabschnitt „Vom Territorium zum dekorativen Detail: Städtebaulicher Entwurf in der Frühen Neuzeit“, „Vom Territorium zum dekorativen Detail: Das Beispiel der Stadtbaugeschichte von Turin“ und „Vom Territorium zum dekorativen Detail: Filippo Juvarras Tätigkeit am Turiner Hof“. Jens Niebaum erstellte folgende Textteile: Abschnitt 2.2: „Bauverwaltung“, Unterabschnitt „Kuppel von Santa Maria del Fiore“, „Reverenda Fabbrica di San Pietro“ und „Santa Maria delle Carceri, Prato“; Abschnitt 2.6 „Planungs- und Entwurfstechniken“, Unterabschnitt „Zum Problem der Planungstiefe in der Renaissance“. Die Autoren danken Hanno Tiesbrummel (Bibliotheca Hertziana, MPI für Kunstgeschichte, Rom) und dem Team vom Berliner MPI für Wissenschaftsgeschichte für die redaktionelle Bearbeitung des Textes.
Die Aussagen aus den Teilen 2.1.2 und 2.1.3 beruhen auf den Aussagen aus den einschlägigen Handbüchern, unter denen Procacci 2006 und Hoppe 2009 hervorzuheben sind.
Beispiel ist ein Rechnungsbuch für San Lorenzo in Florenz aus den Jahren 1441–53, das von einem Angestellten der Medici-Bank geführt wurde. Das Rechnungsbuch war nach allem Anschein nach dem Verfahren der doppelten Buchführung angelegt (debito-credito) und wäre in besonderer Weise geeignet, Möglichkeiten des Wissenstransfers zu exemplifizieren.
Siehe zum Bau der Kuppel des Florentiner Doms den Beitrag von Margaret Haines und Gabriella Battista im vorliegenden Band.
Die Literatur zum Neubau des Florentiner Domes ist überaus umfangreich. Als Ausgangspunkt empfiehlt sich Saalman 1980, 32–57, mit der älteren Literatur; zum ursprünglichen Projekt sind die seither erschienenen Arbeiten von Franklin Toker besonders wichtig, Toker 1978 und Toker 1983. Grundlegend ist die Edition der Dokumente bei Guasti 1887, wesentlich für den institutionellen Hintergrund schließlich Grote 1959.
Saalman 1980, 175; vgl. auch Grote 1959, 68.
Saalman 1980, 176; Grote 1959, 40f.. Schon 1303 war die Opera von der Kommune für ein Jahr der Goldschmiedezunft (Arte Por Santa Maria) anvertraut worden; vgl. Grote 1959, 37.
Grote 1959, 43 ff.; Saalman 1980, 176f..
Saalman 1980, 176. Vgl. dazu die Chronik Giovanni Villanis (Buch. X, Kap. 195): „E’ lanaiuoli ordinarono, ch’ogni fondaco e bottega di tutti gli artefici di Firenze tenessono una cassettina, ove sì mettessono il danaro di Dio, di ciò che si vendesse o comperasse: e montava l’anno, al cominciamento, libbre duemila.“ Zit. nach Guasti 1887, 29, Nr. 33. Zu den auf diese Weise eingenommenen Summen, die schon sehr bald wesentlich bescheidener gewesen zu sein scheinen, vgl. Haines 1989, 95f. Anm. 25.
Am 12. Juli 1366 trat die Opera an die Arti della Seta (oder di Por S. Maria) und dei Medici e Speziali (zu der ersteren gehörten die Goldschmiede, zur letzteren die Maler) mit der Bitte um Entsendung von Spezialisten heran, um über den Dombau zu beraten; am 20. Juli folgte eine entsprechende Anfrage an die Zunft der Steinmetzen. Aus dieser Initiative ging schließlich jene Gruppe von Malern und Steinmetzen hervor, die das im November 1367 gegen die capomaestri Jacopo Talenti und Giovanni di Lapo Ghini endgültig angenommene Dom-Modell entwickelten. Vgl. zu den Ereignissen Saalman 1980, 45ff.; auch Grote 1959, 86ff.; u. Lepik 1994, 34–38.
Die Einrichtung beratender ad hoc-Kommissionen spielte auch in den politischen Entscheidungsprozessen der Republik Florenz eine wesentliche Rolle; man griff also am Dom auf ein bewährtes Instrument zurück, hinter dem sich eine republikanische Mentalität ebenso verbirgt wie ein entwickeltes Gespür für öffentliche Rechenschaftspflicht. Vgl. dazu Haines 1989, 91f..
Dazu ausführlich Lepik 1994, 27–38, mit Dokumenten und der älteren Literatur.
Es handelte sich um die Baumeister Fra’ Jacopo Talenti und Fra’ Francesco da Carmignano von S. Maria Novella, Neri di Fioravante und Giovanni di Lapo Ghini sowie der Maler Taddeo Gaddi; vgl. Guasti 1887, 103. Talenti, Neri, Ghini und Gaddi hatten bereits in den Gutachterkommissionen mitgewirkt, die am 15., 16. und 17. Juli 1355 zur Begutachtung von Francesco Talentis Gesamtprojekt für den Dom bestimmt worden waren und dann auch (freilich ohne definitives Ergebnis) über die Pfeilerformen zu befinden hatte; s. Guasti 1887, 83 f..
Ausführlicher zu diesen Vorgängen Haines 1989, 99–107.
Guasti 1857, 15, Nr.11 (Cupola 2001–2009, O0201074.009va); vgl. Lepik 1994, 60f., zur Bedeutung gerade des Aspektes der Kostenerstattung.
Guasti 1857, 9–11, Nr. 1f.; Haines 1989, 111.
Saalman 1980, 69f., auch zum folgenden.
Guasti 1857, 36, Nr. 71 (16. April 1420) (Cupola 2001–2009, O0201077.034a). Die Tätigkeiten der provisores werden umschrieben als „ad providendum, ordinandum, et construi, ordinari, fieri et hedificari faciendum.“ Es handelte sich also um eine überwachend-beratende Tätigkeit. Vgl. auch Haines 1989, 114f..
Nach der Schilderung Manettis hatten sowohl Ghiberti als auch Brunelleschi mächtige Befürworter in der Stadt. Dass man beide zu gleichrangigen provisores ernannte, könnte als Versuch von Opera und Zunft zu verstehen sein, jede organisierte Opposition gegen das Projekt zu vermeiden; s. Haines 1989, 114f..
Guasti 1857, 38–41 hier 41, Nr. 75 (Cupola 2001–2009, O0202001.170vb). Brunelleschi erhält ab 1. März 1426 (st. c.) 100 fl. pro Jahr und muss dafür „diebus quibus in prefata Opera laborabitur stare morari, et moram continuam in prefata Opera adhibere, sub pena admissionis sui salarii“. Vgl. Saalman 1980, 126. Ghiberti hatte seit Juli 1425 bis Februar 1426 (st. c.) kein Gehalt mehr bezogen.
Zu den Maschinen Prager and Scaglia 1970; Saalman 1980, 148–171. – Verschiedentlich wird in der Literatur behauptet, Brunelleschi sei ab 1433 alleinverantwortlicher Bauleiter der Kuppel gewesen (so etwa Ippolito and Peroni 1997, 17). Das beruht auf einer irrtümlichen Angabe Guastis, die dieser nachträglich korrigierte (Guasti 1857, 45, Nachsatz zu Nr. 84 (Cupola 2001–2009, O0202001.178b); errata corrige ebd., 188). Offenbar wurde diese Korrektur von einigen Forschern übersehen (nicht hingegen z. B. von Krautheimer and Krautheimer-Hess 1982, 414, Dig. 192). Ghibertis Gehalt wurde bis Juni 1436 weitergezahlt; auf die kollegiale Bauleitung wurde niemals gänzlich verzichtet. Ich danke Margaret Haines (Florenz) für Hinweise in dieser Angelegenheit.
Das Ernennungsdekret der Proveditoren liegt in zwei Fassungen vor, die sich u. a. im Hinblick auf die Laufzeit des Vertrags unterscheiden. Das Exemplar in den Büchern der Domopera, vgl. Guasti 1857, 35–37, Nr. 71 (Cupola 2001–2009, O0201077.034a), sieht eine Bestallung bis zur Vollendung der Kuppel vor („a principio usque ad finem“), dasjenige in den Akten der Arte della Lana (entdeckt von Alfred Doren) eine Ernennung „per donec remoti fuerint.“ Bei letzterem dürfte es sich um die schließlich verbindliche Fassung gehandelt haben. Vgl. Fabriczy 1907, 14f.. Warum man ab 1426 jährliche Vertragserneuerungen für nötig hielt, wissen wir nicht; möglicherweise veranlasste die Tatsache, dass man bei immer stärkerer Neigung der Kuppel in eine besonders kritische Phase der Arbeiten eintrat, die Opera zu besonderer Vorsicht.
Guasti 1857, 54f., Nr. 116–118 (Cupola 2001–2009, O0202001.220vc, O0202001.221h, O0202001.221vb).
Guasti 1857, 81, Nr. 221 (Cupola 2001–2009, O0202001.040ve): „Deliberaverunt quod nullus magister scharpellator et murator Opere, qui stat super Cupola ad laborandum, nec aliqua alia persona que laboraret super dicta Cupola, possit diebus quibus laboratur descendere quolibet die semel seu una vice etc.“ Vgl. ebd., Nr. 222 f. (O0202001.054a, O0202001.065i), 225 (O0202001.078m).
Guasti 1857, 80 Nr. 217: 7. Februar 1425 [Kreidetafel] (Cupola 2001–2009, O0204009.096va); 16. Februar 1425 [Uhr] (O0204009.097a) und Nr. 227 (29. Dezember 1428); Saalman 1980, 190. Im August 1427 wurde zu gleichem Zweck beschlossen, „quod caputmagister Opere, expensis Opere, debeat tenere super Cupola unum oriogium pro appuntando dictos magistros“ (vgl. Guasti 1857, 82, Nr. 223 (O02002001.065i)).
Am 6. Mai 1433 erhält ein Ziegelbrenner eine Zahlung für die „fornaciata de’ chuocere del nostro lavorio“ (vgl. Saalman 1980, 190, 274, Dok. 270.1, mit falschem Datum; vgl. Cupola 2001–2009, O0204013.054i). Vgl. auch Manetti 1970, 93–95 (ll. 1021–1026). Bereits seit 1401 bestand die Regelung, dass die Meister zum Schärfen ihrer Werkzeuge nicht den Schmied aufsuchten, sondern dieser täglich zwei Rundgänge unternahm, um sie einzusammeln und wieder auszuteilen.
Guasti 1857, 80, Nr. 219 (Cupola 2001–2009, O02002001.028vb): „Considerantes pericula que possunt cotidie imminere magistris muratoribus qui stant super Cupola ad murandum, propter vinum quod necessario retinetur super dicta Cupola, [deliberaverunt] quod […] non permictat quoquomodo portari […] vinum quod non sit linfatum per tertiam partem ad minus etc.“
Guasti 1857, 82, Nr. 226 (24. Februar 1428) (Cupola 2001–2009, O0202001.078va). Hier wird festgehalten, dass solche Arbeiter, die auf der Kuppel arbeiten, sich aber später für eine Arbeit am Boden entscheiden, eine Gehaltskürzung um ein Viertel in Kauf zu nehmen haben.
Ebd., 83, Nr. 232 (17. September 1432; hier in der Edition von Haines) (Cupola 2001–2009, O0202001.168vf): „Item deliberaverunt quod quando super cupola non potest laborarii, quod magistri muratores qui laborant super dicta cupola non possint laborare inferius cum scharpello, et quod quinque ex eis possint laborare in arricciando et faciendo ea que sunt extra laborerium scharpelli, hac forma, videlicet: quod omnes magistri superius laborantes imbursentur et extrahantur quinque, qui quinque pro illa die possint et laborare teneantur illa die tantum; et sic quolibet die fiat extractio quinque, videlicet eo tempore quo super cupola non laboratur.“ Vgl. Saalman 1980, 191.
Zitiert nach Saalman 1980, 76, § 5: „E da lato della volta dentro si pongha per parapetto assi che tenghino la veduta a’ maestri, per piu loro sicurta“. Zu den Dokumenten von 1425 ebd., 118, sowie die Regesten ebd., 264, Nr. 208.
Zum folgenden bes. Fabbri 2003, 199f.; Haines 2002, 21f. (der Beitrag von M. Haines geht teilweise zurück auf einen älteren Beitrag derselben Verfasserin (Haines 1994); im folgenden wird ausschließlich nach der Arbeit von 2002 zitiert).
Hierzu und zum folgenden ausführlich Haines 2002, 23ff.; Fabbri 2003, 201–203/09.
Dies ein Spitzenwert, der im Jahr 1388 erreicht wurde (fl. 13.734); in den Vorjahren hatten die Einkünfte zwischen 9.336 und 11.474 fl. oszilliert. Vgl. Haines 2002, 40, Tab. 1.
Haines 2002, 34f., 34 f.
So etwa 1368, als der Italien-Zug Karls IV. die Republik bedrohte, oder 1402 im Krieg gegen Gian Galeazzo Visconti. In den beiden Jahren nach 1402 nahm die Opera pro Jahr nur knapp 4.000 fl. ein. S. ebd., 33 f., 41 f. u. a.; Fabbri 2003, 202, 209.
Daher wurden die Notare 1361 gesetzlich verpflichtet, von ihnen aufgesetzte Testamente an die Opera zu melden. Vgl. Haines 2002, 24, Anm. 16.
Ausführlich behandelt von Giorgi and Moscadelli 2001, auf deren Ergebnissen die folgenden Darlegungen basieren.
Weitere Zuwendungen, wie die Rendite aus opera-eigenen Immobilien oder private bzw. testamentarische Spenden, machten einen eher geringen Teil des Gesamtaufkommens aus.
Das folgende ist eine Kurzfassung von Niebaum 2013; siehe dort für ausführlichere Belege.
Grundlegend Schulte 1904, I, 57–66; ferner Paulus 1922/23, III, 170ff..
Vgl. Frommel 1976, 75.
Frommel 1976, 60. Dagegen stellte die Florentiner Domopera ihre maestri und manovali in saisonalen Turni jeweils unmittelbar an; vgl. Haines 1985, I, 89–115, hier bes. 90.
Frommel 1983, 126f.; Frommel 1984, 109–111. Zur Bedeutung solcher unternehmerisch tätiger capomastri s. Ait and Vaquero Piñeiro 2000, 154f..
Die Ernennungsbreven bei Pastor 1955–61, IV.1, 544, Anm. 2f., u. 545 Anm.1; Shearman 2003, I, 186–189; zum tatsächlichen Beginn der jeweiligen Amtszeit s. Frey 1910, 50f., 58f..
Raffael, Giocondo und Giuliano erhielten jeweils die erhebliche Summe von 300 Golddukaten, Antonio ab 1516 die Hälfte. Vgl. ebd.
Lingohr 2006, 304–306. In Mailand wurden 1490 Amadeo und Dolcebuono gemeinsam zu architecti der Domes ernannt. Schofield 1989, 186f., Nr. 214, 219f..
Er wird erstmals am 4. August 1514 mit dieser Amtsbezeichnung erwähnt; vgl. Frommel 1976, 80, Anm. 79; zu diesem Dokument auch Niebaum 2013, 65, Anm. 30.
Ait and Vaquero Piñeiro 2000, 158; vgl. Goldthwaite 1980, 90–94, über opere im Florenz des 14./15. Jahrhunderts. hatte sich wiederholt an Kommissionen zur Auswahl von Entwürfen beteiligt und wurde in anderen Fällen auch als externe Autorität herangezogen. Hierzu sei nur genannt: Kent 2004.
Das Rechnungsbuch ist ediert in Sella 2002, 515–522. Demnach hatte man 1514 und 1515 immerhin mehr als das Anderthalbfache dessen zur Verfügung, was im intensivsten Jahr unter Julius II., 1510, verbaut worden war (hierzu Frommel 1976, 64, Abb. 5).
Dazu Thoenes 1997, 452.
Vgl. Niebaum 2013, 64.
Vgl. die Stimmen bei Günther 1997, 67–112, hier 99. Von den Einnahmen für 1515 kam nur knapp ein Drittel, 1516 weniger als die Hälfte und 1517 nicht einmal ein Viertel der verfügbaren Gelder in der Fabbrica an; vgl. Niebaum 2013, 67f..
Die Bulle abgedruckt im Magnum Bullarium Romanum, 24 Bde., Turin 1857–72, VI, 48–50; für die im folgenden zitierten Passus vgl. auch Niebaum 2013, 68–70.
Vgl. die Wahlordnung der Florentiner Domopera von Ende 1333 bei Guasti 1887, 37–41, Nr. 42, hier 38: „operarii […] in construendo et hedificando et pro construendo et hedificari et construi faciendo habeant plenam baliam auctoritatem et potestatem, prout et sicut in omnibus et per omnia per comune Florentie consulibus Artis lane commissum est“. Vgl. dazu Grote 1959, 45f.; Haines and Riccetti 1996, 267–294, hier, 270f..
Florenz: Guasti 1887, 38; Haines and Riccetti 1996, 271. – Orvieto: Haines and Riccetti 1996, 157–265, hier 261f. – Zu Mailand s. o.
Vgl. die Schilderung der Vorgänge bei Bredekamp 2000b, 63–72, und jüngst Bellini 2011, I, 50–56. Die Quellen bei Bardeschi Ciulich 1977.
Hierzu ausführlich Bredekamp 2008, 147–155.
Vgl. Francia 1977, 49; und Niebaum 2013, 72, Anm. 64; sowie oben, Anm. 15.
Zur persönlichen Schöpfung: Thoenes 2006, 37–83, hier 71–76. Zur Rolle der Deputierten Niebaum 2013, 71f..
Der Bau verfügt über eine weitgehend vollständige Dokumentation und kann zudem als vergleichsweise gut erforscht gelten. Zur Baugeschichte vgl. Morselli and Corti 1982 (mit einem erheblichen Teil der baugeschichtlich relevanten Dokumente); Davies 1995; Cerretelli 2005 (mit weiteren Dokumenten); demnächst Niebaum (in Vorb.).
Das Dokument bei Morselli and Corti 1982, 83f., Nr.1.
Vgl. etwa Zänker 1971, 21–23. – In Pavia hatte sich bereits 1492 eine Bruderschaft von Paveser Laien, die Nobili Deputati, gegründet, um die Madonna di Canepanova zu errichten; ihr gesellte sich 1507 eine zweite Bruderschaft hinzu, die sich schon im folgenden Jahr mit der ersten vereinigte.
Zur Entstehung des Baues Nessi 1992, 57ff..; Campagna 2003; Niebaum 2013.
ASPo, P. E. 2004, c. 1r/v (Oktober 1485, damals gehörten die Spedalinghi der lokalen Spitäler der Misericordia und des Dolce sowie der Propst der Pfarrkirche anscheinend zur Opera hinzu); P. E. 2007, c. 1r; P. E. 1569, c. 1r. Die Vierzahl der Operai hatte bereits Innozenz VIII. in seiner Bulle festgesetzt (vgl. Anm. 80). – In Pistoia, wo sich das Wunder in einer Pfarrkirche ereignet hatte und diese im Neubau aufgehen sollte, gab es fünf Operai, wobei ihr Rektor den fünften Platz besetzte; vgl. Belluzzi 1993, 6f..
Die beiden ersteren werden ihrerseits im Oktober 1485 den Operai zugerechnet (s. vorige Anm.).
Lasagni 2008, 71; vgl. auch Adorni 2002, 131.
Vgl. Matracchi 1991.
ASPo, Statuten der Opera (laut Aufschrift 1542 niedergeschrieben, aber 1485 formuliert), Kap. 3.
Hier wurde für mindestens zehn Jahre eine Steuer von 4 denari je Lira auf alle kommunalen Zölle, d. h. etwas mehr als 1,5 %, beschlossen, eine Regelung, die zum März 1491 in Kraft trat; vgl. Belluzzi 1993, 9f. u. 11, Anm. 41.
Vgl. die Chronik der Ereignisse in Prato, Bibl. Roncioniana, Ms. 86, ediert in Gagliardi 2005, 124.
Vgl. etwa ASPo, P. E. 1288 (Einnahmen- und Ausgabenbuch des spedalingo der Misericordia ab 9. Juli 1484).
Ebd., P. E. 2004, c. 1v.
Ausführlich beschrieben in den Statuten, ebd., Kap. 6.
ASPg, Sezione Spoleto, CRS 81. Dort haben sich einige dieser bigliettini aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erhalten.
Vgl. die Statuten (wie Anm. 92), Kap. 6. Der Provveditore hatte über das Inventar der Opera Buch zu führen (ebd., Kap. 7).
In Pistoia oblag die Buchführung für den Neubau nach den Statuten von 1494 dem Provveditore; sie sollte das Giornale sowie die Entrate e uscite umfassen, war also gewissermaßen ‚schlanker’ als in Prato. Allerdings wurde dem Provveditore bald ein Kämmerer zur Seite gestellt, der die Zahlungen nach den polizze des Provveditore vornehmen und ein eigenes Buch führen sollte. Vgl. Belluzzi 1993.
Der Vertrag bei Morselli and Corti 1982, 87–89, Nr. 6.
Wie sehr die Abwesenheit des Architekten einen Bau verzögern konnte, davon legen die Kirchen Albertis in Rimini und Mantua Zeugnis ab. So lud der Bauherr von S. Sebastiano in Mantua, Markgraf Ludovico II. Gonzaga, am 28. Juli 1463 den in Rom weilenden Alberti nach Mantua ein und erklärte ihm, vor seiner Ankunft mit dem Bau nicht fortfahren zu wollen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Morselli and Corti 1982, Nr. 35; die Gratifikation wird gewährt „gratia et amore et ex urbanitate, et ut vulgo dici solet, per cortesia et pro discretione, postquam dictum edificium dicti oratorii perductum est, opera et industria dicti Iuliani, ad finem debitum et optatum exceptis ornamentis, iuxta formam dicti sui moduli“.
Ebd., 91 ff., Nr. 10 u. passim.
Ebd., 109–111, Nr. 32 (23. November 1488).
Tragbar 2006, 3117. Am MPI für Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main gibt es eine umfangreiche Sammlung der italienischen Stadtstatuten aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit.
Mündliche Information von Klaus Tragbar.
Vgl. Conforti 2001, 15–16. Capitolati sind bisweilen auch Thema von Einzelstudien, von denen hier nur zwei beispielhaft herausgegriffen werden sollen: Altavista 2005 kümmert sich um das capitolato, das im Zusammenhang mit dem 1625–27 in Genua errichteten Palazzo di Gerolamo de Marini entstand. Hier wird aber das capitolato allein genutzt, um die Entstehungsgeschichte des Palastes nachzuvollziehen. Curcio 1990 hat die 1704–1705 datierten capitolati für den Bau der Biblioteca Bertoliana in Vicenza ausgewertet. Die capitolati – daher der Name – wurden getrennt nach Steinmetz-, Mauer-, Zimmermanns-, Tischler-, Fussbodenleger- und Glaserarbeiten aufgestellt. Dem capitolato der Maurerarbeiten war ein Grundriss beigefügt.
Curcio 2000, 63–64. Das Manuskript, das den Titel Origine, e Lode dell’architettura trägt, wird in der Bibliothek des Museo di Roma aufbewahrt, n. 5837.
Die capomaestri sind teilweise namentlich bekannt, vgl. Cerchiai and Quiriconi 1976, 205–207.
Lamberini 1991; das Traktatmanuskript über den Erdfestungsbau wurde von Giovanni Battista Belluzzi verfasst und von Lamberini 1980 publiziert.
Für Francesco I: Cerchiai and Quiriconi 1976; für Federico I: Gallerani and Guidi 1976.
Zangheri 1977, 10–11 und Fußnote 2.2.1.
Eine Kopie des Statuts von 1410 aus dem Jahre 1480 ist veröffentlicht in Scaccia Scaccia Scarafoni 1927.
Verdi 1991, 55–56; Quellen zu solchen Prozessen publiziert Verdi 1997, 87–173.
Quellen wie das registro die gettiti (1554–55) sowie ein Band Taxae viarum (1535–1583), letzterer publiziert in Re 1920, Anhang I, 65–79, zeigen die Aufgaben der Maestri; vgl. Verdi 1991, 58.
Re 1920, Anhang II, 79–85 listet die Namen für den Zeitraum 1425–1583 auf. Für die Namen der Maestri delle Strade in den Zeiträumen vor 1425 und nach 1583 vgl. Schiaparelli 1902, 23–25 bzw. Nicolai 1829, 151–161.
Bentivoglio 1994a, 14, Anm. 12; die zitierten Sottomaestri werden im Band 30, f. 44, Archiv der Presidenza delle Strade (Archivio di Stato di Roma) namentlich benannt.
Aussagen ermittelt aus der Zuccaro Forschungsdatenbank der Bibliotheca Hertziana.
Die liber patentium werden im Archiv der Presidenza delle Strade (Archivio di Stato di Roma) aufbewahrt. Zwei der Bücher, die die Jahre 1641–1655 betreffen, haben sich hingegen im Archiv der Doria Pamphilj erhalten und sind publiziert in Bentivoglio 1994a; Bentivoglio 1994b.
Auch zu anderen Städten gibt es solche Studien. Zu Venedig vgl. Becker 2002; zu Urbino vgl. De Carlo 1966.
Vgl. Portoghesi 1971, 533–590. Portoghesi macht eine haustypologische Untersuchung. Broise 1989, 616–617, interessiert sich v. a. für den Umbau mittelalterlicher Häuser im Rom der Renaissance und zieht die Ripetta-Bebauung zum Vergleich heran. Zanchettin 2003/2004, 237–243 beschreibt die Entstehung der Ripetta-Bebauung im Zusammenhang mit der Entstehung der Via Ripetta.
Ob es einen schematischen Gesamtplan gab, lässt sich nicht sagen. Zanchettin 2003/2004, 238 hält dies für möglich.
Der erste Teil des folgenden Unterabschnitts wurde aus Schlimme 2009, 340–342, übernommen und leicht überarbeitet.
Alberti 1485, 9. Buch (9. Kapitel): „Was es alles an Bauwerken gibt, an allen Orten, welche nach der Meinung und dem übereinstimmenden Urteil der Leute sich bewähren, wird er auf das eingehendste betrachten, abzeichnen, ausmessen und will deren Modelle und Kopien besitzen“; zitiert ist die Übersetzung von Theuer (Alberti 1991), S. 516.
Dazu zählen der 1368–83 in Florenz lehrende Giovanni Dondi, oder Niccolò Niccoli, um den sich Anfang des 15. Jahrhunderts die Florentiner Humanisten scharten. Günther 1988, 14–17, 24.
Man denke an die 1462 gegründete Accademia Platonica in Florenz. Lentzen 1995 stellt die Entwicklung ausführlich dar.
Pacioli 1509 berichtet von diesem Humanistenzirkel im Hause Riarios. Giovanni Sulpicio redigierte die Neuauflage des antiken Vitruvtextes: Vitruvius 1486. Vgl. Daly Davis 1989, 422ff..
Zur Accademia Vitruviana vgl. Orazi 1982, 95–99; Daly Davis 1989, 187–196; Daly Davis 1994, 11–18; Günther 2002. Im Jahre 1542 formulierte Claudio Tolomei in einem Brief an den potentiellen Mäzen Conte Agostino Landi das Arbeitsprogramm der Akademie. Das nur zu kleinem Teil verwirklichte Programm der Akademie wurde 1547 durch Tolomei veröffentlicht und wurde so dem immer bedeutender werdenden römischen Antiquariatswesen zugänglich; Daly Davis 1989.
Zu Vignolas Rom-Aufenthalt vgl. Vignola 1583; zu Philibert de l’Orme vgl. Daly Davis 1989, 187.
Benvenuto Cellini sagte, die künstlerische, aber auch die technische Beherrschung des Materials seien entscheidend, während Architekt ein jeder werden könne, der ein wenig gelesen habe. Vincenzo Danti sagte, Architektur sei auf Regeln und Ordnungen reduziert, so dass heutzutage jeder Architekt werden könne. In der Antike, als die Ordnungen entwickelt worden seien, sei Architektur hingegen eine Arte del Disegno gewesen. Dies mag verdeutlichen, als wie weitgehend die Normierung der antiken Architektursprache in den Traktaten damals wahrgenommen wurde. Vgl. Burioni 2004.
Grundlegend Di Teodoro 1994 und Di Teodoro 2003. Der Brief liegt in drei Versionen vor. Er ist publiziert in Castiglione 1733, 429–436. Zudem gibt es zwei handschriftliche Fassungen in München und Mantua. Die genaue Datierung des zwischen 1513 und 1520 entstandenen Briefes ist strittig. Vgl. auch Shearman 1977, 136–140; Pane 1985; Ray 1987.
Münchener Manuskript c.78v/3v, Di Teodoro 2003, 136. In der gedruckten Version, Castiglione 1733, findet sich der Hinweis auf Bramante nicht mehr.
Castiglione 1733, 430. Im Münchener Manuskript wortgleich mit Unterschieden in der Schreibweise. Im Mantuaner Manuskript heißt es „magni edifici,“ sonst wortgleich mit Unterschieden in der Schreibweise.
Ray 1987, 223–225; die Literatur zu den Villen der Renaissance ist extrem umfangreich. Einen Überblick gibt Burns 2010 bzw. Burns 2012.
Serlio zeigt Bramantes, Raffaels und Peruzzis Planungen für St. Peter. Hinzu kommen Bramantes Tempietto bei S. Pietro in Montorio. Es folgen Bramantes oberer und unterer Belvederehof, Raffaels Villa Madama und die Villa Poggio Reale bei Neapel.
Vasari 1550, Dedicatoria.
Serlio 1537, f. LIII v; zur Analyse Schlimme 1999a, 100–102, 190, 193–196; Schlimme 1999b, 31–32.
Lomazzo 1585, Sechstes Buch, Kap. XLVI Composizioni de gli edifici in particolare; in der Ausgabe von Roberto Paolo Ciardi: Lomazzo 1973–1975, Bd. 2, 355.
Der folgende Unterabschnitt wurde aus Schlimme 2009 übernommen und leicht überarbeitet.
Herauszuheben sind die Monographien von Jack Ward 1972 bzw. Jack 1976, Barzman 1985 bzw. Barzman 2000 und Waźbiński 1987 sowie weitere Studien Barzmans, und die Aufsätze von Bencivenni 2001, Burioni 2004, Carrara 2008 und Schlimme 2009.
Am 24. Mai 1562 wurden die Gebeine des Michelangelo-Schülers Jacopo da Pontormo (1494–1557) in Anwesenheit der größten Florentiner Künstler und Architekten feierlich in die neue Künstlerkapelle in der von den Medici protegierten Kirche Santissima Annunziata überführt. Bei dieser Gelegenheit stellte Giorgio Vasari seinen Plan vor, die Compagnia di San Luca, eine zu Zeiten Giottos 1349 gegründete religiöse Bruderschaft der Künstler, neu zu beleben. Kurze Zeit später beschloss man die Gründung einer Akademie, die von den herausragenden Künstlern gebildet werden und der Ausbildung der jungen Leute dienen sollte; vgl. Kapitel 1 der Statuten von 1563, transkribiert bei Pevsner 1973, 296–304; Original im Archivio di Stato di Firenze, Cod. Magliabecch., 399; zur Gründungsgeschichte der Akademie vgl. neben den in der voraufgehenden Anm. benannten Titeln auch Carofano 1994.
Vgl. Jack 1976, 10.
Vgl. Lingohr 2006.
Burioni 2004, 394–395. Vgl. hierzu auch Bencivenni 2001, 154: Verglichen mit Malern und Bildhauern gebe es in der Akademie sehr wenige Architekten. Die Architekten, die in Ämter gewählt wurden, wären immer gleichzeitig auch Maler oder Bildhauer gewesen. Das gelte für Giorgio Vasari, Francesco da Sangallo, Bernardo Buontalenti, Bartolomeo Ammannati oder Alessandro Pieroni und dies bliebe auch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts so.
Hier zitiert Burioni 2004 die Selva di Notizie von Borghini: Abgrenzung gegenüber den Maurern f. 19–20; gegenüber den Zimmerleuten f. 24. Vgl. Carrara 2006.
Statuten von 1563, transkribiert bei Pevsner 1973, 296–304; Original im Archivio di Stato di Firenze, Cod. Magliabecch., 399.
Ebd., C[apitolo] I.
Waźbiński 1987, 299; die Briefe Paggis sind abgedruckt in: Bottari 1822-1825, Bd. VI, 83, sowie in Barocchi 1971, 191–219.
Laut den Statuten aus dem Jahre 1563 gab es Euklidvorlesungen, in den Jahren 1569–1570 las Pier Antonio Cataldi Euklid, 1570–1574 Egnatio Danti, ab 1589 Ostilio Ricci, ab 1593/95 Antonio Santucci. Lorenzo Sirigatti unterrichtete im späten 16. Jahrhundert Kosmographie und Perspektive an der Akademie. Im Jahre 1639 wurde der Mathematiklehrstuhl von der Universität Florenz an die Akademie verlegt. Für eine ausführlicherer Zusammenfassung des Mathematikunterrichts an der Akademie vgl. Schlimme 2009, 333–335.
Alberti 1485, 9. Buch (5. Kapitel).
Barzman 1985, 381–399; Barzman 2000, 163–172. In seinem Traktat Delle perfette proporzioni von 1567 sagt Vincenzo Danti, er habe 83 Leichensektionen ausgeführt und an ebenso vielen teilgenommen, die von anderen Experten ausgeführt worden waren; Danti 1567, 209; vgl. Waźbiński 1987, 287.
Spini war im Jahre 1567 in die Akademie aufgenommen worden. Waźbiński 1987, 215–234. Das Traktat trägt den Titel: I tre primi libri sopra l’instituzioni de’ greci et latini architettori intorno agl’ornamenti che convengono a tutte le fabbriche che l’architettura compone (Die ersten drei Bücher über die Anleitungen der Griechen und der Lateiner [Römer] hinsichtlich der Ornamente [Gliederungen], die allen Architekturen gemeinsam sind). Das in das Jahr 1569 datierbare Traktatmanuskript von Gherardo Spini umfasst ca. 170 beidseitig beschriebene und illustrierte Seiten, wird in der Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig aufbewahrt und wurde 1980 erstmals veröffentlicht.
Barzman sagt, Vincenzo Borghinis Äußerungen in seiner Selva di notizie (Notizenkonvolut) über die Rangfolge der Künste mache deutlich, dass Architekturlehre sich v. a. auf die Gliederung der Bauten im Sinne der klassischen Architektursprache konzentrierte; Barzman 1985, 408. Zu Vincenzo Borghini vgl. auch Carrara 2000 und Carrara 2006.
Der Brief ist abgedruckt in Barocchi 1962, 117–123; vgl. Waźbiński 1987, 300.
Archivio di Stato di Firenze, Accademia del Disegno, No. 24; vgl. Zangheri 2000, 8.
Ammannatis Traktatmauskript wird in den Uffizien aufbewahrt (3382A bis 3464A) und wurde 1970 publiziert.
Das Manuskript besteht aus 70 Blättern mit Abbildungen auf der einen und beschreibendem Text auf der anderen Seite. Es wird in den Uffizien in Florenz aufbewahrt und wurde 1962 zunächst in Polen, 1970 dann in Italien veröffentlicht.
Vasari wünschte sich, dass er „poterla un’giorno (cosi compiacendosi quella) servirla in qualche cosa“, d. h. dass er eines Tages in die Dienste des Großherzogs eintreten könne: Vasari 1970, 56.
Die hier und im Folgenden referierten Ausführungen zu der Querelle des Anciens et des Modernes basieren im Wesentlichen auf: Kruft 1991, 144ff.. und Freigang 2004, 128ff.. Bibliographische Angaben zu den grundlegenden Quellenwerken der Querelle bei Freigang 2004, 128f., Anm. 13 u. 14.
Eine solche Architekturauffassung tritt insbes. in Claude Perraults Kommentar seiner Vitruvübersetzung (1673) und seinem Säulentraktat (1683) sowie der Parallèle des Anciens et des Modernes (1688–97) seines Bruders zutage. Freigang 2004, 128.
Kruft 1991, 144f.; Kruft verweist hier im Zusammenhang der von der Akademie vertretenen Positionen vor allem auf Louis Hautecoeur und La Bruyère.
Kruft 1991, 146; die Aussage geht auf Henry Lemonnier zurück (Angabe der Quelle Kruft 1991, 146 Anm. 17).
Vgl. Kruft 1991, 146.
Blondel 1675/1683, Teil V, 755 u. 768; zitiert nach Kruft 1991, 149. Zu François Blondel s. Kruft 1991, 146ff..
Perrault 1684, 105, Anm. 7; hier zitiert nach Kruft 1991, 150.
Zu arbiträrer und positiver Schönheit und den diesbezüglichen Darlegungen s. Freigang 2004, 129f. und Kruft 1991, 150ff..
Perrault 1684, 12, Anm. 13; zitiert nach Kruft 1991, 151.
Kruft 1991, 151f.; Zitat Perrault 1683, I; hier zitiert nach Kruft 1991, 152.
Freigang 2004, 129, sowie Kruft 1991, 152.
Die im Text gemachten Angaben zu Antoine Desgodets sind entnommen aus: Rousteau-Chambon 2008, Madonna 2008, Cellauro and Richaud 2008, sowie Kruft 1991, 153f..
Cellauro and Richaud 2008, 29; Madonna 2008, 11; zur Diskussion des Kodex s. Cellauro and Richaud 2008, 30f..
Kruft 1991, 153f; zu Desgodets’ Vorgehensweise bei der Aufmessung s. Rousteau-Chambon 2008, 18ff..
„[…], on ne peut dire que les mesures y soient justes ni que le goût et toutes les particularités des originaux s’y trouvent exactement rapportées dans la vérité puisque la plupart de ces choses sont différentes dans les livres de ces architectes et qu’il est constant que même avant les remarques qui font voir qu’ils n’ont pas dit les choses comme elles sont, ils s’étaient déjà démentis les uns les autres.“ Antoine Desgodets zitiert nach Rousteau-Chambon 2008, 18.
Rousteau-Chambon 2008, 13, 28f; vgl. Kruft 1991, 154. Für die Stipendiaten der französischen Akademie in Rom blieb das Werk fast zweihundert Jahre lang maßgebend. Mehrere Ansätze zu einer aktualisierten Neuauflage spiegeln das Wiederaufleben des Interesses an dem Buch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts; 1779 wurden die Édifices antiques unverändert von C.-A. Jombert Pâris le fils wiederaufgelegt; eine französisch-englische Ausgabe von G. Marshal erschien 1771–1775, eine italienische, von G. Valadier herausgegebene Fassung hingegen erst 1822. Nähere Angaben bei Rousteau-Chambon 2008, 29f..
In Bezug auf die Architektur hieß es in der Rede: „Quanto l’Architettura, diciamo che l’Architetto deve concepire una nobile Idea, e stabilirsi una mente, che gli serva di legge e di ragione, consistendo le sue inventioni nell’ordine, nella dispositione, e nella misura, ed euritmia del tutto e delle parti. Ma rispetto la decoratione, & ornamenti de gli ordini sia certo trovarsi l’Idea stabilita, e confermata si gli esempi de gli Antichi, che con successo di lungo studio, diedero modo a quest’arte; quando li Greci le costituirono termini, e proportioni le migliori, le quali confermate da i più dotti secoli, e dal consenso, e successione de’ Sapienti, divvennero leggi di una mervigliosa Idea, e bellezza ultima, che essendo una sola in ciascuna specie, non si può alterare, senza distruggerla.“ Bellori 1672, Vorwort; zitiert nach Kieven 1999, 193.
Kruft 1991, 113f., 229; Lexikonartikel zur Idea von Andreas Beyer in: Pfisterer 2003, 148.
Vgl. Kruft 1991, 114.
Ein Beispiel hierfür ist ein Zitat von F. Martinelli in Bezug auf Sant’Ivo alla Sapienza in Rom: „Si che fu scelto il Cav. Borromino, al quale per la vivezza dell’ingegno, per la prattica delle regole Vitruviane, e per l’assuefattione ad imitare l’opere de migliori professori d’architettura antichi Greci, e Romani, non dava travaglio il miscuglio de’ cantoni, e delle difficoltà, dalle quali veniva travagliato, et essercitato l’ingegno.“ Fioravante Martinelli: Roma ornata dall’architettura, pittura e scoltura [1660–1663], 274r, v, in D’Onofrio 1969, 1–382, 216.
„Onde pur troppo la deformano quelli che con la novità la trasmutano, mentre alla bellezza sta vicina la brutezza, come li vizii toccano le virtù. Tanto male riconosciamo pur troppo nella caduta del romano imperio, col quale cadero tutte le buone arti, e con esse più d’ogn’altra l’architettura“; Bellori 1672, Vorwort; zitiert nach Kieven 1999, 193. Zu den Zitaten des Fließtextes s. Anm. 216, in der die vorangehende Passage zitiert ist.
Guarini 1968, 15f; zitiert nach Kruft 1991, 119.
Cipriani 2009, 345; Salvagni 2008, 33f; Hager 2000a, 117. Die nachfolgend gemachten Ausführungen zum Abschnitt über die Accademia di San Luca basieren im Wesentlichen auf: Cipriani 2009, Salvagni 2008, Hager 2000a, Hager 2000b, und Kieven 1999, 188ff..
Vgl. Cipriani 2009, 346; Hager 2000a, 117; Zitat nach Hager 2000a, 117.
Eine Ausnahme bildet das Jahr 1604, in welchem mit Ottaviano Mascarino ein Maler und Architekt das Amt innehatte; Cipriani 2009, 348, Anm. 13; genauere Angaben zur Besetzung des Amtes und zu den Statuten bei Hager 2000a, 117. Die ersten, die ihrer Rolle als Architekten wegen das Amt bekleideten, waren Girolamo Rainaldi (1640–41) und Giovan Battista Soria (1648); Kieven 1999, 188; Hager 2000a, 118.
Zur Ausrichtung der Architekturlehre der einzelnen accademici in den Anfangsjahren der Akademie s. Hager 2000a, 117f..
Kieven 1999, 188; Hager 2000a, 118; Scott 2000, 128. Der Entwurf für die neuen Statuten von 1670 enthält bereits eine ausdrückliche Nennung der Architekten; verabschiedet und veröffentlicht wurden diese allerdings erst 1715; Cipriani 2009, 348, Anm. 13.
„l’architetto è l’unico a disporre di tutte le indispensabili conoscenze per trasformare una chimera in un progetto.“ Carlo Fontana zitiert nach Cipriani 2009, 353.
Als Medium der internationalen Verbreitung besaß das illustrierte Werk zur römischen Barockarchitektur von Domenico De Rossi (1708–21) die wichtigste Bedeutung; Kruft 1991, 121.
Hager 2000a, 118. Zu den Architekten, die im 18. Jahrhundert das Amt des principe bekleideten, s. Hager 2000a, 118ff..
Näheres zu der Prüfung der Authentizität bei Hager 2000a, 119.
Vgl. Kieven 1987, 256.
Quatremère de Quincy z. B. schrieb rückblickend: „I moderni, ereditando l’arte e le regole dai Greci, non trovarono altr’obbligo di sottomettervisi che quello derivante dal gusto; arbitro troppo spesso variabile. La diversità de’ costumi e della religione, il cambiamento de’ tempi e de’ climi resero in vari punti inapplicabili ai nuovi bisogni dell’arte di edificare i principi rigorosi e le maniere degli antichi.“ de Quincy and Chrysostome 1985, 223f..
Vgl. Kieven 2000a, 545, 548, 554; Kieven 1988, 22, 29; Kieven 1987, 260. Fugas Fähigkeit, aus pragmatischen Gründen einen Wechsel der Formensprache zu vollziehen, wird besonders gut anhand seiner Entwürfe für den Palazzo della Consultà in Rom evident. Diese veranschaulichen den Übergang zu einem neuen, der antibarocken Haltung seines Auftraggebers Neri Corsini entsprechenden Stil, der den Einsatz von gerader Linie, rechtem Winkel und eine strenge Handhabung der Ornamente erforderte. Kieven 2000a, 548; Kieven 1988, 24; Kieven 1987, 260. .
Zu den neuen, vor allem in England in dem intellektuellen Zirkel um Lord Shaftesbury diskutierten Reformideen siehe z. B. Kieven 2000b, XLIVf..
Vgl. Kieven 2000c, 191; Kieven 1999, 184. Neben Fuga favorisierte Clemens XII. auch Alessandro Galilei, der ebenfalls Florentiner war.
Cipriani 2009, 348ff.. Bei Cipriani, ebd., genauere Auflistung der laut zweier Verzeichnisse verfügbar gewesenen didaktischen Quellen. Im Verlauf des späteren 18. Jahrhunderts wichen die Zeichnungen als Lehrmittel gedruckten Handbüchern; Cipriani 2009, 349. Die frühesten noch erhaltenen Wettbewerbszeichnungen sind jene des concorso von 1677; Hager 2000a, 119.
Rede vom 5. September 1665; Hager 2000a, 119.
Kieven 1999, 199. „Non vorrei […] che alcune credesse che, sotto nome di ragione d’Architettura io intendessi di prescrivere le forme de’ Greci, e de’ Romani come leggi dell’arte, sebbene siano esemplari. Per ciò che appartiene alle forme, io stabilisco che queste debban dipendere dall’uso, e dal modo diverso col quale ce ne serviamo“ (Giovan Battista Passeri, zitiert nach Kieven 1999, 199; Juvarras Schüler Passeri hatte 1714 seine in Rom gemachten didaktischen Erfahrungen aufgeschrieben).
„Ad id quidem hoc devenit studium celebrandi sui operibus istiusmodi, ut etiam urbes posteritatis gratia in sua suorumque nomina condiderint. […] Alii non tam impensae magnitudine quam novis aliquibus inventis fructum posteritatis captavere.“ Alberti 1966, 653. In der deutschen Übersetzung von Theuer lautet die Stelle: „Ja das Bestreben, sich in Werken zu feiern, ging so weit, daß man sogar Städte des Nachruhmes halber auf seinen Namen oder den der Seinigen gründete. […] Andere suchten nicht so sehr mit einem solchen Aufwand von Mitteln als durch irgendeine neue Idee die Frucht des Nachruhms zu pflücken.“ Alberti 1991, 402.
„Adunque si vede quanta lode porgano simile invenzioni all’artefice. Pertanto consiglio ciascuno pittore molto si faccia famigliare ad i poeti, retorici e agli altri simili dotti di lettere, già che costoro doneranno nuove invenzioni, o certo aiuteranno a bello componere sua storia, per quali certo acquisteranno in sua pittura molte lode e nome“; De pictura 1436, 94, Anm. 54 ; hier zitiert nach Grassi and Pepe 1994, 433f..
Zitiert nach Kieven 1999, 184.
Hager 1998, 41–54, Kapitel Le inondazioni del Tevere. Die mit den Baumaßnahmen verbundenen Namen sind Domenico Fontana im 16. Jahrhundert sowie u. a. Carlo Fontana und Cornelius Meyer im 17. Jahrhundert. Vgl. Cornelius Meyer, Modo di far navigabile il Tevere da Perugia a Roma, Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 34.K.16 (Cors. 1227), Roma 1676 mit Illustrationen von Gaspar van Wittel. http://www.lincei-celebrazioni.it/miniatura/2scienze.html (besucht am 20. Mai 2013).
Piana 1987; vgl. auch Pagliara 2002, 522–524.
Zu natürlichen Extremereignissen u. deren Auswirkungen vgl. insbes. Körner 1999b.
Vgl. Guidoboni 1999, 47f..
Guidoboni 1999, 62; zum Thema Erdbebenprävention in der Antike s. auch: Giuffrè 1988, 11.
Alberti, Leon Battista: De re aedificatoria, Buch I, Kapitel VIII; Textlaut in der dt. Übersetzung nach Theuer: „Es besteht in Venedig eine sehr nützliche Einrichtung des Architekten der Markuskirche. Nachdem er nämlich den Grund der ganzen Kirche so dicht als möglich festigte, ließ er mehrere Brunnen offen, daß, sollten sich einmal unterirdische Beben zeigen, diese leicht einen Ausweg fänden.“ (Alberti 1991, 46).
Guidoboni 1987, 215; Pugliano 1994, 44. Bei Guidoboni auch Angabe der Textstelle bei Aristoteles, Auflistung weiterer das Thema behandelnder antiker Autoren mit Nennung der jeweiligen Textstellen sowie weitergehende Ausführungen.
Bei dem Text handelt es sich um einen Auszug aus dem Traktat Libro, o Trattato de diversi terremoti, raccolti da diversi Autori, per Pyrro Ligorio cittadino romano, mentre la città di Ferrara è stata percossa et ha tremato per un simile accidente del moto della terra, ms., Bd. 28 des handschriftl. Werkes von Ligorio, Archivio di Stato di Torino; ausführlicher dazu Guidoboni 1987, 218, Anm. 14.
Ebd., 219–224, 228; Tobriner 1997, 26.
„[…] conviene fare delle fortezze sopra de vani et nelle cantonate et fare i muri ricepienti / [I muri] è di necessità legarli con possenti ferri acciò che non si squassano, et se bene tremano tutti insieme si sostentano. Et perciò anchora per necessità correbbe che si facessero i muri eguali, et egualmente stringarli, acciò che niuno possi forzare quelli della parte di fuori, né da essi scioglierli; pertanto tutti li muri grossi et con honesta sostanza, et ben ligati insieme nelle cantonate o con opera di muro o con chiavi di marmo o di ferro, tutti son immovibili“, P. Ligorio, Delli rimedi contra i terremoti…, c. 59r, c. 60v; zitiert nach Guidoboni 1987, 226, 227.
Vgl. Guidoboni 1987, 224–228.
Barucci 1997, 42; zur Quellenangabe s. Anm. 1, 49 (Di Somma, Agatio (1641). Historico racconto de li terremoti della Calabria dell’anno 1638. Neapel: Camillo Cavallo. 66f. )
Vgl. Triglia 1997, 56.
Vgl. die insgesamt etwas voneinander abweichenden Angaben zu dem Erdbeben bei: Dufour 1981, 525; Guidoboni 1999, 61; Tobriner 1997, 32; sowie unter: http://www.6aprile.it/docs/Articoli/Rapporto_Barberi/Volume_2/sic_n.PDF (Regione Sicilia – Note storiche; vor allem der Auszug aus: E. Boschi et al., Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, SGA – Istituto Nazionale di Geofisica, Bologna; zuletzt gesehen am 29.7.2012); und http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Val_di_Noto (29.7.2012).
Vgl. die ausführlichere Erörterung des Themenkomplexes bei Guidoboni 1999, 52–57 (Kapitel 3.1: Conséquences économiques); Körner 1999a, 31.
Pugliano 1994, 35 (Kapitel 2.3: La trasformazione dell’edilizia storica/Dispositivi giuridici).
Zu den o. g. Angaben im Kontext der offiziell getroffenen Maßnahmen u. des Herzogs von Camastra vgl. die Webseite: http://www.6aprile.it/docs/Articoli/Rapporto_Barberi/Volume_2/sic_n.PDF (29.7.2012): Regione Sicilia – note storiche (den Auszug aus Dufour and Raymond 1993); sowie Dufour 1981, 529; und Dufour and Raymond 1990, passim, 62 (Anm. 27 zu De Grunembergh).
Vgl. Guidoboni 1999, 61.
Ausführliche Diskussion der angewandten Methoden bei Tobriner 1997, 26–32.
Tobriner 1997, 36; das Thema ist ausführlicher erörtert bei: Tobriner 1985 und: Dufour and Raymond 1987, bes. 14–20.
Vgl. Triglia 1997, 58f..
Zu dem schwierigen Prozedere der Entscheidungsfindung vgl. bes. die ausführliche Darlegung in Dufour and Raymond 1990, 11–20, 26–30. Der Entschluss zur Verlegung erfolgte wahrscheinlich sogar trotz des Widerspruchs des Herzogs von Camastra; vgl. hierzu und zu den von Giuseppe Lanza in diesem Kontext vorgebrachten Argumenten, ebd., 26, 27.
Vgl. ebd., 27.
Ebd., 11, 30–33 (Kapitel 4: L’intervento di Angelo Italia); und Dufour and Raymond 1987, 23–26.
Tobriner 1989, 92; die im folgenden nach Tobriner (ebd.) zitierte Stelle lautet: „… per avere ogn’uno degl’abbitanti il commodo di poter quardarsi delle scosse della Terra (che Dio ci liberi) col mezzo di poter uscire dalle proprie case e riconevarsi nei Piani med/i per così sfugire dai pericoli di poter essere colpiti anche dalle rovine dello lor case“; Paolo Labisi: La scienza dell’architettura civile, ms., Biblioteca Comunale di Noto, 1773, IV, ff. 9v, 10.
Brief vom 15. März 1693; Dufour and Raymond 1990, 62, Anm. 27.
Vgl. Tobriner 1997, 34; http://www.comune.catania.it/la_città/culture/progetto-culturale-per-catania/storia/700-Ricostruzione_e_Fioritura.aspx (30.7.2012); http://www.comune.catania.it/portale/comctnet/storia_catania/ricostruzione.asp (4.6.2007); http://www.cormorano.net/catania/cultura/camastra.htm (5.2.2007).
„Somministra con indefessa assistenza impulso ai Cittadini di gareggiare all’innalzamento delle novelle fabbriche nei designati limiti dell’organizzata pianta la quale con grido di universal godimento fu dall’accuratezza di segnalati Architetti (secondo i dettami da lui suggeriti) ideata con la cruciera di due ben concertati stradoni a guisa di Palermo, …“ (Privitera, F. (1695). Dolorosa tragedia rappresentata nel Regno di Sicilia nella citta di Catania…, Catania: Paolo Bisagni.; hier zitiert nach Fichera 1934, 42).
Vgl. z. B. Triglia 1997, 56; Körner 1999a, 36.
Vgl. Triglia 1997, 56.
Stich; 387 x 507 mm; publiziert in Mongitore 1727. Angaben entnommen aus: La Duca 1975, Bd. 1 (Text), 144f., Anm. 50, Bd. 2 (Tafeln), Tav. IX.
Federzeichnung auf Papier, aquarelliert, 805 x 538 mm; aufbewahrt in der Biblioteca Comunale di Monreale. Angaben entnommen aus und abgebildet z. B. bei: La Duca 1975, Bd. 1, 140f., Anm. 48.
Zu Vorangegangenem vgl. Pugliano 1994, 37–39.
„Ne’ terreni paludosi possono fabricarsi i Fondamenti non continuati, ma con pilastroni ben grossi, e fra essi si volteranno archi, […] che saranno più sicuri. Io mi sono ancor servito d’una tal maniera in terreno sodi, ed è riuscita molto soda la fabrica, e di minore spesa, molto più se l’Edificio verrà composto di colonne, o pilastri, di modo che sotto essi incontrassero il pilastrone del Fondamento; ed in tal caso s’accelererà la fabrica, e si risparmierà la spesa.“ Ebd., 61f.
Vgl. Pugliano 1994, 38, 50 (Anm. 36); Barucci 1997, 46. „Non devesi questa massa piantare o fondare in terra, ma posare soltanto sopra un pavimento di pietre più grande della pianta della casa“ (Milizia 1972, dritter Teil, Buch III, Kap. IX, 497; vgl. Pugliano 1994, 50, Anm. 36).
Labisi, Paolo: La scienza dell’architettura civile, 1773, ms., Biblioteca Comunale di Noto, 1v.
Wolff, Christian: Gli elementi dell’architettura civile di Cristiano Volfio, tradotti dal latino da F.M. Sortino, 1746, ms., Biblioteca Comunale di Noto.
Die Elementa architecturae civilis bilden ein Kapitel des Wolffschen Traktats Elementa Matheseos Universae: Wolff 1715, Teil II, 931–1002; Abb. der craticola auf Taf. XII, Abb. 19. Bei Labisis Illustration handelt es sich um eine getreue Kopie des Wolffschen Originals.
Zur Fundament-craticola, zu Wolffs Traktat und Labisis Übernahme vgl. insbes. Barucci 1997, 42f., Fig. 1; Tobriner 1997, 34 (Fig. 11), 39; Tobriner 1989, 187–190. Wolffs Traktat war in jenen Jahren in Sizilien verbreitet; in Noto gab es eine Reedition von 1732 (Barucci 1997, 46).
A. Mongitore: Memorie dei pittori…, 1742, ms., Biblioteca Comunale di Palermo, f. 130r-v.: Amico „cooperò mirabilmente al riparo di Palaggi e Chiese malmenate dal terremoto del 1726, anche contro l’opinione di molti, che stimavano doversi atterrare e rifabbricarsi: sicché si guadagnò la stima universale di tutti, salendo in alto grido il suo nome.“ Zitiert nach Pugliano 1994, 49, Anm. 26; zu den Angaben vgl. Pugliano 1994, 36 und Mazzamuto 2003, 16.
Vgl. Schlimme 2006d, 58. Die Manuskriptstelle lautet folgendermaßen: „Per quanto poi spetta à chiudersi le fissure fatte dalli continui movimenti, […] facilissimamente si prattica con interpollargli alcune catene di Pietra ben soda fatte nella forma si veggiono espressate nella dietro Pianta lettera [4v.] I. e collocate nello spaccato interiore della Cupola, delle quali catene ne porto tutta la sperienza per averle à meraviglia provate nel riparare le grandi rovine accadute nella Città di Palermo pe(r i)l Terremoto dell’anno 1726 delle quali mirabilmente se ne distingue l’unione dei Peli occasionati dalle fiere scosse del Terremoto in molte magnifiche fabriche di Case, e Tempij di detta Capitale […]“; ms., Biblioteca Apostolica Vaticana, Cicognara V 3849, 4r, 4v; hier zitiert nach der Transkription in Schlimme 2006d, 61.
In nur drei Fällen stellt Amico eigene Entwurfslösungen vor; s. dazu Mazzamuto 1987, 118.
Pugliano 1994, 43; ein Beispiel für eine direkte Thematisierung von Erdbeben bildet die von Napoli und Amico vorgenommene Auseinandersetzung mit der antiken Erdbebenprävention durch Entlüftungsschächte; vgl. ebd., 43f.
„nè per assicurarlo [il muro] sarebbono di bisogno legature, o catene grosse di ferro, le quali oltre il dispendio, non recano molta sodezza, e portano deformità alla fabbrica.“ (Amico 1726, I, Teil II, Kap. XVIII, 64f). Vgl. Pugliano 1994, 42.
Vgl. Pugliano 1994, 40.
Amico 1726, I, Teil II, Kap. XVIII, 65: „quanto più le mure s’alzano, tanto più si diminuiscono, facendo quelle del primo solaro più sottili de i fondamenti, quelle del secondo più sottili del primo, e così appresso. […] Il muro s’alzerà sempre a piombo, e che col suo mezzo caschi sopra il mezzo di quello di sotto; onde il muro riesca in forma piramidale…“ Vgl. Pugliano 1994, 44f..
Pugliano 1994, 48; Tobriner 1997, 37; Nobile 2004, 156; bei Nobile und Tobriner findet sich der Verweis auf folgende, nicht publizierte Arbeit als Informationsquelle: La Duca, Rosario (1995). Terremoti, norme antisismiche ed architettura a Palermo tra Settecento e Ottocento, Laurea Honoris Causa, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo. Palermo.
Vgl. Tobriner 1997, 37; Nobile 2004, 154; Nobile 1996, 87. Nobile verweist auf die im Zusammenhang mit der Baustelle von SS. Salvatore durch einige der Gutachter vorgeschlagene Möglichkeit der Anwendung einer leichteren Kuppelschale (ebd., 88, Anm. 27); hierzu s. auch Nobile 2004, 154.
Nobile 1996, 87; Nobile 2004, 154; Lazzara war Schüler von Paolo Amato, welcher Beziehungen nach Spanien unterhielt, ein Faktum, weswegen Nobile eine Einflussnahme spanischer Traktate auf die Entwicklungen in Sizilien für wahrscheinlich hält. Im Besonderen verweist Nobile auf die Theorie und die Kuppeln encamonadas von Fray Lorenzo De San Nicolas (Arte y uso de la Arquitectura. Madrid 1633–1664); vgl. Nobile 1996, 87, 88 Anm. 30.
Nobile 1996, 86; Tobriner 1997, 37; Nobile 2004, 152; vgl. Nifosì 1988, 37f., Anm. 3. Gagliardi führte folgendermaßen aus: „questo [dammuso] deve farsi finto con l’ossatura di legname virgoni con gisso sotto e sopra, non già reale, e ciò unicamente per più facilmente resistere alle scosse del terremoto, che suole più offendere a li dammusi reali che a quelli finti; und fügt noch hinzu: Per non aggravare però di maggiori spese che vi concorrono nel dammuso finto questo ingegnere relante è di sentimento di farsi il dammuso regalino“; zitiert nach Nobile 2004, 152.
opus craticium, einige Beispiele erhalten in Pompeji und Herkulaneum; Barucci 1997, 46 und Anm. 16.
Vgl. Barucci 1997, 42, 46. Durch den mangelnden lokalen Bestand an hochstämmigen Bäumen war auf Sizilien ein Einsatz nur in limitierter Form möglich. Eine Anwendung hölzerner Armierungen lässt sich im Kontext der postseismischen Bauaktivität nach 1693 in Ostsizilien konstatieren; für diesen Fall weisen zudem Dokumente den Einsatz kalabresischen Holzes für die Errichtung provisorischer Baracken nach; ebd., 42.
Barucci 1997, 46; zur portugiesischen gaiola s. auch Tobriner 1997, 36 (Abb. 14–15), 39.
Ebd., 46f.; Milizia 1972, Dritter Teil, Buch III, Kap. IX, (.
Die casa baraccata ist ausführlich beschrieben und diskutiert in Tobriner 1983, bes. 133–135.
Vgl. Giuffrè 1988, 13; Barucci 1997, 46, 48; Tobriner 1983, 135; Tobriner 1997, 29. Zur schriftlichen Fixierung der Gesetze auf der Basis von Richtlinien, die der Ingenieur Francesco La Vega erstellte, vgl. Tobriner 1983, 134f..
„Al principio […] per ripararsi dalle piogge e dal caldo, facevano [gli uomini] le coperture di canne e frondi: ma perchè queste coperture potessero resistere alle piogge dell’inverno, le fecero aguzze, e così coprendo di loto i tetti inclinati, davano scolo alle acque.“ Vitruvio Pollione 2005, Buch VI, Kap. I, 26.
„Saranno gli edifizj privati ben disposti, se dal bel principio si rifletterà agli aspetti, e ai climi, ne’ quali si fabbrica; imperciocchè è fuor di dubbio, che abbiano a essere diverse le fabbriche, che si fanno nell’Egitto da quelle nella Spagna, diverse quelle del Ponto da quelle di Roma, e così anche negli altri paesi: giacchè una parte della terra è sottoposta al corso del sole, un’altra ne resta lontana; e l’altra, che è nel mezzo, è temperata. Laonde siccome la costituzione del cielo riguardo alla terra, per l’inclinazione del zodiaco, e per il corso del sole, è naturalmente dotata di diverse qualità, con questa stessa regola conviene formare gli edifizj secondo il temperamento de’ luogi, e i varj aspetti del cielo.“ Ebd., Buch VI, Kap. I, 132.
Ebd., Buch VI, Kap. I, 134f.
„Sotto il settentrione si hanno a fare le abitazioni a volta, il più che si può riparate, non aperte, anzi rivolte agli aspetti caldi: ne’ luoghi meridionali all’incontro sottoposti alla veemenza del sole, perchè vi si muore dal caldo, si debbono fare aperte, e rivolte o a tramontana, o a greco: così coll’arte si ripara al danno, che sarebbe da se la natura; si prenderà negli altri paesi della stessa maniera un temperamento corrispondente al loro clima.“ Ebd., Buch VI, Kap. I, 132.
„[…] la prima avvertenza che l’architetto debba avere è di considerare in che clima, plaga, ovvero provincia si ha a fare l’edifizio, e la complessione di quel luogo avvertire: perocchè il sole per i suoi varii moti diversamente discorre sopra la terra abitabile, varie zone causando, come l’esperienza ne insegna, onde varie complessioni e qualità non solo nelle piante e animali produce, ma ancora nelle pietre e loci diversi. Per questo altre considerazioni sono necessarie ad uno edifizio in Egitto, altre in Alamania, altre in Ispagna, altre in Italia, altre nella parte opposta ad Ispagna [Anm.: Vitruvio VI. 1]; […]. E per questo le case da farsi sotto il mezzogiorno, debbono verso il settentrione con lumi e con stanze più usate e abitate esser volte: e per contrario quelle sotto settentrione verso mezzogiorno: […].“ Martini 1841, Buch II, Kap. I (.
Ebd., Buch II, Kap. VIII (Delle varie specie di case private, e delle parti interne di esse. Dei tetti e dei giardini), 178.
„A perfezione eziando della casa, è da dividere quella in due parti, in una delle quali siano ordinate le stanze e abitazioni per il verno, e nell’altra parte la state: e quella parte debba essere con maggiore diligenza ordinata, il quale loco dominasse (sic). Le stanze per il verno sieno volte, come è detto, a mezzogiorno, sieno in volta e piccole: quelle per la state per contrario volte verso borea, ample e aperte.“ Ebd., Buch II, Kap. I, 158.
„[…] è da avvertire che poca grossezza di muro è sufficiente a resistere al freddo, ma volendo ostare al caldo bisogna fare i muri grossi: […].“ Ebd., 158.
„La universale altezza non sarà manco di piedi XXI, ma dove sarano luoghi mezzani et picoli, quelli si amezzarano, et dove alcuna camera sarà troppo alta per abitarvi al tempo freddo, se gli farà un suolo morto a quella bassezza che vorà il padrone, facendovi un sottocielo dipinto e dorato.“ Serlio 1994, Buch VI, 38v, (.
„[…] è da avere avvertenza che essendo ne’ luoghi bassi l’aere molto grosso, generalmente è infetto, e in luoghi eminenti per contrario troppo sottile e penetrativo: fa adunque di bisogno per conservazione della sanità, nei luoghi bassi edificare con più solari, e più abitare le stanze alte che le basse: e così per contrario nei luoghi montuosi e alti, dove è sottile l’aere, edificare da basso e fare lato l’edifizio e non alto; la qual regola in Italia poco si osserva, anzi quasi il contrario in molte città si vede usarsi.“ Martini 1841, Buch II, Kap. I, 158.
„I primi uomini, come si legge in Vitruvio, fecero i coperti delle abitazion loro piani, ma, accorgendosi che non erano difesi dalle pioggie, costretti dalla necessità, cominciarono a farli fastigiati, cioè colmi nel mezo. Questi colmi si deono fare e più e meno alti secondo le regioni ove si fabrica, onde in Germania, per la grandissima quantità delle nevi che vi vengono, si fanno i coperti molto acuti e si cuoprono di scandole, che sono alcune tavolette picciole di legno, overo di tegole sottilissime, ché, se altramente si facessero, sarebbono dalla gravezza delle nevi ruinati. Ma noi, che in regione temperata viviamo, dovemo eleggere quell’altezza che renda il coperto garbato e con bella forma, e piova facilmente. Però si partirà la larghezza del luogo da coprirsi in nove parti, e di due si farà l’altezza del colmo, perché, s’ella si farà per il quarto della larghezza, la coperta sarà troppo ratta, onde le tegole over coppi vi si fermeranno con difficultà; e se si farà per il quinto, sarà troppo piana, onde i coppi, le tavole e le nevi, quando vengono, aggreveranno molto.“ Palladio 1980, Buch I, Kap. XXIX (.
„Let thus much suffice at the present for the Position of the severall Members, wherein must bee had as our Author doth often insinuate, and especially lib. 6. cap. 10. a singular regard, to the nature of the Region: […].“ Wotton 1969, 9; sowie: „But let mee here adde one observation; That our Master (as appeareth by divers passages, and particularly lib. 6. cap. 9) seemes to have beene an extreame Lover of Luminous Roomes; And indeede I must confesse that a Franke Light, can misbecome noe A Edifice whatsoever, Temples onely excepted; […]. Yet on the other side we must take heede to make a House (though but for civill use) all Eyes, like Argus; which in Northerne Climes would be too could, In Southerne, too hot: And therefore the matter indeede importeth more then a merry comparison.“ Ebd., 55f.; vgl. Kruft 1991, 260.
Scamozzi 1982, Bd. 2, Buch VIII, Kap. XXII ( (Königliche, sakrale oder profane Gebäude erfordern unterschiedliche Dächer, wiederum andere Gebäude von minderem Rang. Andere müssen auch angewandt werden, wo ein gemäßigtes Klima herrscht; und in Spanien, Frankreich und Deutschland andere als hier in Italien und nochmals andere in weiteren unterschiedlichen Ländern.).
Ebd., 343: „Qui nell’Italia per la maggior parte si fanno i coperti non meno alti, che il quinto della loro lunghezza, nè più del quarto, dove concorrono molte acque: e da queste due misure del più, e del meno, noi ne componiamo una sola, che viene ad esser una delle quattro parti, e meza, overo de i duoi nomi della lunghezza, della quale ne habbiamo trattato à lungo altrove, & che riesce ottimamente alla vista de’ Frontespici, e serve anco molto bene à portar via l’acque piovane.“
Ebd., 345 (Was die Höhe der Dächer in Deutschland und auch in Frankreich und anderen Ländern, wo viel Schnee und Wind regieren, betrifft, sorgen sie [die Bauleute] bei ihren Dächern – insbesondere bei sehr großen Gebäuden – mit Hilfe eines gleichseitigen Dreiecks [gemeint ist der Dachquerschnitt] dafür, dass der Regen von den Dächern abfließt; und zwar, damit der Schnee nicht darauf liegen bleibt, der in der österreichischen Stadt Wien und der böhmischen Stadt Prag sowie in vielen anderen Städten sehr lange liegenbleibt.).
Ebd. 344 (In Deutschland beachten sie [die Bauleute] eher aus einem gewissen Brauch als aus Notwendigkeit, die Dächer ihrer Häuser und Paläste sehr steil und mit flachen viereckigen oder in Fischschuppenform gemachten Dachziegeln zu gestalten, wie man es bis zu den Grenzen Lothringens sehen kann.).
Ebd., 345: „Nella Franca Contea di Borgogna, à differenza della Germania, usano i loro coperti assai piani, come ad angolo retto, overo del Pentagono, ò dello essagono; poiche il paese non è tanto sotto posto alle nevi, e ne’loro coperti adoprano legnami de Rovi, & Olmi, e simiglianti duri, e forti, & i cuoprono di lastoline di pietra più, e meno gentili; […].“
„Nach dem, was wir in Deutschland und Frankreich beobachtet haben, machen die ersteren die Dächer besonders steil; weil in Frankreich, wo es bisweilen starke Winde gibt, die den Regen nach oben treiben, und mit besonderer Vehemenz der Circio-Wind, oder Maestro Tramontana, der den Häusern die Dächer abdeckt, […]. Und in Deutschland fällt viel und häufig Schnee, der aufgrund der großen Dachneigung nicht liegen bleibt. Wären sie [die Dächer] flach oder wenig geneigt, würde er [der Schnee] diese stark belasten und die Bauten gefährden“. Ebd., 345.
Ebd., 345: „E per dir anco assai della Frãcia, essi fanno i loro tetti in varij modi, e per la maggior parte gl’usano in forma del triangolo in trascorso, equilatero, altri poi come à Cialon Città grande, e bella posta sopra alla Marne, li fanno alquanto più piani de’ nostri d’Italia, e come à dire del quinto della larghezza, e pur li cuoprono de coppi; di modo che si vede, che vanno variando secõdo la qualità della materia, c’hanno da coprire, come le acquaie piane, le lastre d’Arduosa, e simiglianti, che non hanno sponde.“
Scamozzi 1959, 48; der vollständige Satz lautet dort: „Coprono tutte le case de coppi come da noi nella Lombardia; e qui è da notare che tutti i coperti sono piani più de nostri, di modo che non è vero che per il paese, ma per la qualità della materia principalmente, che sono le acquarie piane, l’arduosa, e simiglianti fano i coperti acuti.“; darüber hinaus Scamozzi 1982, Band 2, Buch VIII, Kap. XXII, 344. Vgl. auch die Anmerkung von Franco Barbieri in Scamozzi 1959, 110, Anm. 53; sowie Pérouse de Montclos 2001, 43.
„Et sur le 29e chapitre du mesme livre [Palladio, Buch I], où il est parlé des couvertures, l’on est aussy demeuré d’accord que leurs élévations doivent avoir rapport aux différens pays, qui demandent qu’il y en ait de plus droites à cause des neiges et des vents, et aussy selon les différentes matières dont elles sont couvertes; celles de plomb, qui sont les plus pesantes, seront plus plates et moins élevées que celles de tuilles, et celles de tuille moins que d’ardoise, en sorte qu’on peut eslever les combles depuis l’équierre jusques au triangle équilatéral.“ Lemonnier 1911, 39.
Colbert 1979, Bd. V, 247 (19. Observations sur les plans et élévations de la façade du Louvre, envoyés de Rome par le Cavalier Bernin. [1664]). Ein Auszug aus der Textstelle lautet: „2° Il est pareillement nécessaire de considérer le climat sous lequel ce grand palais doit estre situé, les matières avec lesquelles il doit estre construit, les maistres qui le doivent habiter, et les officiers qui doivent prendre soin de sa conservation.“ Vgl. Tadgell 1980, 327.
Colbert 1979, Bd. V, 247 (Nach allbekannter Erfahrung ist sicher, dass die Menge an Regen und Schnee, die im Winter auf Paris fallen, verhindert, dass Terrassen – und nicht einmal die flachen Dächer – dies länger als zwanzig oder dreißig Jahre überdauern können). Siehe auch das Zitat in der folgenden Anm.
„Pour ce qui concerne le climat. Il est certain que depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de may, le froid et l’humidité, per la quantité de pluie e de neige, sont tels qu’ils obligent à avoir du feu dans les appartemens pendant tout ce temps, c’est-à-dire sept à huit mois de l’année. En sorte qu’il est nécessaire, dans les bastimens de France, de chercher plutost à se garantir du froid que du chaud, qui n’est jamais assez grand pour donner de l’incommodité au plus qu’un mois ou six semaines de l’année; encore cela arrive-t-il assez rarement. De plus, il est encore certain que cette abondance de pluie et de neige, jointe au vents, a fait connoistre jusqu’à présent, par un nombre infiny d’expériences, qu’il est impossible de maintenir des terrasses, ni mesme presque des combles plats, n’y ayant en France nulle matière qui y ayt pu résister jusqu’à présent. Et cette humidité qui reste d’un si long hyver en dedans des maisons est telle, qu’il est nécessaire de les exposer à l’air et au soleil, tout autant qu’il est possible.“ Ebd., 260 (21. Mémoire des observations qui ont été faites sur les Beaux dessins du bâtiment du Louvre envoyés au roi par le Cavalier Bernin).
Chantelou 1981, 209 (23 septembre 1665): „L’après-dînée, j’ai mené M. l’abbé d’Argenson voir le Cavalier. Il lui a fait accueil et m’a prié de lui faire voir les dessins du Louvre. Après les avoir bien considérés, il a été fort aise que les grands combles à la mode en aient été bannis et la vue des cheminées.“ Vgl. Pérouse de Montclos 2001, 44.
Chantelou 1981, 26 (7 Juni 1665) (Als er [Bernini] die großen Dächer der Tuilerien sah, hat er gesagt, dass der Fehler, welcher in der Höhe der Dächer stecke, sich wahrscheinlich nicht in einem Zuge eingeschlichen habe. Man erhöht sie [die Dächer, die vor Zeiten flach gewesen sind] zuerst ein wenig, danach ein bisschen mehr und schließlich in so überzogener Weise, dass sie fast so hoch sind wie das übrige Gebäude, – und dies, ohne dass das Auge die schreckliche Unförmigkeit bemerkt).
Krause 1996, 331, Anm. 53; zur Einflussnahme nationaler Eigenheiten auf das Bauwesen s. auch Pérouse de Montclos 2001, passim.
In einer Sitzung des Jahres 1766 hieß es: „on a continué de s’entretenir sur les différentes manières de couronner un édifice, soit par des combles, soit par des balustrades, et les différens avis, ainsi que les différens usages suivis jusqu’à présent et la difficulté de donner de bonnes raisons pour préférer l’une à l’autre a empêché la Compagnie de rien décider sur cette question, et, après avoir balancé la solidité avec l’agrément, on n’a pas cru pouvoir donner un avis unanime pour préférer les terrasses avec balustrades aux combles apparens.“ Lemonnier 1922, 258f. (28e juillet 1766).
Dach mit schwacher Dachneigung; Jacques-François Blondel spricht von diesen Dächern: „si peu apparentes, qu’il semble que leurs bâtiments soient couverts en terrasse, ce qu’on appelle à Paris, bâtir à l’Italienne.“ Blondel 1772, Bd. III, 252 (Kap. V, Perfection de l’art / De la proportion, de la forme et de la décoration des combles en général).
Vgl. Blondel 1772, Bd. III, Kap. V, die Unterkapitel De la proportion, de la forme et de la décoration des combles en général und Des différentes espèces de terrasses ( 250–262).
Blondel 1771, 235 (Kap. VI, Des batiments d’habitation, élevés dans les villes et a la campagna / Des batiments élevés dans les villes / Des palais): „Nous croyons aussi qu’il seroit à propos d’éviter les combles apparents qu’on remarque au Luxembourg; que ces sortes d’édifices seroient terminées plus convenablement par des balustrades, comme au Palais Bourbon; […].“ Und auf Seite 246 (Kap. VI, Des châteaux): „Nous croyons que leur partie supérieure seroit terminée plus convenablement que tout autre édifice, par des combles apparents; […].“
Vgl. Pérouse de Montclos 2001, 46. Nachdem J.-F. Blondel die Klimaabhängigkeit der Dachgestaltung beschrieben hat („Toutes ces Couvertures doivent avoir plus ou moins d’élévation, & être plus ou moins inclinées, selon les lieux où l’on bâtit“.), stellte er fest, daß in Frankreich die unterschiedlichsten Dachformen verwendet worden sind [„Nous remarquerons que nos Architectes François ont néanmoins beaucoup varié sur la hauteur qu’ils ont donnée à leurs couvertures; que souvent même ils les ont supprimées tout-à-fait, […]“], und schlußfolgerte daraus, daß es also nicht die Temperatur sei, von der die Wahl abhänge [„Par ces différentes citations, il est aisé de concevoir que ce n’est pas la température de l’air, que nos Architectes ont consultée, puisqu’on remarque tant de différence dans l’application des Couvertures de nos édifices, tous élevés sous un même ciel: […]“]. Blondel, der eine scheinbare Willkürlichkeit in der Dachgestaltung offensichtlich nicht billigt, möchte diese nur erlaubt sehen, wo das Dach den Charakter des Gebäudes zu unterstreichen hilft („cette diversité, dans la construction des toits, bien loin de mériter indistinctement nos éloges, ne doit avoir lieu, que dans le cas ou la différente hauteur des Combles & la diversité de leurs formes, peut ajouter au caractere du monument.“). Blondel 1772, Bd. III, Kap. V, 251ff..
Das Motiv niedriger und hinter einer Balustrade versteckter Dächer war zuvor allerdings schon beim Château de Saint-Germain-en-Laye angewendet worden. Vgl. Tadgell 1980, 334.
Ebd.
Die Ursprünge des Mansarddaches gehen auf die Louvregestaltung durch Pierre Lescot zurück; namengebend war jedoch François Mansart, der es weiterentwickelte und erst richtig einführte. Das bewohnbare und dadurch besser nutzbare Mansarddach entwickelte sich in der Folge von Versailles zu einem der wichtigsten Merkmale der Architektur des Königreichs. Siehe Pérouse de Montclos 2001, 45.
Vgl. Lorenz 1992, 12, 27f..
Ausführlicher zur kulturellen Umorientierung in Wien und zum Bekanntwerden Fischers bei: Lorenz 2002, bes. 102, 104ff..
Genaueres dazu bei Lorenz 1992, 32; Schneider 1978, 98.
Vgl. Kreul 2006, 146; Lorenz 1992, 74.
Gartenpalais Leeb im Augarten, Wien, um 1691; Gartenpalais Strattmann in Neuwaldegg vor Wien, 1692–1697; Gartenpalais Schlick-Eckhardt, Wien, um 1695; Ahnensaal des Schlosses in Frain, 1688/89; Jagdschloss Starhemberg in Niederweiden (auch Schloss Engelhartstetten genannt), um 1693; Hoyos-Stöckl im Park von Schloss Klesheim bei Salzburg, 1694; Schloss Schönbrunn, Wien, ab 1696. Hinweise zu einer im Nachhinein erfolgten Umgestaltung der Dachregion durch das Aufsetzen von Steildächern finden sich in den vorgenannten Fällen z. B. bei: Aurenhammer 1973, 44, 108f..; Sedlmayr 1976, 251, 257, 259; Lorenz 1992, 68, 76, 79, 81; Kreul 2006, 158, 162, 180.
Vgl. Lorenz 1992, 36.
Vgl. Lorenz 1992, 122; Sedlmayr 1976, 270; Kreul 2006, 234; Aurenhammer 1973, 109ff.. Ein erhaltenes Holzmodell legt die Annahme nahe, dass die Veränderungen wohl noch vor Fertigstellung des Baus vorgenommen wurden (Kreul 2006, 234).
Siehe Kapitel „Bauwissen im Früh- und Hochmittelalter“ von Günther Binding im vorliegenden Band, Abschnitt „Baupläne“. Dort weitere Literatur.
Alberti 1485, 2. Buch (1. Kapitel).
Vitruv 1. Buch, 2. Kapitel; Kieven 1991; Thoenes and Roccasecca 2002, 317–321; Frommel 1994, 6–7.
Thoenes and Roccasecca 2002; zu den Schnittperspektiven vgl. Lotz 1956; Frommel 1994, 14, benennt die Kombination von Schnitt und Perspektive als übliche Darstellungsform seit dem 15. Jahrhundert.
Zu Ravenna und Bramantes Peterskuppel: Frommel 1994, 8–9, 18–21. Zu Bramantes Peterskuppel: Thoenes and Roccasecca 2002, 327–331.
Zum sogenannten Raffael-Brief vgl. Thoenes and Roccasecca 2002, 321–327 sowie Di Teodoro 2003 und Di Teodoro 1994. Auch Vincenzo Scamozzi und Guarino Guarino hießen die Scaenographia gut: siehe Kieven 1991.
Für den ganzen Absatz vgl. Camerota 2006b, 10–21, 35–82.
Scamozzi 1615, Buch 1, Kapitel 14; vgl. Kieven 1991.
Ausführlich in Schlimme 2011a, 380–384.
Schlimme 2011a, 384–388. Carpino 1997, 67, vermutet, das Vorhandensein eines Maßstabs sei ein Indikator für ,Bauplan‘.
Kieven 1991; Schlimme 2011a, 387; zu Peruzzi vgl. Wurm 1984; zu Antonio da Sangallo dem Jüngeren vgl. Frommel 1994 und Frommel and Adams 2000; zu Mascarino und den Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts vgl. die Forschungsdatenbank für Architekturzeichnungen Lineamenta 2007 (besucht am 10. 4. 2013).
Carpino 1997, 67, beobachtet das bei Francesco di Giorgio Martini und Giuliano da Sangallo.
Vgl. Artikel modine von Antonucci in: Antonucci et.al. 2004.
Zu den Profilschablonen der Renaissance vgl. ausführlicher Cooper 1994; aus dem 18. Jahrhundert haben sich z. B. Profilschablonen von Francesco Borromini für Sant’Agnese in Agone erhalten (Wien, Albertina); zum 18. Jahrhundert gibt es Schablonen im Manuskript Dresd. Ms L. 8. der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, http://www.deutschefotothek.de/ (besucht am 7. 4. 2012).
Das Kapitel zur Architektur des Mittelalters von Günther Binding im vorliegenden Band benennt ein Wachsmodell für die Kirche Saint Germain in Auxerre aus dem 9. Jahrhundert sowie ein hölzernes Modell, das um 1400 in der Dombauhütte in Ulm entstand.
Millon 1995; zum Sangallo-Modell siehe insbesondere Benedetti 2009 und Thoenes 1995 sowie Thoenes 1996; zum Modellmuseum in St. Peter siehe Hager 1997; zu den St.-Peter-Modellen jüngst Conforti 2008 mit einem Katalog der in der Fabbrica aufbewahrten Modelle.
Vgl. Contardi and Curcio 1991, 12; Curcio 2000, 60; zum Sakristeimodell vgl. Hager 2000a; Juvarras Sakristeimodell ist zur Hälfte mit vollplastischer Architektur gemacht, in der anderen Hälfte des Modells ist die architektonische Gliederung gezeichnet und aufgeklebt. Vgl. Conforti 2008; über die Rolle der Architekturmodelle in Rom zwischen 1680 und 1750 gibt es zahlreiche Studien. Grundlegend ist Contardi and Curcio 1991; zu einzelnen konkreten Modellen: Contardi 1991, Hager 1991, Pinto 1991a, Pinto 1991c, Pinto 1991b; vgl. zudem Curcio 2000.
Vgl. Oechslin 2011. Im November 2009 fand eine internationale Tagung zum Thema „Modelle und Architektur“ an der TU München statt, die erste in einer Tagungsreihe zu Architekturmodellen.
Alberti 1912, 511; vgl. dens. 1966, 847 (IX.8): „Haec igitur vitia ut vitentur, iterum atque iterum admoneo, priusquam opus aggrediare, totam rem et ipse tecum pensites et una peritos consulas, exemplaribus ad modulos diductis. Ex quibus velim bis ter quater septies decies cum intermissis tum resumptis temporibus omnes repetas futuri operis partes, quoad a radicibus imis ad summam usque tegulam nihil neque abditum neque propatulum neque magnum neque parvum toto sit in opere futurum, quod non tibi et diu et multum percogitatum perconstitutum destinatumque habeas, quibus rebus locis ordine numeroque locasse adiunxisse praefinisseque deceat aut praestet.“
Alberti 1912, 511f.; vgl. dens. 1966, 849 (IX.9): „nihil relinquet, cui non quasi legem modumque praescribat“.
Alberti 1912, 521; vgl. dens. 1966, 865/867 (IX.11).
Manetti 1970, 117: „La natura o l’usanza, che diro meglio, di Filippo, poi che egli ebbe qualche anno fatto sperienza di molte cose intorno al fatto della architettura, era che modeglj, che faceva per gli edificj, che gli occhorevano, egli facieva, che intorno a fatti delle simitrie poco v’appariva, ma attendeva solamente a fare fare le mura principalj et la rispondenza di qualche menbro sanza ornamenti o modi di capitellj o d’architravj, fregi et cornicj ect; perche con l’arme sue medesime egli era di poi dato di molte noie e rincrescimenti, none intendendo el tutto, faciendosi molti bellj delle cose sue.“ S. dazu Lepik 1994, 84–87.
Albertis Entwurf samt zugehörigen Beschriftungen überliefert eine Kopie Antonio Labaccos (Uff. A 1779; mit Rekonstruktionsversuch des Aufgehenden von Labacco selbst). Aus der reichen Literatur zu diesem Blatt seien hier nur als jüngere Titel genannt: Böckmann 2004, 59ff. u. passim; Samperi 2006, 469, Nr. 78; Davies 2008; Niebaum 2013. – Vgl. ferner die Zeichnung Uff. A 4378r, die nach Günther 1988, 92–97, von Cronaca stammt und sich auf eine Idee Luca Landuccis für eine Kirche des hl. Johannes Ev. in Florenz (1505) bezieht, während Frommel 2005, 77, darin die Aufnahme eines antiken Tempels sieht. Vgl. hierzu jedoch Niebaum 2013.
Calzona and Volpi Ghirardini 1994, Nr. 13: „Item non ho messo pollexe alqunno alli ussi per ttema di non fallire perché lo preditto messer Battista non ne dillibrò come, perché per mollti modi si se fal all’antiga li seramenti d’ussi e io non voria fare cosa che si avesse a reffare per non essere fatta al piazere della S. V.“
Vgl. die Briefe Ludovico Gonzagas an Alberti bzw. an seinen Sohn Kardinal Francesco Gonzaga, vom 13. bzw. 19. Oktober 1464 bei Calzona and Volpi Ghirardini 1994, Nr. 64f..
Bei den fraglichen Zeichnungen Bramantes handelt es sich um Uff. A 1, 8v, 20r/v und 7945r/v. Aus der immensen Bibliographie sei hier nur verwiesen auf Wolff Metternich 1987, 13–52, 73–99; Thoenes 1994; Niebaum 2001/2002, 94–136, 144–156; Jung 2004, jeweils mit älterer Literatur. Zum Problem der Unfertigkeit des Modells von 1506 grundlegend Bruschi 1987 sowie Niebaum 2008. Zum Modell und seiner partiellen graphischen Überlieferung Frommel 1984b, 256; ders. 1994, 608.
Niebaum 2008.
Nach Serlio 1540, 38, fertigte Bramante den Entwurf „prima ch’ei morisse“. Zur Kuppel Kraus and Thoenes 1991/1992 u. Hubert 1992.
Zu diesem Strategiewechsel etwa Thoenes 1997, 445f. (ed. Thoenes 2002, 481).
Ausführlich zu diesem Projekt Frommel 1984, 245–247, 270–273.
Zu diesem Aspekt Thoenes 1997, bes. 452–454 (ed. Thoenes 2002, 473f., 477f.).
Vgl. z. B. Uff. A 70, 78, 257; dazu etwa Frommel 1984, 274f., 296, 266; Frommel, in: Evers 1995, 332, 338; Bruschi, in: Frommel and Adams 2000, ad ind.
Zu diesen Zeichnungen Frommel 1984, 299–302; Frommel, in: Evers 1995, 336.
Einführend zum Modell Benedetti 1995; Thoenes 1995; Thoenes 1996; Kulawik 2002, passim.
Dokumentiert für Santa Maria del Fiore in Florenz (1367) und San Petronio in Bologna (1390); vgl. Satzinger 2005, 60, und die Belege bei Lepik 1994, 183–186, Kat. 6-–8 bzw. 186f., Kat. 10. Von Antonio di Vincenzos Modell für San Petronio sind sogar die Grundmaße bekannt; es maß mit rekordverdächtigen 15,20 x 11,6 m nahezu das Doppelte von Sangallos Holzmodell. Überdies gibt es im späten 14. Jahrhundert bereits Belege für die farbige Fassung von Modellen, etwa bei einem Gesamtmodell für den Mailänder Dom von 1391/92 und Brunelleschis „nuovo et ultimo modello“ von 1420 (vgl. Lepik 1994, 142f. und die Quellen ebd., 188, Kat.11, n. 4 bzw. 197 f., Kat. 31, n. 3).
Monica Visioli, in: Evers 1995, 220–229 (mit weiterer Literatur). Sogar der Groteskendekor der Pilasterschäfte sowie skulpturale Elemente sind in diesem Modell mit erstaunlicher Präzision und Ausführlichkeit geklärt. Es unterscheidet sich insofern nachdrücklich von jenem älteren Modell des Doms, das 1488 bei Cristoforo Rocchi in Auftrag gegeben worden war und „omissis ornamentis“ ausgeführt werden sollte. Vgl. Lepik 1994, 225–227, Kat. 82 und 232 f., Kat. 93.
Schon aus diesem Grund ist es irreführend, das Modell als eine „fetischhafte“ Ersatzhandlung für die Errichtung des Baues selbst zu sehen (so Thoenes 1995, 106; Bredekamp 2000b, 60). Aber auch die sehr erheblichen Fortschritte des Baues selbst stehen dem entgegen, wie bereits Satzinger 2005, 60, betont.
Thoenes, in: Evers 1995, 372–377, sowie besonders Kulawik 2002, 143–154, 423ff..
Cod. Destailleur D, Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Kunstbibliothek, HdZ 4151, f. 85; vgl. ebd., 574–583.
Vgl. den Libro delle congregationi che si facevano der Deputierten (ARFSP, Arm. 29 A 583): „decreverant prout infra […] quoad architectos et eorum salaria ma(n)daru(n)t no(n) satisfieri nisi incoato modello dicte basilice q(uod) ad eorum officia spectat.“ Vgl. Francia 1977, 45.
Ebd., 232, Kat. 93, n. 4.
Vgl. seinen Brief an Bartolomeo Ferratino in: Michelangelo Buonarroti 1965–1983, IV, 251; dazu Thoenes 2006, 63–65 m. Anm. 9.
Zu diesem Problem Millon and Smyth 1976, 162–184; Brodini 2005, auch Maurer 2004, 122–126. Der Fehler bestand, soweit aus Michelangelos Äußerungen in zwei Briefen an Vasari (s. die beiden folgenden Anm.) hervorgeht, darin, dass der Bauleiter für alle drei Kappen ein und denselben Lehrbogen benutzt hat.
Michelangelo Buonarroti 1965–1983, V, 113, Nr. MCCLXI (1. Juli 1557).
Michelangelo Buonarroti 1965–1983, V, 117, Nr. MCCLXIII (17. August 1557): „Messer Giorgio, perché sia meglio intesa la dificultà della volta che io vi mandai disegniata, ve ne mando la pianta, che non la mandai allora.“ Dabei bezieht er sich auf den in der vorigen Anm. zitierten Brief, der entsprechende, für Vasari offenbar unverständliche Skizzen enthielt (es handelt sich um eine Aufrissprojektion des gesamten Gewölbes sowie um den Grundriss einer Kappe, der freilich nicht entsprechend bezeichnet und in einen Halbkreis einbeschrieben ist). Die Darstellung im zweiten Brief gibt den Grundriss des gesamten Gewölbes. Vgl. zu diesem Problem Brodini 2005; Thoenes 2006, 72.
Dass diese Problematik mitverantwortlich für den Fall war, gab er in dem Brief an Vasari auch zu: „ma è stato per non vi potere andare spesso per la vechieza.“
Morselli and Corti 1982, Nr. 6. Für jeden Arbeitstag in Prato standen Giuliano 30 soldi, ein Pferd sowie Spesen zu.
Vgl. Hoppe 2003, 108.
Die Ausführungen zum Thema der Idealstadt basieren auf: Tönnesmann 2006; Krau 2006; Witthinrich 2006; Nerdinger 2006; Hoppe 2003; de Bruyn 1996; Oechslin 1993; und Benevolo 1993a.
Vgl. Stober 1991, 100.
Guidoni 2003, 9ff..; zu den Terre nuove fiorentine siehe auch Guidoni et.al. 2003 sowie Zolla 2003.
Vgl. de Bruyn 1996, 56; Alberti 1991, bes. 180ff; z. B. ist hier auf S. 201 in Bezug auf die Anlage der Militärstraße innerhalb der Stadt zu lesen: „Nähert sie [die Militärstraße] sich der Stadt und ist das Gemeinwesen berühmt und mächtig, so soll es gerade und breite Straßen haben, welche zur Würde und zum Ansehen der Stadt beitragen. […] Innerhalb der Stadt aber soll sie nicht gerade, sondern wie ein Fluß hierhin und dorthin und wieder nach derselben früheren Seite in weicher Biegung gekrümmt sein. Denn außerdem, daß sie dort, wo man sie weiter überblicken kann, die Stadt größer erscheinen läßt, als sie ist, trägt sie in der Tat auch zur Schönheit, Zweckmäßigkeit und zu den wechselnden Bedürfnissen der verschiedenen Zeiten außerordentlich bei. Und wie schön wird es sein, wenn sich einem beim Spazierengehen auf Schritt und Tritt allmählich immer neue Gebäudeansichten darbieten, so daß jeder Hauseingang und jede Schauseite mit ihrer Breite mitten auf der Straße aufmarschiert und daß, ob zwar anderswo eine zu große Weite unschön und auch ungesund, hier sogar ein Übermaß von Vorteil ist.“
Vgl. Tönnesmann 2006, 58.
Vgl. Nerdinger 2006, 272.
Vgl. Adams 2002, 546, 548f.; die Verbesserung der Kanonen geht auf die französischen Artilleristen Jean und Gaspard Bureau zurück, die die Schlagkräftigkeit durch eine neue Art des Schießpulvers und die Verwendung von Eisen- statt der bisherigen Steinkugeln steigern konnten (ebd., 546). Für De Bruyn bilden Idealstadtplanungen „Bestandteil umfassender sozialräumlicher Rationalisierungsprozesse“, die sich vornehmlich dann durchsetzten, wenn Bedarf an der Erneuerung der Befestigungsstrukturen bestand; de Bruyn 1996, 30.
Die erfolgreiche Invasion der Armee Karl VIII. von Frankreich, die aufgrund der fortschrittlichen Technologien kaum aufzuhalten gewesen war, machte den Italienern 1494/95 die Überlegenheit der neuen Kanonen sehr nachdrücklich bewusst, wenngleich Veränderungen in der Art der Verteidigung auch schon vorher eingesetzt hatten; Coppa 2002, 69; Adams 2002, 546, 548.
Die Werke und Schriften des zu seiner Zeit führenden Militärarchitekten Franceso di Giorgio Martini gehören z. B. in diese Phase des Übergangs; vgl. Coppa 2002, 78f., 82. Die ersten Ansätze einer neuen Art der Verteidigung traten gegen Ende des 15. Jahrhunderts entweder als Neukonstruktionen oder als Verstärkungen bestehender Befestigungsstrukturen auf; Adams 2002, 552. Als Beispiele dieser Übergangsphase nennt Adams u. a. die Festungen von Civita Castellana, Nettuno und Poggio Imperiale von Antonio da Sangallo il Vecchio, jene von Treviso von Fra’ Giocondo oder die Verstärkung der Florentiner Befestigungen durch Michelangelo (Adams 2002, 553f.).
Vgl. insbes. die Ausführungen von Adams zu Antonio da Sangallo il Giovane, der eine bedeutende Rolle in dieser Entwicklung spielte; z. B. die Fortezza da Basso in Florenz oder die für die Päpste Leo X., Clemens VII. und Paul III. ausgeführten Werke. Adams 2002, 555ff..
Vgl. Stober 1991, 101; Kruft 1985, 123; Robotti 2005, 299f.. Zur Thematik des Festungsbaus s. auch den gleichnamigen Abschnitt im vorliegenden Kapitel.
Bis zu dieser Zeit war der Architekt für die Gesamtheit der Aufgaben, einschließlich jener des capomastro in fortificazioni und artista creatore zuständig gewesen. Oechslin 1993, 421.
Coppa 2002, 69. So behandeln z. B. Serlio und Palladio die Militärarchitektur nicht mehr in ihren Traktaten. Allerdings war die Trennung von Zivil- und Militärarchitektur keine absolute, und z. T. wurden beide auch weiterhin von einer Person abgehandelt, wie dies bei den Traktaten von Pietro Cataneo (1554, 1567) und Vincenzo Scamozzi (1615) der Fall ist. Coppa 2002, 70; Kruft 1991, 122.
Vgl. Coppa 2002, 83. Traktate über militärarchitektonische Themen wurden allerdings nicht ausschließlich von Militäringenieuren geschrieben, sondern auch von Vertretern einer anderen Gruppe, der Intellektuellen, die dem höfischen Umfeld zugehörten; s. Coppa 2002, 83; Robotti 2005, 300.
Giovan Battista Bellucci, Nuova inventione di fabricar fortezze, di varie forme…, Venedig 1598, Kap. I; zitiert nach Kruft 1991, 126; zu Bellucci s. Kruft 1991, 125f..
de Marchi 1599, f. 29; hier zitiert nach Kruft 1991, 127. Zu de Marchi s. Kruft 1991, 126f..
Vgl. Coppa 2002, 69.
„A Fare qual si voglia Fortezza ò Città, si ricerca prima un Architetto che sappi fare i disegni, et condurre la fabrica, et un Soldato prattico, et esperto nella Militia, che conosca il sito dove si deve fare la Fortezza, che si possa defendere da nemici. Ancora ci vuole un valente, et dottissimo Medico, per sapere conoscere l’aria, l’acqua, et li frutti buoni. Doppò si ricerca un’ huomo consummato nell’Agricoltura, che conosca il paese se sarà fruttifero, et si vi saranno acque, pascoli, legna, et terreni per seminare ogni sorte di grano, et piantar vigne; et vi vorebbe ancora uno, che fosse ingeniosissimo, et giudicioso nelli arte Minerali, acciò sappia conoscere se vi sono minere di cosa per la quale, il Prencipe si possa prevalere. Ci bisogna ancora un sapientissimo Astrologo, quale sappia dir sotto a qual Clima sia il Sito, et saper l’Anno, et Mese, il Giorno, l’Hora, et Ponto, che s’ha da dar principio, a qual si voglia fabrica, per habitatione de Popoli, come ho veduto fare alli miei giorni, e come si legge, che si faceva anticamente. Et questo si fa acciò si possano conservare la fabrica, e gli habitatori con felicità.“ de Marchi 1599, 1. Buch, 5v. (Kap. XIX: Gli huomini, che vogliono per fare la Fortezza). Dazu auch Kruft 1991, 126.
Vgl. Adams 2002, 552; Coppa 2002, 74, 79; Kruft 1991, 123. Zitat: Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, hg. von C. Maltese, 2 Bde., Milano 1967, Bd. 1, 3; hier zitiert nach Adams 2002, 550.
Coppa 2002, 78ff.; Kruft 1991, 64.
de Marchi 1599, 2. Buch, Kap. XXXVI. Hier zitiert nach Robotti 2005, 305 (das Zeichnen auf Papier, das Herstellen von Modellen und das Schreiben von Texten über den Festungsbau notwendig sind, weil man anderenfalls keine gute Arbeit mit dem Geist leisten kann, wenn zuvor keine Arbeit mit Papier und Modell erfolgt).
Vgl. Kruft 1991, 129. Zur Bevorzugung der Kreisform für die Stadt durch Vitruv s. Coppa 2002, 73.
Hoppe 2003, 119. Mit steigendem Abstand vom Mittelpunkt der Straßen nimmt auch die Fläche zwischen den Radien zu, was für große Stadtbauvorhaben oder spätere Erweiterungen hinderlich ist (ebd.). Palmanova wird als die bekannteste Verwirklichung einer Stadtfestung mit Radialsystem angesehen; vgl. Pepper 2007, 228.
Im Auftrag und unter Mitwirkung von Vespasiano Gonzaga ab 1556 erbaut; die ideelle Planung unterlag Girolamo Cataneo; zu Sabbioneta s. z. B. Robotti 2005, 302f..
Hoppe 2003, 114. Der Entwurf für die Stadt von Francesco Laparelli ist an Cataneos Vorschläge angelehnt; s. Coppa 2002, 81; Kruft 1991, 87.
Oechslin spricht von der „Omnipräsenz der Geschichte“, wenn es sich um die Idee der Stadt handelt. Oechslin 1993, 427.
Vgl. Oechslin 1993, 424, 426, 448f; ausführlich zu den Legenden und Mythen das Kapitel „La città. Mito e storia“ bei Oechslin 1993, 424ff..
Zum nachfolgenden Exkurs über die damaligen Darstellungsmodi: Marías 1999, 219–229.
François Michel Le Tellier de Louvois (1641–1691).
Aus funktionalen Gründen, damit die Stadtmodelle für militärische Zwecke brauchbar blieben, mussten diese stets der aktuellen Situation angepasst werden. Natürlich konnte dem Anspruch an ein solcherart dynamisch verstandenes Stadtmodell in der Realität nicht immer Folge geleistet werden, wodurch die Modelle bisweilen ihren militärischen Nutzen verloren und zu ,Spielzeugen‘ der Fürsten wurden. Marías 1999, 227.
Vgl. Oechslin 1993, 420.
Vgl. Hoppe 2003, 111.
Thomas Morus, De Optimo Reipublicae Statu Deque Nova Insula Utopia Libellus Vere Aureus, 1516. Zum Idealstadtgedanken der Staatsromane vgl. z. B. Tönnesmann 2006, 62ff.; Nerdinger 2006; Witthinrich 2006; de Bruyn 1996. Morus’ Utopie, die der literarischen Gattung ihren Namen verlieh, stützte sich auf das der Wirklichkeit entnommene Vorbild der Höfe der Beginengemeinschaften, s. Witthinrich 2006, 87; Nerdinger 2006, 275. Überdies kann angenommen werden, dass es sich bei Morus’ Inselstaat um einen Gegenentwurf zum damaligen Königreich England handelte, s. de Bruyn 1996, 62.
Albrecht Dürer, Etliche underricht zu befestigung der Stett, Schloß, und flecken, Nürnberg 1527. Für die Reformationsanhänger bildete die Quadratstadt von Morus das „Urbild des protestantischen Städtebaus“ schlechthin, De Bruyn 1996, 65.
In der Alten Welt hatte es insgesamt gesehen nur wenige reale Anlässe für die Planung und Errichtung gänzlich neuer Stadtanlagen gegeben. Hingegen war infolge der Entdeckung und Eroberung des amerikanischen Kontinents jenseits des Atlantiks ein erhöhter Bedarf an neuen urbanen Zentren entstanden, so dass die in Europa entwickelten Ideen jetzt vermehrt in der Neuen Welt – wenngleich z. T. auch auf Kosten der ursprünglichen Qualität und mit Tendenz zum Schematismus – in die Praxis umgesetzt werden konnten. Vgl. dazu Benevolo 1993a, 91, 101.
Vgl. z. B. Kruft 1991, 124; Hoppe 2003, 117f; das Gitterschema wurde in den spanischen Kolonien sogar per Gesetz – 1573 durch den König erlassen – für Städtegründungen vorgeschrieben (Hoppe 2003, 117). Kruft nennt einen Holzschnitt mit der Darstellung Tenochtitláns als denkbare Quelle für Dürers quadratischen Stadtentwurf; Kruft 1991, 124.
Tommaso Campanella, Politicae Civitas Solis Idea Reipublicae, 1623. Als Inspirationsquelle wird Herodots Beschreibung der Mederhauptstadt Ekbatana genannt, s. Nerdinger 2006, 281.
Vgl. de Bruyn 1996, 58; Kruft 1991, 108.
Vgl. Krau 2006, 75.
Oechslin 1993, 421 (eine mögliche Konkretisierung der grundlegenden Reflektionen über die Aufgabe des Architekten, also ein Sonder- oder beispielhafter Fall einer Transkription, welche anderenfalls im allgemeinen Sinne seiner Rolle innerhalb der Gesellschaft verbindlich wäre).
Vgl. Hoppe 2003, 112f..
René Descartes: Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les science, 2. Teil, 11f.; im Folgenden zitiert nach Descartes 1988, 579f.: „[…] souvent il n’y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces, et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu’un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d’être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccomoder, en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d’autres fins. Ainsi ces anciennes cités, qui, n’ayant été au commencement que des bourgades, sont devenues, par succession de temps, de grandes villes, sont ordinairement si mal compassées, au prix de ces places régulières qu’un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine, qu’encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve souvent autant ou plus d’art qu’en ceux des autres; toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là un petit, et comme ils rendent les rues courbées et inégales, on dirait que c’est plutôt la fortune, que la volonté de quelques hommes usant de raison, qui les a ainsi disposés. Et si on considère qu’il y a eu néanmoins de tout temps quelques officiers, qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments des particuliers, pour les faire servir à l’ornement du public, on connaîtra bien qu’il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d’autrui, de faire des choses fort accomplies.“
Vgl. Oechslin 1993, 451f..
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es in ganz Europa zur Auflösung der Befestigungsringe, wenn man sie nicht einfach stehenließ. Die Bastionärsysteme hatten das wichtigste strategische Mittel der Defensive gebildet, bis es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Einsatz von Artillerie kam, deren Zerstörungskraft sie nicht mehr standhalten konnten. Zum Ausbau der Ortschaft Versailles zur Stadt s. Krause 1996, 55f..
Stober 1991, 101. Viele Landesherren zogen es vor, ihre Residenz fernab der alten Residenzstadt in offener Landschaft zu errichten, wo ihren Gestaltungswünschen keine Grenzen durch die vorhandene Bebauung gesetzt waren. Als ein Musterbeispiel für diesen Zusammenhang gilt allgemein die Residenz in Caserta, die durch den Juvarra-Schüler Luigi Vanvitelli entworfen und größtenteils auch erbaut wurde (Baubeginn 1751), und die ein besonders sprechendes Exempel der einheitlich barocken Durchgestaltung eines für den Bau neu erschlossenen Terrains abgibt. Zu diesem Themenkomplex siehe insbes. Fagiolo 2004.
Zur Konfrontation von Versailles mit dem vergleichbaren Projekt der Veneria Reale des Turiner Hofes s. Krause 1996, 53f.. Einem Brief von 1669 lässt sich entnehmen, dass die Piemonteser Planung in Frankreich bis ins Detail bekannt gewesen ist; ebd., 53f.
Krause 1996, 46. Eigentlicher Prototyp für eine offenere Konzeption, obgleich wegen seiner geringeren Bedeutung weniger bekannt, ist das Schloss Vaux-le-Vicomte (Einweihung 1661), bzw. sein nach ,französischer Art‘ angelegter Garten, der als erster eine komplette Landschaft ausbildete, deren regelmäßige, symmetrische Anordnung bis zur Horizontlinie reichte. Vorbildcharakter hatte neben Versailles und den anderen königlichen Schlössern auch die Stadt Paris mit ihren regelmäßigen Platzanlagen, den Boulevards und ihrem insgesamt offenen Charakter. Premier architecte von Versailles war 1668 Louis Le Vau. Zu den einzelnen Phasen der Baugeschichte von Versailles und den wiederholten Um- und Neuplanungen zwischen 1668–1678 s. Krause 1996, 28–59.
In Anlehnung an das Motiv des Dreistrahls, das auf die Tridente-Planung Sixtus V. – des sog. ,Vaters der Urbanistik‘ – zurückgeht; Sixtus V. hatte die ersten urbanistisch orientierten Eingriffe in das mittelalterliche Stadtbild Roms unter Sixtus IV. (Erbauung des Ponte Sisto) und Julius II. (Anlage der Via Giulia) weitergeführt.
Zur Stadtbaugeschichte von Turin, wie sie im Folgenden dargestellt wird, s. Jöchner 2003; Comoli and Roccia 2001; Comoli Mandracci 1999; Kessel 1995, Kap. 3; Benevolo 1993a, 167–172; Comoli Mandracci 1992; Comoli and Roccia 1991; Stober 1991, 104ff.; Comoli Mandracci et.al. 1990; Comoli Mandracci 1989; und Roggero Bardelli 1989.
Die Baubehörde bestand seit 1621; s. Stober 1991, 104.
Stober 1991, 104. Federzeichnung von D. Hieronymus Righettinus (Pianta prospettica di Torino e della corona delle Terre Sabaude, 1583); ebd.
Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis Pedemontii Principis Cypri Regis …, 2 Bde., Amsterdam 1682. Folgeeditionen angegeben bei Comoli Mandracci 1992, 9 Anm. 24. An dem Atlas waren zwei Herrschergenerationen beteiligt. Ausführliche Erläuterung des Theatrum Sabaudiae in angegebenem Zusammenhang bei Jöchner 2003, 68-71; Zitat ebd., 71.
Von 1632 bis 1649 erster Hofarchitekt.
Vgl. z. B. Jöchner 2003, 73; Comoli Mandracci et.al. 1990, 134, 138; Comoli Mandracci 1992, 12ff.. Bei Comoli Mandracci 1992, 14, Abb. der Zeichnung Vaubans (Turin, Archivio di Stato, Corte, Carte topografiche per A e B, Torino n. 1/12).
Roggero Bardelli 1989, 76. Brief vom 5. Oktober 1680. Der angesichts des Resultats entstehenden Wirkung eines ,organischen‘ und linearen Prozesses der Stadtentwicklung zum Trotz, hatte es über einen so langen Zeitraum hinweg natürlich immer auch wieder Diskussionen über die Form des äußeren Bastionärgürtels, die Gestaltung der urbanen Repräsentanzräume und über die Kriterien für die innerstädtische Parzellierung gegeben. Ebd., 76.
Beschreibung von Aufriss und Gliederung der Häuserfassaden bei Kessel 1995, 42f.
Als Ergebnis internationaler diplomatischer Verhandlungen bei Kriegsende (Frieden von Utrecht, 1713).
Vgl. z. B. Roggero Bardelli 1989, 116.
Hierzu insbes. Jöchner 2003, passim; Comoli Mandracci 1999, 362ff..
Vgl. Jöchner 2003, 67, 78ff.. Durch ihre Entstehungsgeschichte erinnerte die Kirche an den Sieg über Frankreich von 1706 und damit an den Erhalt Siziliens und der Königswürde. Zitat ebd., 86.
Vgl. Kieven 1993, 187, 189 und Jöchner 2003, 81f..
Jöchner nennt dies „Innehaben des Raums“; Jöchner 2003, 81.
Santa Maria al Monte von Ascanio Vitozzi, spätes 16. Jahrhundert.
Zur Interpretation der Zeichnung vor allem Jöchner 2003, 80ff..
Für die im Folgenden gemachten Angaben zu Stupinigi wurden konsultiert: Defabiani 2002; Passanti 2002; Gritella 1987.
Vgl. Comoli Mandracci 1999, 364; Comoli Mandracci 1989, 74; Krause 1996, 54. Versailles ist ebenfalls von einem Netz aus Satelliten umgeben; Paris besitzt eine solche ,Krone‘ aus den Lustschlössern nicht des Königs, sondern der Hofleute. Krause 1996, 54.
Vgl. z. B. Comoli Mandracci and Roggero Bardelli 1984, 185; dort findet sich ebenfalls die entsprechende Passage der Quelle zitiert.
Zum Thema der Jagd s. Comoli Mandracci 1989, 72f; Defabiani 2002.
Vgl. Gritella 1987, 39.
Zu der istruzione s. Gritella 1987, 58ff..
Vgl. Gritella 1987, 30.
Vgl. z. B. Roggero Bardelli 1989, 127; zur Baustelle von Stupinigi unter Filippo Juvarra s. das Kapitel IV bei Gritella 1987.
Neben Bänden wie Pentrella 1984, Pasini 1985, Guillaume 1991, Della Torre 1992, Conforti 2002, Lanconelli and Ait 2002, Crouzet-Pavan 2003, Schlimme 2006e, Schröck et.al. 2013 sind die den Baustellen gewidmeten Kapitel in den diversen Bänden der Storia dell’architettura italiana (Francesco Dal Co Gesamtherausgeber) zu nennen. Um Baustellen geht es zudem regelmäßig in einer weiter gefassten Bautechnikgeschichte/Construction History, siehe u. a. die internationale Tagung Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli (Ravenna 2005) sowie die International Congresses on Construction History (Madrid 2003, Cambridge 2006, Cottbus 2009, Paris 2012) und die entsprechenden Tagungsberichte.
Scavizzi 1983 geht es zwar in erster Linie um die Geschichte der Konstruktionstechniken, aber auch Transport (49–52) und Organisation der Arbeit (63–91) sowie Kostentabellen mit Einheitspreisen aus dem Jahre 1666 (93–98) sind Teil der Publikation. Scavizzi 1991 beschreibt den Schiffsverkehr auf dem Tiber, der für den Materialtransport nach Rom entscheidend wichtig war. Wallace 1994 behandelt die unternehmerischen und logistischen Kompetenzen Michelangelos. Cupelloni 1996 analysiert die Konzeption der Baustellen, das technische Wissen und die Realisierung von der griechischen Antike bis Brunelleschi. Nobile 2002 beschreibt die Architektur in Sizilien in der zweiten Hälfte des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und geht dabei vor allem auf die Organisation der Bauleute und die Organisation der Baustelle ein. Marconi (2004) studiert die Baustelle in Rom vom 16. bis 18. Jahrhundert und ihre Logistik.
Die Themen reichen von der Petersbaustelle unter Julius II. (Frommel 1976) über die übergreifende baulogistische Organisation im Turin des 18. Jahrhunderts (Carbone 1986), Baustellen im Piemont Anfang des 17. Jahrhunderts (Vinardi 1989), die Organisation der Baustelle der Superga in Turin (Palmas 1990), Festungsbaustellen in der Toskana (Lamberini 1991), die Baustelle der Uffizien in Florenz (Conforti 1994/1995), Baustellen im 15. und 16. Jahrhundert in Verona (Calabi 2000), Borrominis Baustellen (D’Amelio 2001), Berninis Baustelle Petersplatz (D’Amelio 2003b) bis hin zu Veränderungen an der Kuppel von Il Gesù in Rom (D’Amelio 2003a), und die Baustellen Carlo Borromeos in der Diözese Mailand (Coscarella 2004). Zu Baustellen aus der Renaissancezeit vgl. außerdem Sabatino 2005, Salvi 2005, Chiappafreddo 2007 (2008), Altavista 2013, zu Baustellen aus der Barockzeit vgl. außerdem Pasini 1985, Tabarrini 2006, Marconi 2007/2008, Vesco 2010 und Vaquero Piñeiro 2010.
Zu den Bootstypologien und ihren Maßen vgl. Scavizzi 1991, 88. Marconi (2004, 126) beschreibt die kostensparende Transportmethode mit Flößen. Vgl. auch den Artikel chioda in: Antonucci et.al. 2004.
Zabaglia 1743, Legende 7; Marconi 2004, 133–136. Zu Wagentypologien vgl. Lamberini 1998/1999, 283.
Boucheron 1998, 439–494, Kapitel Les matériaux de construction.
Klapisch-Zuber 1969, Kapitel 7–1, 186–197, Les transports.
Gemessen an den Personen auf dem Blatt ist der Travertinblock ca. 1,5 x 1,1 x 1,2 m also ca. 2 m3 groß. Bei einem spezifischen Gewicht von Travertin von ca. 2600–2720 kg/m3 ergibt sich ein Gewicht von etwa 5,3 Tonnen.
Marconi 2004, 73–75; bei einem spezifischen Gewicht von Marmor von 2400–2700 kg/m3 dürfte jede Säule etwa drei Tonnen gewogen haben.
Zur lizzatura vgl. Lamberini 1998/1999, 284–285.
Die Versetzung des Vatikanischen Obelisken wird von Fontana 1590 beschrieben, vgl. Fontana 1694. Die Libri dei conti (Abrechnungsbücher) von Domenico Fontana wurden publiziert in Guidoni et.al. 1987, 52. Jüngere Literatur zum Transport des Vatikanischen Obelisken: Curcio 2003, Marconi 2008, Becchi 2011.
Bei einem spezifischen Gewicht von Marmor von ca. 2400–2700 kg/m3 und einem Volumen von ca. 91,5 m3 ergibt sich ein Gewicht von etwa 233 Tonnen.
Zu Carrara vgl. Klapisch-Zuber 1969, 107, zitiert bei Bernardi and Vaquero Piñeiro 2007, 527, Anm. 61; zu Sens Bernardi and Vaquero Piñeiro 2007, 527.
Vgl. Artikel pianella in: Antonucci et.al. 2004.
Bernardi and Vaquero Piñeiro 2007, 521–522. Zur Figur des Unternehmers in der Frühen Neuzeit vgl. Vérin 1982. Martinelli 1996 analysiert am Beispiel der Dombaustelle in Como hingegen aus Sicht der operatori minori.
Marconi 2004, 12, 38–41; ein Beispiel für die Aktivität von Bauleuten aus dem Ticino in Rom gibt Vicioso 1998.
Dieses Beispiel bringt Marconi 2004, 192.
Marconi 2004, 82–83; Liste der Traktate in Anm. 12, 82. Valadier, so berichtet Marconi, beschreibt eine Technik, die heute noch auf den Baustellen üblich ist und die der Autor bei Baustellenpraktika in Deutschland in den Jahren 1987/88 kennengelernt hat.
Marconi 2004, 51–52; die Dokumente liegen im AFSP, arm.1, rip.A, vol.11, Materie diverse (1538–1697), fasc.2, Assistenza a invalidi e morti sul lavoro della Reverenda Fabbrica. Suppliche varie, cc.3r–182v.
Zu nennen sind zunächst Scavizzi 1983 und Marconi 2004. Die Verwendung von Baumaterialien in der Romagna im 18. Jahrhundert wird von Veggiani 1985 analysiert.
Scavizzi 1983, 29–30. Zur Situation in der Lombardei siehe Fieni 2000.
Scavizzi 1983, 30–31, beschreibt die Reglements.
Antonucci, Artikel pozzolana in: Antonucci et.al. 2004.
Scavizzi 1983, 37; vgl. auch Glossar Scavizzi 1983, 139–142.
Valeriani 2006; vgl. auch Schlimme 2006b.
Ausführlich Fiorani 2001; vgl. auch Antonucci, Artikel coccio pisto in: Antonucci et.al. 2004.
Marconi 2004, 62–63; zum Begriff tevolozza vgl. auch Glossar Marconi 2004, 283.
Antonucci, Artikel mattoni rotati in: Antonucci et.al. 2004.
Idem.; die Quelle gibt den Stand von 1823 wieder, aber das war – so liest es sich bei Scavizzi – auch vorher schon so.
Masi 1788, 32–33, spricht von zwei Jahren Lagerzeit; zitiert bei Scavizzi 1983, 31–32.
Dreßen 2008, 20–23. Dreßen führt im Katalog 86 Beispiele für italienische Terracottafußböden aus dem 15. Jahrhundert in Italien auf (ebd., 336–389). Zum römischen 17. Jahrhundert vgl. Maura Bertoldi in Bertoldi et.al. 1983, 84–90.
Vgl. Bruschi 1988, der dieses Fassadenkonzept beschreibt. Auch Serlio 1619, 4. Buch 136 benennt dieses System (zit. bei Bruschi 1988, Anm. 2).
Für einen Überblick über ganz Italien vgl. Scamozzi 1615, 7. Buch, Kapitel 8, 10, 11, 12.
Dreßen 2008 führt im Katalog 54 italienische Steinfußböden aus dem 15. Jahrhundert auf, 283–336.
Bruschi 1988, 121–122; vgl. Serlio 1619, 4. Buch 155; Alberti 1485, 6. Buch (11. Kapitel), 7. Buch (10. Kapitel), 9. Buch (5. Kapitel).
Klapisch-Zuber 1969, Kapitel 3, 61–76, Héritages techniques.
Gnoli 1988, 130–132; zu Prophyr vgl. Butters 1996.
Gnoli 1988, zum africano siehe 178; zum fluorite siehe 229.
Vgl. Bredekamp 1993/Bredekamp 2000a; die Sammlung des bologneser Universalgelehrten Ulisse Aldrovandi enthielt Zufallsbilder in Marmorblöcken; Kapitel Naturform und Antike Skulptur, 19–26.
Gnoli 1988, zur breccia di Settebassi siehe 233; zur breccia di Tivoli oder breccia Quintiliana siehe 253–256; zum rosso brecciato siehe 245; zur archeologia commerciante siehe 246–248.
Zur Spolienverwendung im 15. Jh. in Rom vgl. Satzinger 1996, zu Spolien in St. Peter vgl. Dittscheid 1996, Bosman 2004; für die frühe Neuzeit in Rom insgesamt vgl. Bentivoglio 1987, Moore 1996.
Für den gesamten Absatz: Satzinger 1996.
Nikolaus Muffels Beschreibung der Stadt Rom liegt publiziert vor: Muffel 1876, hier 48.
Libri dei conti von Domenico Fontana, publiziert in Guidoni et.al. 1987, 54.
Der Architekt Domenico Fontana bekommt im November 1587 eine Zahlung von 23.000 Scudi. Es ist aber nicht klar, ob diese Zahlung mit den Rohbaukosten identifiziert werden kann; Guidoni et.al. 1987, 54.
Vgl. Tuena 1989.
Sixtus V. ließ das Septizonium abbrechen. Zu Paul V. vgl. Marconi 2004, 73–75.
In den Libri dei conti von Domenico Fontana (Guidoni et.al. 1987, 54) lassen sich einige der Zahlungen, die im Rahmen der Errichtung der Cappella Sistina geleistet wurden, als Zahlungen an Privatleute für Marmor, der offenbar auf deren Grundstücken ergraben worden war, identifizieren; vgl. zum Markt für ergrabenen Marmor Vaquero Piñeiro 2008. Für die Cappella Paolina trägt Marconi 2004 (75, Anm. 194 und 195) Quellen zusammen, die vom Besorgen des Marmors für die Kapelle berichten; vgl. auch Gnoli 1988, 217-218.
Marconi 2004, 73–75 (Cappella Paolina).
1. Auflage 1556, 2. Auflage 1567; 1567 auch lateinische Vitruvausgabe Barbaros.
Zu den vier aristotelischen Elementen, zu den Theorien Paracelsus’ sowie zu den damit konkurrierenden Atomismus-Theorien im 17. und 18. Jahrhundert vgl. Klein and Lefèvre 2007, 40–49.
Vitruv, 2. Buch, 5. Kapitel.
Rusconi 1590. Zu Rusconi und der Geschichte seiner Vitruvausgabe vgl. Bedon 1996.
Vitruv, 2. Buch, 5. Kapitel.
Alberti 1485, 2. Buch (8. Kapitel).
Serlios Bücher erschienen einzeln zwischen 1537–1575. Im Jahre 1584 werden die sieben Bücher als Gesamtausgabe gedruckt. Von dieser Publikation gab es im Jahre 1619 eine zweite Auflage.
Palladio 1570, 1. Buch, Kapitel 2–6.
Becchi 2004, vgl. v. a. 65–69. In seinem Beirag zum vorliegenden Band „Fokus: Architektur und Mechanik“ geht Becchi von Baldis Analysen aus und gibt einen Überblick über die disziplinäre Entwicklung der Strukturmechanik.
Galilei 1638; für eine Analyse vgl. Kurrer 2002, 167–176. Vgl. außerdem Benvenuto 1991, insbesondere den zweiten Teil zur Resistenza Solidorum.
Überblick dazu in Schlimme 2006a, 67–72.
Cusanus 1937 (1988).
Dazu Schlimme 2006a, 68–69.
Musschenbroek 1729. Vgl. auch Kurrer 2002, 180–183.
Musschenbroek 1729, Tabellen 671–672, beschreibender Text 668–672.
Le Seur et.al. 1743. Zu den Gutachten über die Schäden an der Peterskuppel vgl. Schlimme 2006c, 2856–2859.
Le Seur et.al. 1743, zitieren auf 25–26 ihres Textes das Experiment LXXVII von van Musschenbroek, Musschenbroek 1729, 505.
Die Geschichte der Bautechnik ist ein großes Forschungsfeld. Zur Bautechnik im Italien der Frühen Neuzeit vgl. u. a. De Feo et.al. 1994/1995, Della Torre 1996, Giovanetti 1997, Galliani and Franco 2001, Conforti and Hopkins 2002, Fiengo and Guerriero 2003, Gargiani 2003a, Marconi 2004, Fiorani and Esposito 2005, Ricci 2007, Gargiani 2008 (die entsprechenden Kapitel), Gargiani 2012 (die entsprechenden Kapitel), nur um einige Überblicks- und Sammelwerke zu benennen. Weitere Literatur wird jeweils bei den Unterkapiteln benannt. Zu benennen sind die Aktivitäten und Publikationen der Associazione Edoardo Benvenuto, des Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florenz), der Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria A.I.S.I. (Neapel) sowie die internationale Tagung Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli (Ravenna 2005), die International Congresses on Construction History (Madrid 2003, Cambridge 2006, Cottbus 2009, Paris 2012) mit den entsprechenden Tagungsberichten, sowie Construction History. International Journal of the Construction History Society.
Alberti 1485, 3. Buch (6.–11. Kapitel).
Palladio 1570, 1. Buch, Kapitel 9–1. Zum calcestruzzo in der Traktatliteratur der Renaissance vgl. Conti 1993.
Scamozzi 1615, 8. Buch, 8. Kapitel (antike Mauerwerkstechniken); Teile des 9. Kapitels (moderne Mauerwerkstechniken), 11. Kapitel.
Scamozzi 1615, 8. Buch, 9. Kapitel.
Zu letzterer vergleiche Pallottino 1999, 331–332.
Vgl. zum unvollendeten Tambour von Sant’Andrea delle Fratte: Bellini 2001.
Bertoldi et.al. 1983, 78–84. Zu Sichtziegelsteinoberflächen in den Marken vgl. Licastro 2003.
1 Scudo = 100 Baiocchi.
Vgl. die Artikel rinzaffo, arriccio und colla von Antonucci in: Antonucci et.al. 2004. Vgl. außerdem Esposito 2001.
Gargiani 2003a, 230–232; vgl. Abschnitt 2.8.
Serlio 1537, 4. Buch, LXVI v.
Serlio 1537, 4. Buch, LXVI v.
Gargiani 2003a, 181–182; Alberti 1485, 2. Buch (7. Kapitel).
Bruschi 1988, 120–122; Alberti 1485, 6. Buch (9. Kapitel); Serlio 1537, 4. Buch, f. 155 v in der Ausgabe von 1619; vgl. Schlimme 1999a, 142. Siehe auch Pagliara 2002.
Pagliara 1998/1999, 240–242: Pagliara beschreibt den Erfolg des opus reticulatum im Mittelalter und in der Renaissance.
Pagliara 1998/1999, 238–239, benennt diese Diskrepanz. Gargiani 2003a, 340–345 analysiert die Verwendung von opus isodomum.
Vgl. Gargiani 2003a, 39–42, der diesen Übergang beschreibt. Zur Rustika in Florenz vgl. Eckert 2000.
Vignola 1562; vgl. Schlimme 2011a.
Ebd.
Alberti 1485, 3. Buch (7. Kapitel).
Zum Begriff tassello vgl. Bonavita in: Antonucci et.al. 2004.
Zum stucco a fuoco vgl. Antonucci in: (Antonucci et.al. 2004).
Alberti 1485, 6. Buch (12. Kapitel).
Zum Begriff ulivella vgl. Marconi in: Antonucci et.al. 2004.
Das bestätigt auch Ceradini 1993, 54–55.
Vgl. Sakarovitch 1998.
Vgl. Abbildung 5 in: Benedetti 2006, 16.
Die folgenden zwei Absätze sind einem Aufsatz des Autors entnommen: Schlimme 2012, 342–343.
Zu San Carlino seien die jüngsten Gesamtdarstellungen benannt: Portoghesi 2001; Degni 2007.
Das entscheidende Dokument, eine Misura e stima des Architekten Bernardo Borromini, liegt unter der Signatur Ms. 77b, doc. 60 im Archivio di San Carlino alle Quattro Fontane in Rom; Inhaltsangabe in Gammino 1993, 71.
Das Beispiel zu Konstruktion und Steinschnitt der Fassade von San Carlo alle Quattro Fontane in Rom ist einem Aufsatz des Autors entnommen: Schlimme 2012, 342–343.
Zu nennen sind u. a.: Lamberini 1995, Martines 1999 (Vergleich Antike-Mittelalter-Frühe Neuzeit), D’Amelio 2002a, Lefèvre 2004 (Maschinenzeichnungen), Marconi 1999, Marconi 2001, Marconi 2002, Marconi 2003 und Marconi 2004, 197–230, Galluzzi 2005, Lamberini 2005/2006, Schlimme 2006b, 167f., 207f., 228–231, 238–240, 244–247, 257f..
D’Amelio 2006; vgl. auch D’Amelio 2002b.
Gargiani 2003a, 35; vgl. Belli 2008, 98.
„Libre doe per pertigoni numero 50 per far ponti in chiesa per metter le colonne in opera dal canto dove era el battistero“ (Piva 1988, 151); „Libre tre per assoni doi di noce di braccia 15, tutti doi per far biette [Keile] per metter sotto li pontelli per metter le colonne di marmo in opera“ (Piva 1988, 152); „Libre quaranta sei, soldi diece per travi cinque di braccia trenta l’uno per attaccar le taglie [Umlenkrollen für Seile] per tirar su le colonne“ (Piva 1988, 154); „Libre sei et soldi dodeci per libbre 44 di corda più forte … per metter le colonne in opera“ (Piva 1988, 152); vgl. Gargiani 2008, 136, der auf diese Quellen hinweist.
„Libre tre per pezzi doi di travello [quadratische dicke Holzbretter] di bracci 15 l’uno … per metter in pié per tirar la colonna in opera, che non tocca el primo pezzo da basso per non romperla“ (Piva 1988, 154). Weitere, unklare Quellen aus dem Rechnungsbuch: „Libra una et soldi diece per doe antenne per far una scala forte per le colonne“ (Piva 1988, 154); „Soldi otto per storoli quattro per metter sotto le colonne lavorate condotte in San Pietro“ (Piva 1988, 151); „… soldi otto per tre scudelle et una sponga che s’usano quando le colonne si mettono in opera“ (Piva 1988, 152).
Belli 2008, 99; Belli zitiert Musso and Copperi 1885.
Belli 2008, 99, Abb. 5.
Vgl. Belli 1991; Gargiani 2003a, 35; Belli 2008, 101–113; vgl. auch die Database Machine Drawings: http://dmd.mpiwg-berlin.mpg.de/home (besucht am 10.5.2011).
Gewölbe- und Kuppelbau ist ein großes Thema in der Bautechnikgeschichte. Um nur die jüngsten Monographien und Sammelwerke zu benennen: Conforti 1997, Sakarovitch 1998, Becchi and Foce 2002, Ochsendorf 2002, Bellini 2004, Huerta 2004, Addis 2007 (die entsprechenden Kapitel), Villani 2008, Bellini 2011.
Gargiani 2003a, 92–93: In Rom Sant’Onofrio auf dem Gianicolo (ca. 1446), der Kreuzgang von Santa Francesca Romana, Schiff von Santa Maria del Popolo (ab 1472).
Gargiani 2003a, 121–124. Alberti 1485, 7, 7. Buch (11. Kapitel) und 3. Buch (14. Kapitel): dort berichtet Alberti über die Florentiner Domkuppel.
Schlimme 2010; zu den kassettierten Wölbungen vgl. Pagliara 1998/1999; Pagliara 2002; Gargiani 2003a, 220–223, 462–465; Wolff Metternich and Thoenes 1987, 188; Belluzzi 1993; Frommel 1976; Frommel 1991, 180–181; Sanpaolesi 1964; Beispiele für kassettierte Wölbungen aus dem 15. Jahrhundert: Florenz: Pazzi-Kapelle, Skaristei von Santo Spirito, Giuliano da Sangallos kassettierte Wölbungen in Florenz und Umgebung werden in der folgenden Anmerkung benannt; Rom: Vestibül des Palazzo Venezia, Santa Maria del Popolo (Bramantechor); Bergamo: Santo Spirito; Lodi: Santuario di Santa Maria Incoronata; Lovere: Santa Maria in Valvendra; Mailand: Santa Maria presso San Satiro; Mantua: Sant’Andrea in Mantua, Vestibül und Seitenkapellen im Inneren; Neapel: Castel Nuovo; Piacenza: Santo Spirito (Hauptschiff); Pistoia: Cattedrale San Zeno, Madonna dell’Umiltà (Vestibül); Urbino: Palazzo Ducale, Tonnen unter dem Thronsaal und Loggienfassade; Venedig: Palazzo Ducale (Decken im Scarlatti-Saal und im Erizzo-Saal), Santa Maria dei Miracoli (Tonne im Langhaus), Santuario di Santa Maria delle Grazie presso Curtatone.
Giuliano da Sangallo hat eine Reihe kassettierter Tonnenwölbungen ausgeführt, und zwar in der Casa Bartolomeo Scala (ca. 1472–1480), in der Villa di Agnolo di Tovaglia (Mitte 1490er Jahre), im Palazzo Giuliano della Rovere in Savona (ca. 1495), im studio von Giuliano da Sangallos eigenem Palast im Borgo Pinti in Florenz (ab 1491) sowie im Portikus (ca. 1494) und im salone (16. Jahrhundert) der Villa Medici in Poggio a Caiano.
Alberti 1485, 7. Buch (11. Kapitel) beschreibt den Bau einer kassettierten Wölbung als Konglomeratschüttung und war – so vermutet Gargiani 2003a, 211f. – wohl beim Bau der Wölbung des andito des Palazzo Venezia zugegen. Vgl. auch Wolff Metternich and Thoenes 1987, 188 und Pagliara 1998/1999, 235, 251 sowie Pagliara 2002, 544, Anm. 116.
Pagliara 1998/1999, 233, 249ff.: Im 2. Jh. v. Chr. gab es die ersten Konglomeratgewölbe in Latium und Kampanien. Während es aus dem 7. bis 9. Jahrhundert nur wenige und zweifelhafte Beispiele gibt, haben sich aus dem Zeitraum vom 11. bis zum 14. Jahrhundert eine Reihe von Gussgewölben erhalten, etwa in den Konventen Sant’Oliva in Cori (14. Jh.) und San Martino ai Monti (Anfang 13. Jh.). Es gibt die Tonnenwölbung von Santa Prassede (11.–12. Jh.), die Cappella S. Giuliano in S. Paolo fuori le mura (vor dem Ende des 12. Jh.), die gewölbten Räume im Vatikanischen Palast aus dem 13. Jh., die Ruine der Kirche in Ninfa und die Castelli della Valle del Sacco aus dem 12. bis 14. Jahrhundert; vgl. Schlimme 2010, 53.
Alberti 1485, 3. Buch (14. Kapitel).
Scamozzi 1615, Band II, Buch VIII, Kap. XV, 325.
Ebd., vgl. Marconi 2004, 193–194.
AFSP, arm.1, rip.B, vol. 16, Artisti diversi (1542–1675), n.24, c.110r., siehe Marconi 2004, 195.
Alberti 1485, 3. Buch.
Zu San Pietro in Montorio vgl. Cantatore 1997.
Vgl. u. a. Mainstone 1969-1970, Mainstone 1977, Di Pasquale 2002, Mainstone 2009, jüngst Corazzi and Conti 2011.
Zu den folgenden Absätzen vgl. Schlimme 2011b, 132–134.
Siehe hierzu die ausführlichen Studien von Christof Thoenes: Kraus and Thoenes 1991/1992; Thoenes 1994; Thoenes in: Millon and Magnago Lampugnani 1994, Kat. 348, Kat. 359, Kat. 367, Kat. 370, Kat. 372; Thoenes 1995; Thoenes in: Evers 1995, Kat. 127, Kat. 128, Kat. 131, Kat. 132; Thoenes 1996 bzw. Thoenes 2002; Thoenes 1997; Thoenes 1998; Thoenes 2000, Uff A 66r, UffA 87r, Uff A 267r.
Benedetti 1992; Benedetti 1994a; Benedetti 1994b; Benedetti 1995; Benedetti 2009. Arnaldo Bruschi macht bereits ähnliche Überlegungen, ohne jedoch die Kuppelprofile geometrisch zu analysieren und veweist auf die ältere Literatur zu dieser Frage: Bruschi 1988, 232–251.
Zu Uff. A 66 r vgl.: Thoenes, in; Millon and Magnago Lampugnani 1994, Kat. 348; Thoenes, in: Evers 1995, Kat. 127; Thoenes 2000, Uff. A 66r. Uff. steht kurz für das Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi in Florenz.
Zu Uff. A 267 r vgl.: Thoenes, in: Millon and Magnago Lampugnani 1994, Kat. 359; Thoenes 2000, Uff. A 267r.
Thoenes, in: Millon and Magnago Lampugnani 1994, Kat. 359; Thoenes 1996 bzw. Thoenes 2002; Thoenes 2000, Uff. A 267r.
Thoenes hat die Kuppel des Sangallomodells vermessen und als Ellipsenkonstruktion identifiziert: Thoenes, in: Millon and Magnago Lampugnani 1994, Kat. 372, aber ohne Abbildungen publiziert; Thoenes, in: Evers 1995, Kat. 132, Anhang, 377f.; Thoenes 1996 bzw. Thoenes 2002; Thoenes 1997; Thoenes 1998; Dürer 1525, CIIIr, Abb. 33.
Serlio 1545, 13v und 14r.
Dürer 1525, CIIIv–CVr.
Zu Antonio da Sangallo des Jüngeren Kenntnis der Kegelschnitte vgl. Thoenes 1997, Postscriptum und Zanchettin 2011. Dort weitere Literaturhinweise.
Das Traktat des griechischen Mathematikers war neu aufgelegt worden: Pergaeus 1537. Dieser Absatz wurde aus Schlimme 2011b, 132–133 übernommen und leicht überarbeitet.
Benedetti 1994a bzw. Benedetti 2009, 65–77. Thoenes widerspricht dem: Thoenes 1998, Anm. 19 und Thoenes 1997.
Benedetti 1992; Benedetti 1994a; Benedetti 1994b; Benedetti 1995; Benedetti 2009; zur Stichserie Salamancas vgl. auch Thoenes, in: Millon and Magnago Lampugnani 1994, Kat. 370; Thoenes, in: Evers 1995, Kat. 131.
Der Autor des vorliegenden Textes hat das geometrisch geprüft.
Dieser Absatz wurde aus Schlimme 2011b, 133–134 übernommen und leicht überarbeitet.
Dieser Absatz wurde aus Schlimme 2011b, 134 übernommen und leicht überarbeitet.
Neben der Kuppel in Montefiascone (1670–1672/73) baute Fontana die Kuppeln der Kirche Santa Maria dei Miracoli in Rom (ab 1677) und der Cappella Cybo in Santa Maria del Popolo in Rom (1682–1684). Zudem wurde nach Fontanas Plan (wenn auch mit Veränderungen) in den Jahren 1686–1732 die kuppelüberwölbte Kirche des Collegio di Sant’Ignazio in Loyola ausgeführt (1738 geweiht). Fontana erstellte viele weitere Kuppelentwürfe und -gutachten. Er war einer der ersten, der bestehende Kuppeln systematisch dokumentierte, Kuppelbauwissen zusammentrug, diese Informationen schriftlich niederlegte und publizierte. Zu Fontana vgl. Hager 2003. Schriften Fontanas zum Kuppelbau sind neben dem bereits zitierten Tempio Vaticano v. a. folgende Manuskripte: Carlo Fontana, Dichiaratione Dell’operato nella Cuppola di MonteFiascone Colla difesa dalla censura (1673) und Discorso Sopra le caggioni onde derivano li difetti, che giornalmente si scorgano nella Cuppola o Volta della Chiesa Nova di Roma & per li proposti rimedij al suo bisognoso riparo (1675), Manuskripte, Biblioteca Estense, Modena, Ms. Camp. 379 = γ.B.1.16. Einen Überblick über Fontanas publizierte und unpublizierte Schriften gibt Bonaccorso 2008, 157.
In seinem Manuskript von 1673, in dem er Informationen zu gebauten römischen Tambourkuppeln zusammenträgt, um seine Kuppel in Montefiascone zu verteidigen (s. u. Abschnitt 2.12.2), dokumentiert Fontana auch die Kuppeln von Sant’Andrea della Valle und Sant’Agnese in Agone maßlich, ohne jedoch ihr ovale Profilierung zu berücksichtigen. Im Manuskript werden Kuppeln ausschließlich mit Spitzbogenprofil gezeigt. Siehe Schlimme 2011b.
Die voraufgehenden Zeilen wurden aus Schlimme 2011b, 135 übernommen und leicht überarbeitet.
„Si rende difficoltosa (sic!) a’ Professori, per le vaste, & incommode misure, che non sono permesse, se non con gran tempo, e fatiga, la cognizione di esse. Nulla di meno vi abbiamo supplito; mediante le nostre deboli applicazioni, e portiamo con ogni fedeltà nella seguente Tavola il Profile, ò sia Sezione della Cupola con il rimanente sino al Piano del Pavimento, dove appariscono le linee delle Regole“, Fontana 1694, 329; vgl. Döring-Williams and Schlimme 2011, 211.
Vgl. Schlimme 2011b, 135–136.
Villani 2008, 95–96, Anm. 18, 175. Im Sommer und Herbst 1622 wurden umfangreiche Mengen Puzzolanerde und tevolozza geliefert. Archivio di Stato di Roma, Sant’Andrea della Valle, b. 2161, fasc. 160, ff. 69r, 69v. und f. 72r. In Tabelle 5 auf S. 253 sagt Villani jedoch, der Tambour sei möglicherweise aus Ziegelstein errichtet worden. Von der Ziegelsteinvorsatzschale hinsichtlich des Tambours ist auch die Rede in einer anderen stima: Archivio di Stato di Roma, Sant’Andrea della Valle, b. 2162, fasc. 161, f 1r. Bereits Pallottino 1999, 331–332, wies auf letzteres Dokument hin. Dort berichtet Pallottino generell über die Bauweise aus tevolozza und Ziegelsteinvorsatzschale, die sich zwischen dem Endes des 16. und dem Beginn des 17. Jahrhunderts in Rom durchsetzte.
Villani 2008, Tabelle 5, 253.
Serlio 1584, 203–205. Die Originalausgabe des 5. Buches erschien 1547 in Paris.
Baldi 1621, 102ff., diskutiert von Becchi 2004, 82ff.. Becchi benennt als weitere Beispiele die Manuskripte von Giovanni Battista da Sangallo und Guidobaldo del Monte. Sangallos Skizzen von Dachbindern befinden sich in einem Exemplar der ersten nachantiken Ausgabe des Vitruvtextes (Vitruvius 1486), die als anastatischer Nachdruck zur Verfügung steht (Rowland 2003). Im anastatischen Nachdruck sind die Skizzen auf den Seiten 89 und 271 zu finden. Del Monte, Meditatiunculae Guidi Ubaldi […], Bibliothèque Nationale de France, Paris, M Lat. 10246. Zur Entwicklung der Dachbinder in Rom vergleiche jüngst: Valeriani 2003; Valeriani 2005; Valeriani 2006.
BNCF, Ms., Galileiani 122, Discorso quarto, f. 65r.
Vgl. für diesen Absatz: Schlimme 2006a, 80.
Vgl. Folkerts et.al. 2001.
Knobloch 2001b, 121–150; zu den älteren Traktaten vgl. Artikel quadrante von Filippo Camerota in: Antonucci et.al. 2004.
Vgl. Artikel quadrante von Filippo Camerota in: Antonucci et.al. 2004; vgl. Knobloch 2001a, v. a. 155f. Knobloch berichtet, der Quadrant sei bereits in der griechischen Antike beschrieben worden. Bei Camerota und Knobloch werden jeweils auch weitere Messinstrumente beschrieben.
Vgl. zu diesem Absatz auch Schlimme 2006b, Problem 39, 241. Zum im Text erwähnten Entwicklungsschub vgl. die Traktate von Fabri 1598, Romano 1595, Pifferi 1595, Galilei 1606; vgl. dazu Camerota 2000.
Exakter Wochentag ermittelt auf folgender Seite: http://www.adoption.de/init_kalender.htm (27.07.2010).
„Magistro Luce. Vogliamo che domane tu vegni da nui a Borgoforte et porti cum te li squadri et havemo anche scripto a Petro Philippo che ne mandi xii gumiselli de laza da tirare corde, perché zobia di matina deliberamo andare a Cavallara per dessignare et squadrare quella casa lì et tu sai che in questi principii el discipulo non può far bene senza il magistero; però te aspectamo domane cum li squadri, advisandote che non te teniremo desviato se non un zorno. Saviole, xii septembris 1475.“ (Hervorhebung in der Quelle), Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, copialettere, busta 2893, libro 79, carta 57r., zitiert nach Carpeggiani and Lorenzoni 1998, 246; außerdem publiziert in: Brown 1971, 155; Vasic Vatovec 1979, 399; Calzona 2002, 268 (Dank an Jens Niebaum für den Hinweis auf diese Quelle).
„A laude e gloria di Dio, alla conservazione dello Stato ecclesiastico, alla esaltazione dei buoni, alla confusione e perpetua dispersione dei tristi. Celebrati dapprima i divini ufficî nella Chiesa di S. Benedetto, ove collegialmente intervennero il Magnifico, in ambo le Leggi Dottore, Sebastiano Atracino, Governatore e Luogotenente nella Terra di Norcia per l’Illmo. e Rmo. Sig. Fulvio della Cornia, Cardinale Perugino, di Ascoli e Norcia Vice-Legato degnissimo, ed i Magnifici Signori Consoli, cioe l’Illmo. Francesco Silvestri Priore e gl’infrascritti suoi colleghi, non che cinque del numero de’ quaranta Conservatori della Pace, unitamente all’Eccmo. Architetto Jacopo Barozio detto il Vignola. Così collegialmente congregati pertanto, celebrati i divini Uffizî, si condussero presso al Palazzo del Magnifico Sig. Governatore, dal qual punto, distendendosi verso la Porta detta delle Cerescie, fu disegnata la detta Rocca o Castellina per la pace perpetua del popolo Nursino.“ (Hervorhebungen in der Quelle) datiert 28. August 1554, zitiert nach: Patrizi-Forti 1968, 6. Buch, 475.
Taccola 1969; Alberti 1485, 4. Buch (4. Kapitel); Gargiani 2003a, 267.
Alberti 1485, 4. Buch (4. Kapitel); vgl. Gargiani 2003a, 264, 269.
Hoppe and Hohrath 2006, Spalte 955.
Einen Überblick über die Festungsbautheorie gibt Kruft 1991, 9. Kapitel; vgl. auch Lamberini 1991 zum Erdfestungsbau in der Toskana im 16. Jahrhundert.
Hoppe and Hohrath 2006, Spalte 953.
Boato and Pittaluga 2003 über einen Umbau im Genua des 17. Jahrhunderts; Bonavia 1997 über die Reparatur und den Umbau von Gewölben im Palazzo Altemps in Rom und in der Villa Chigi in Formello; Schlimme 2006b, 192–194, über die Accademia della Vachia, die sich die Aufgabe stellte, zwei gewölbte Räume in einen zu vereinigen, ohne die Geschosse darüber abzureißen.
Baldi 1621; vgl. den Beitrag von Antonio Becchi „Fokus: Architektur und Mechanik“ im vorliegenden Band und den Abschnitt 2.8.11.
Anderson 2009; vgl. zum Thema auch Garofalo 2010 und Farr 2000.
Zur Lehre an der Accademia di San Luca (und zur Rolle der concorsi) vgl.: Cipriani 2000; Giusto 2003; Manfredi 2008; Cipriani 2009.
Bonaccorso 1998; vgl. den entsprechenden Absatz zu den studi di architettura in Curcio 2000, 61f..
Curcio 2000, 63–64; das Salvatore Casali zugeschriebene Manuskript ist Lode di architettura betitelt, ca. 1762 datierbar und wird im Museo di Roma in Rom aufbewahrt (n. 5837).
Zur Verbreitung der römischen Architekturkultur in Vorlagenwerken vgl. jüngst Antinori 2013.
Serlio 1540, XXXVII–XLIIII.
Curcio 1999, 287–292 u. Kat.; vgl. del Piazzo 1968, 163–176.
Entscheidend ist die jüngste Monographie: Belluzzi and Belli 2003. Dort sämtliche ältere Literatur. Zu der bereits in der Vergangenheit geäußerten Vermutung, der Entwurf für die Brücke stamme von Michelangelo, vgl. jüngst Masini 2010; zum Brückenbau im 15. Jahrhundert vgl. Gargiani 2003a.
Der Einsatz mehrerer meterlanger Anker aus pietra serena im oberen Bereich der Pfeiler blieb ebenso ungeklärt wie der Sinn von horizontalen Schichten aus Sand, Kies und Lehm in den Pfeilern. Belluzzi and Belli 2003, 176, 223f., 231f..
Auch die jüngste historische Aufarbeitung aller Archivquellen und Bauabrechnungen des 16. Jahrhunderts erlaubt die Rekonstruktion einer manuellen Bauanweisung nicht: Belluzzi and Belli 2003.
Vgl. Bührig et.al. 2006, 8.
Zum Beispiel Kuppelbauwissen Fontanas: Schlimme 2011b.
Diese Definition von praktischem Wissen folgt derjenigen aus dem Vortrag, den Jürgen Renn am 14.11.2006 aus Anlass der Evaluierung des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte (Berlin) in englischer Sprache gehalten hat. Der Vortrag leitete die Präsentation verschiedener Projekte ein, unter anderem des Projekts „Wissensgeschichte der Architektur“.
Zu den kassettierten Wölbungen vgl. Pagliara 1998/1999; Pagliara 2002; Gargiani 2003a, 220–223, 462–465; Wolff Metternich and Thoenes 1987, 188; Belluzzi 1993; Frommel 1976; Frommel 1991, 180–181; Sanpaolesi 1964; Schlimme 2010.
Vgl. Calzona and Volpi Ghirardini 1994, 85; Dokumente ebd. doc. 137, 198.
Holzer and Köck 2008, dort auch weitere gebaute Beispiele für Holzkuppeln.
Die Interaktion zwischen Bauwesen und entstehender moderner Naturwissenschaft ist ein viel bearbeitetes Forschungsfeld. Vgl. u. a.: Heyman 1972, Galluzzi 1977, Aveta 1997, Benvenuto 1991, Di Pasquale 1996, Halleux 2002, Kurrer 2008, Becchi and Foce 2002, Sakarovitch 2002, Becchi 2004, Schlimme 2006a, Bösel and Camerota 2004, Niglio 2007, Kurrer 2008, Como 2010, Valleriani 2010, Payne 2012, Becchi et.al. 2013 und die Buchreihen Between Mechanics and Architecture, Basel 1995 (begonnen von Patricia Radelet de Grave und Edoardo Benvenuto) und Studies in the History of Civil Engineering, Aldershot 1997–2001 (Joyce Brown Gesamtherausgeber) um nur wenige Titel beispielhaft zu benennen. Einen Überblick über das Forschungsfeld gibt die Bibliotheca Mechanico-Architectonica. An Open Source Digital Library Between Mechanics and Architecture (http://www.bma.arch.unige.it/ besucht am 6. Juni 2013).
Schlimme 2006a gibt einen Überblick über die Interaktion beider Bereiche.
Robert Hooke hatte Idee, dass die umgedrehte Kettenlinie eine ideale Gewölbegeometrie ist. Die Innenkuppel der nach Entwurf Christopher Wrens errichteten St. Paul’s Cathedral in London erhielt diese Geometrie, siehe Heyman 1998.
Alberti 1485, 1. Buch (10. Kapitel).
Becchi and Foce 2002, 31 und La Hire 1695 (bzw. La Hire 1730) und La Hire 1731, wo Texte La Hires von 1712 publiziert werden; zu La Hire jüngst Becchi et.al. 2013.
Le Seur et.al. 1743; vgl. dazu Schlimme 2006c mit aller älteren Literatur und jüngst Capecchi and Tocci 2011, 47.